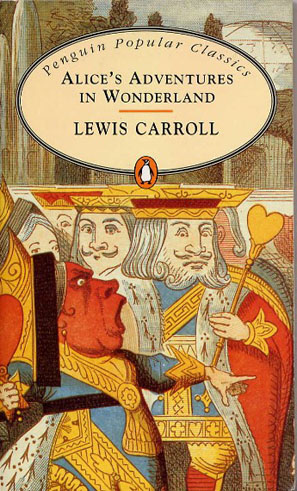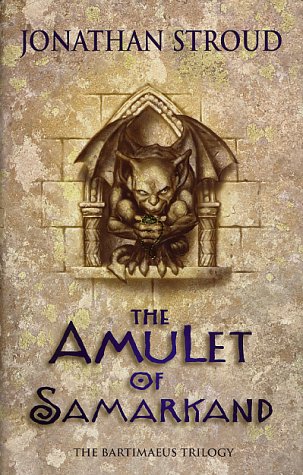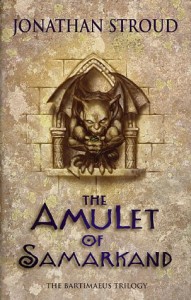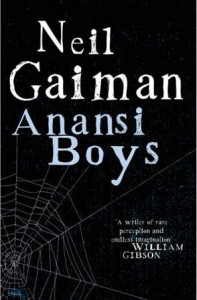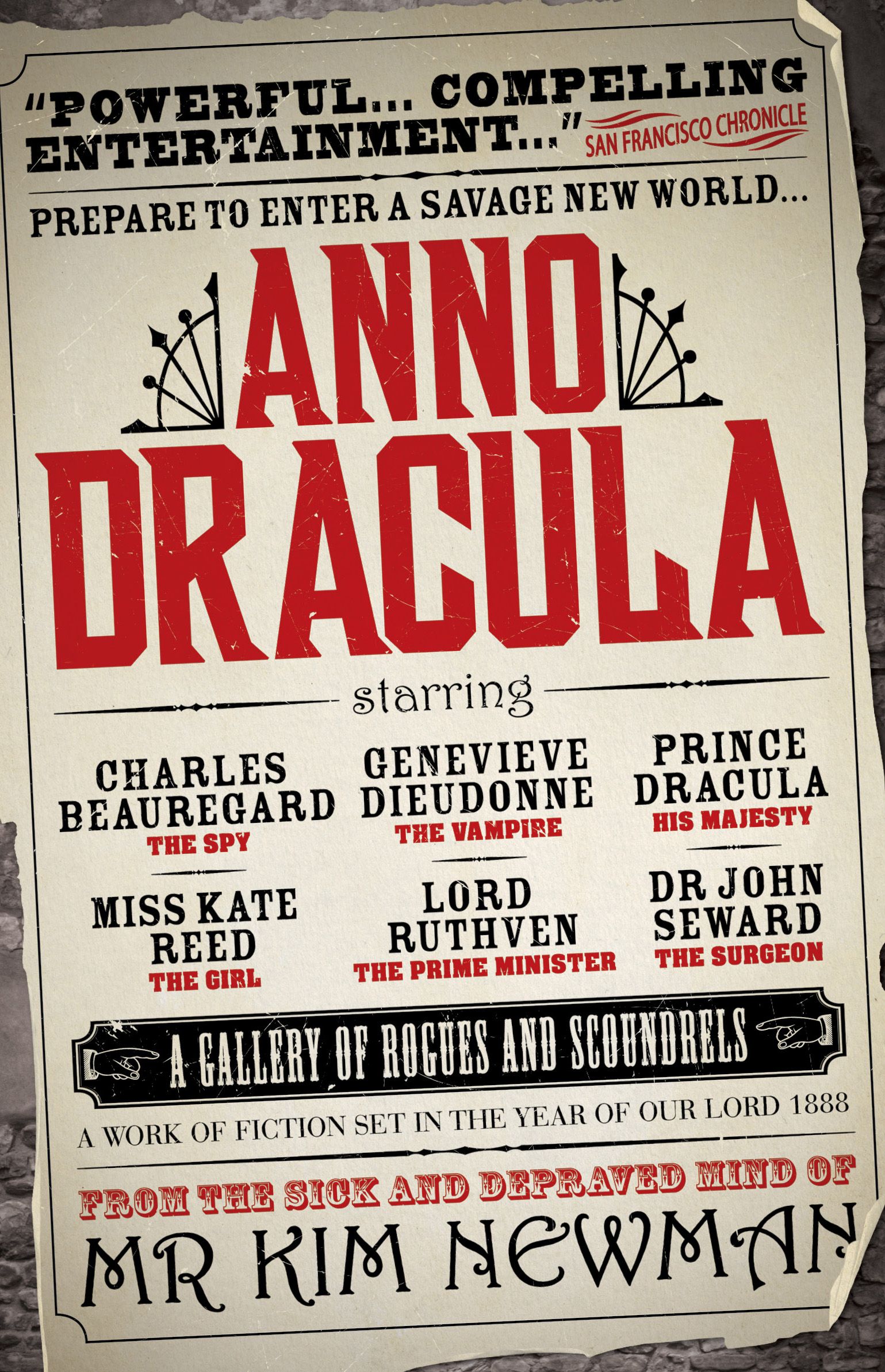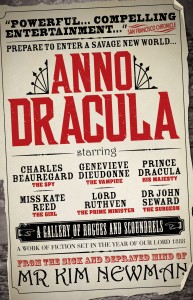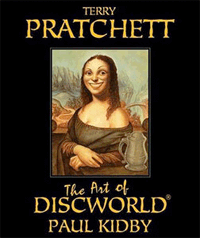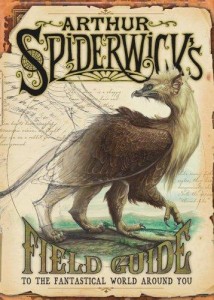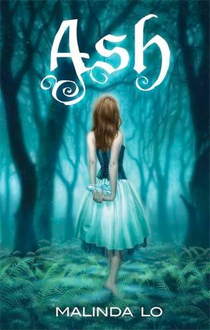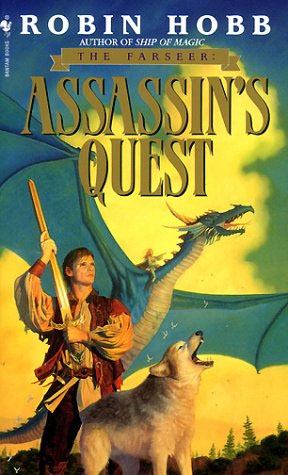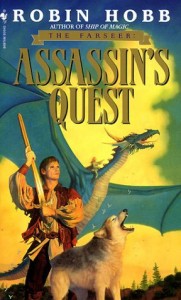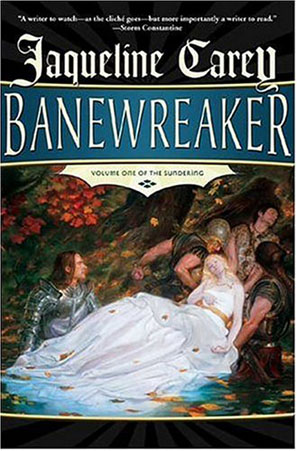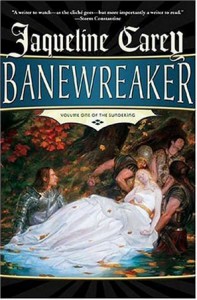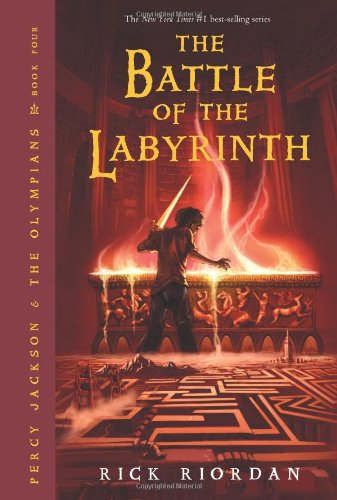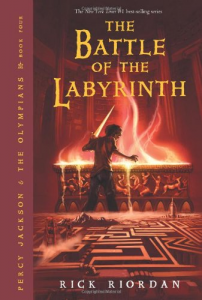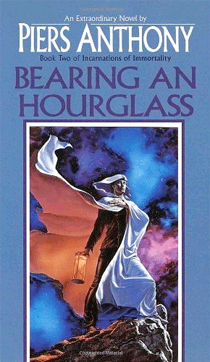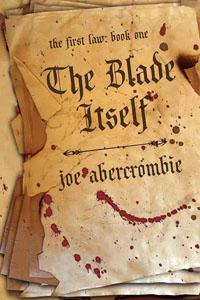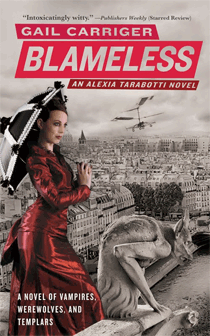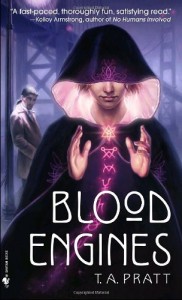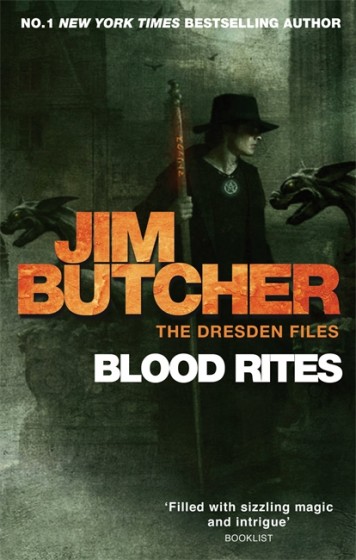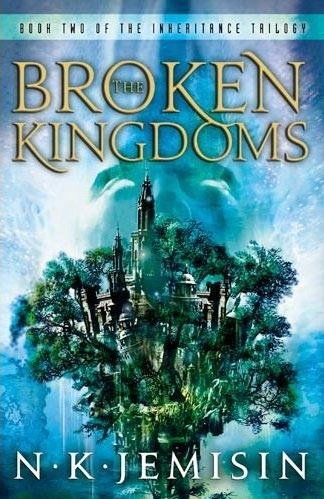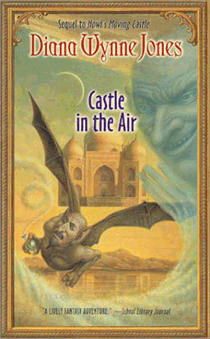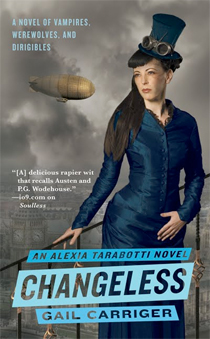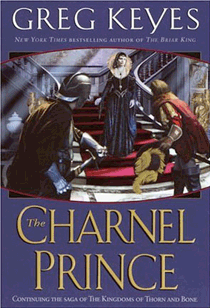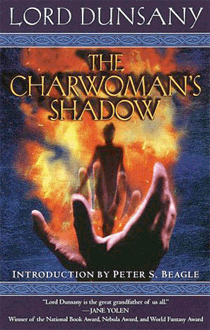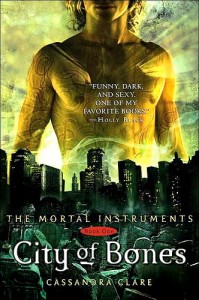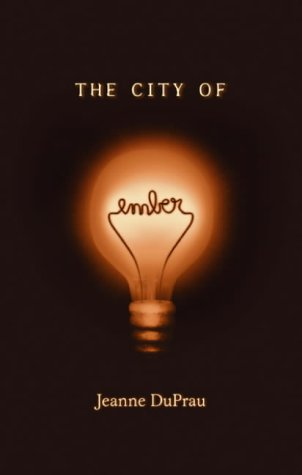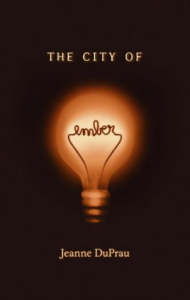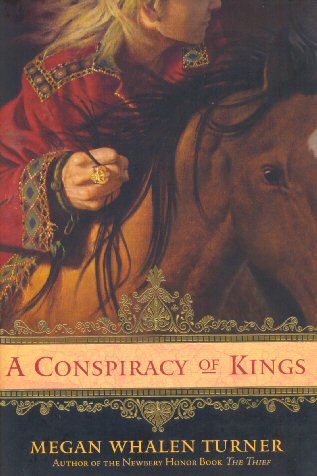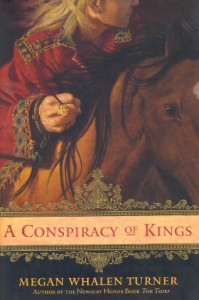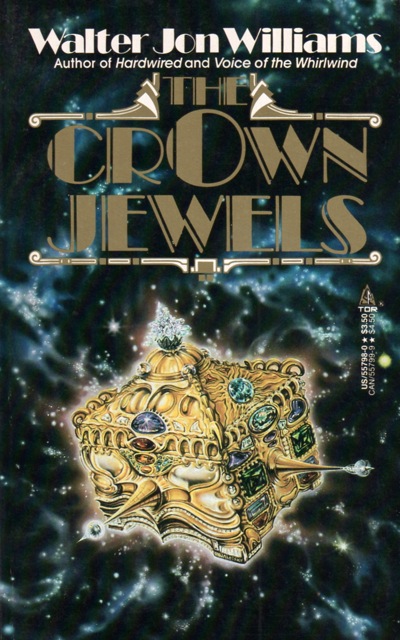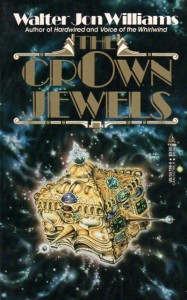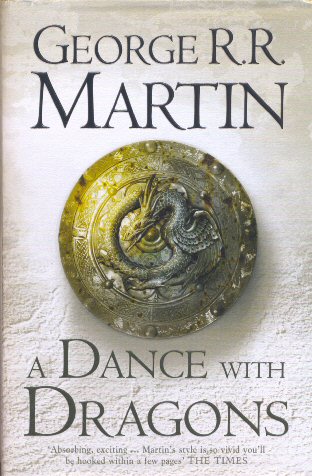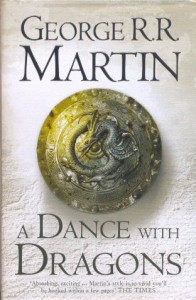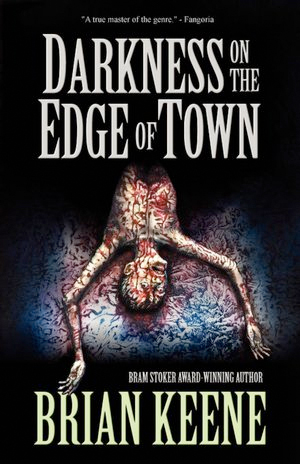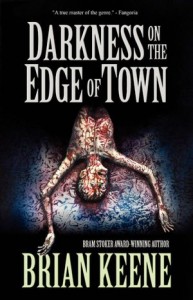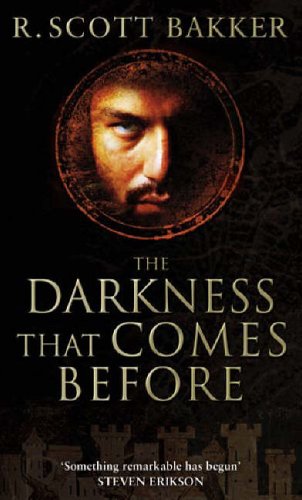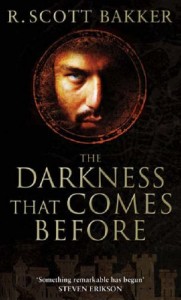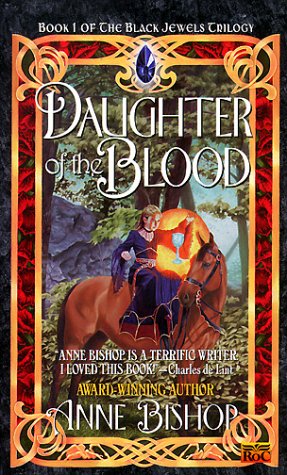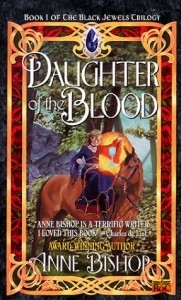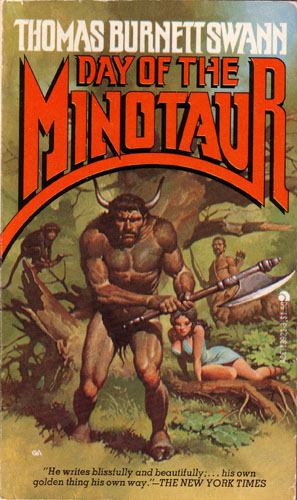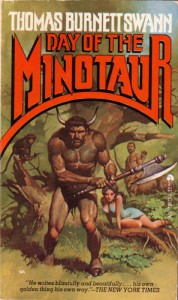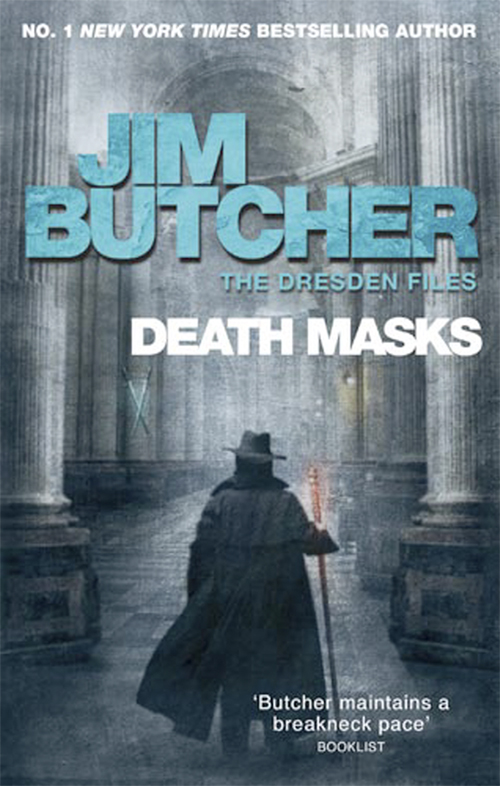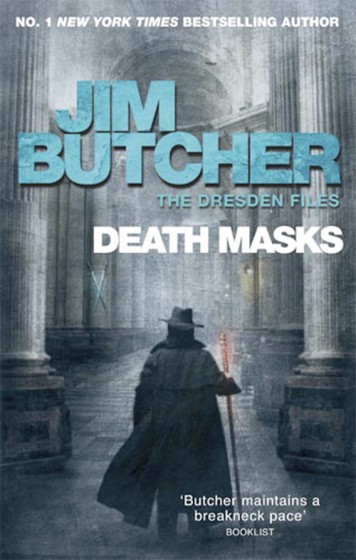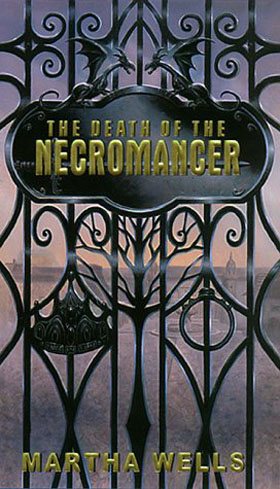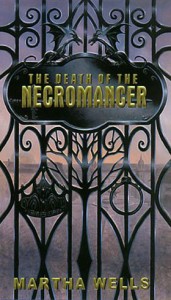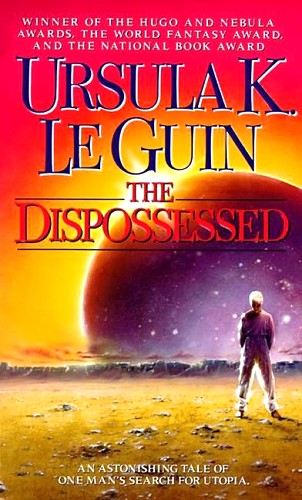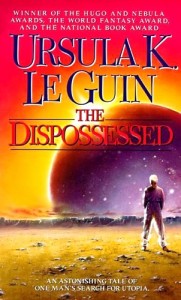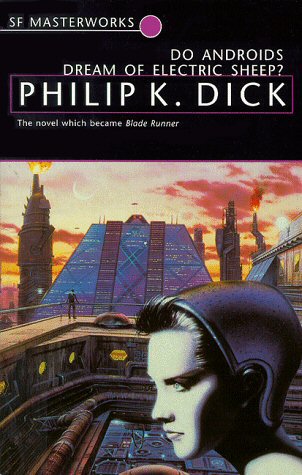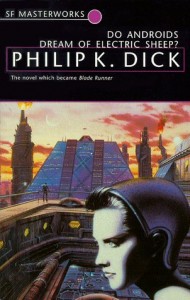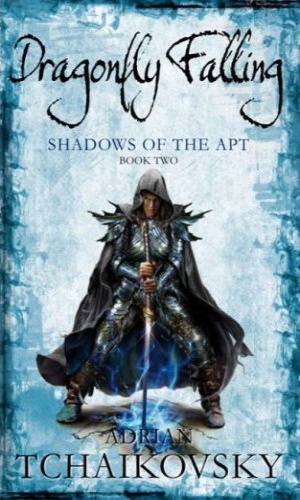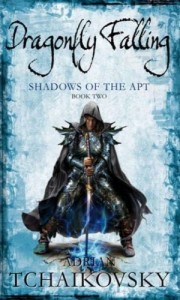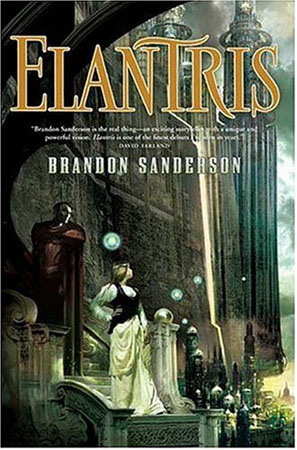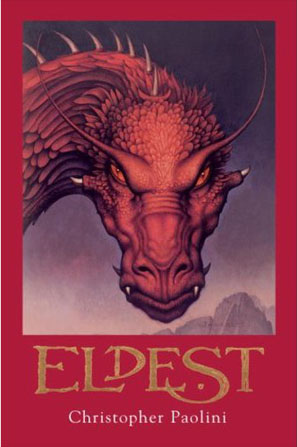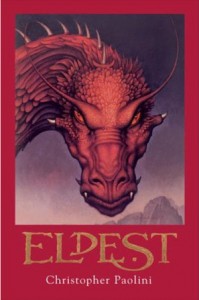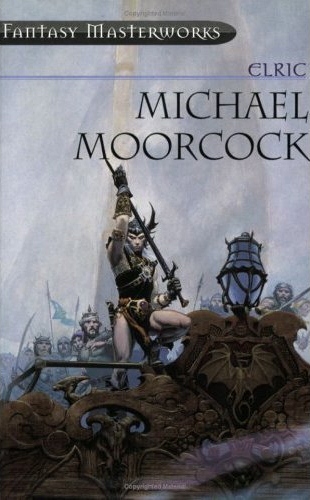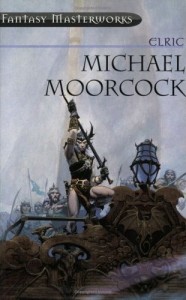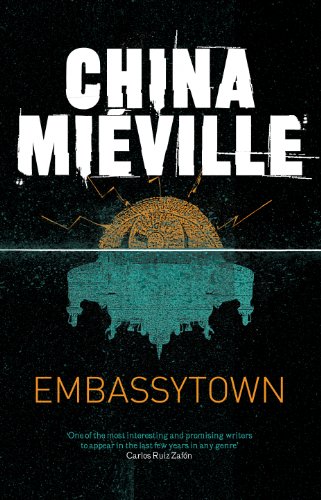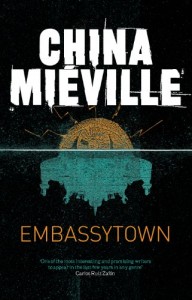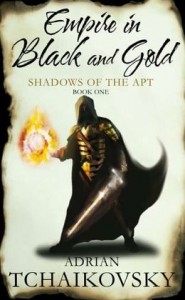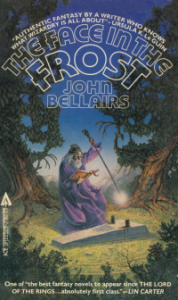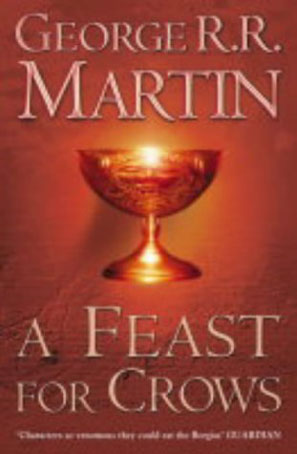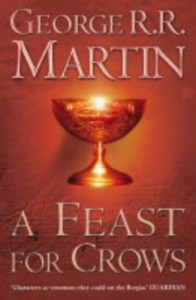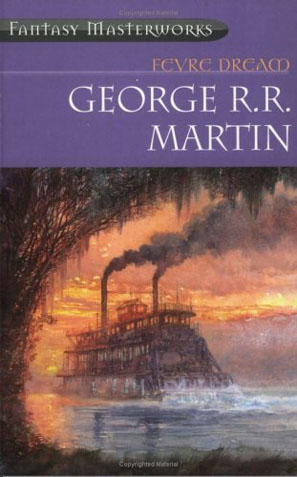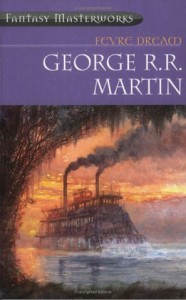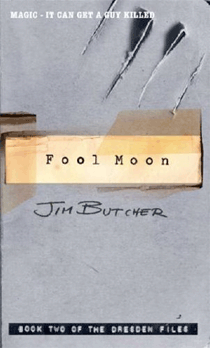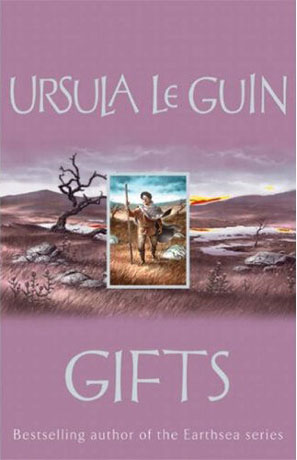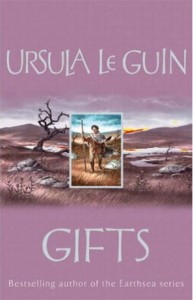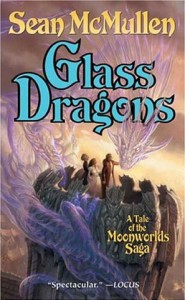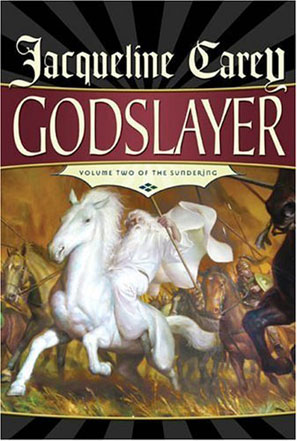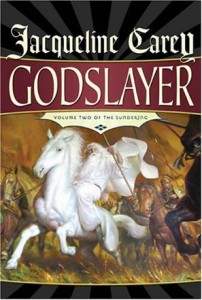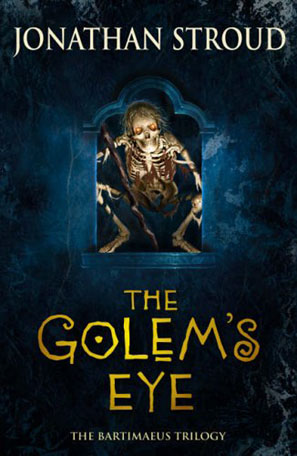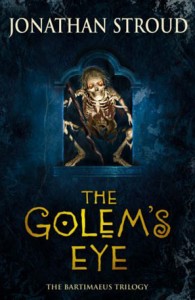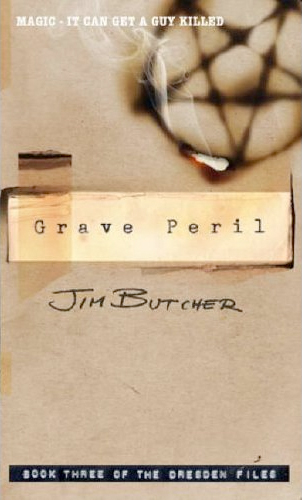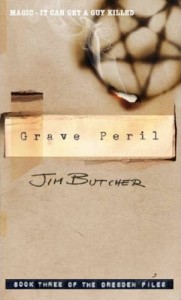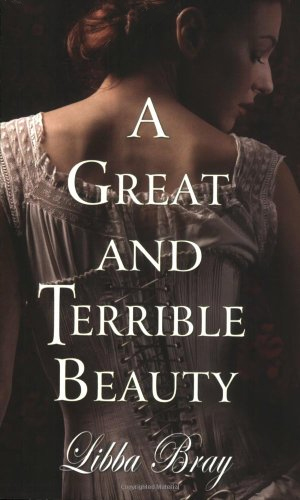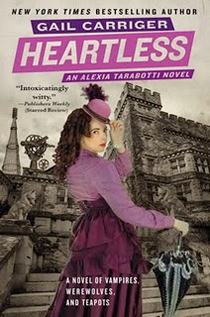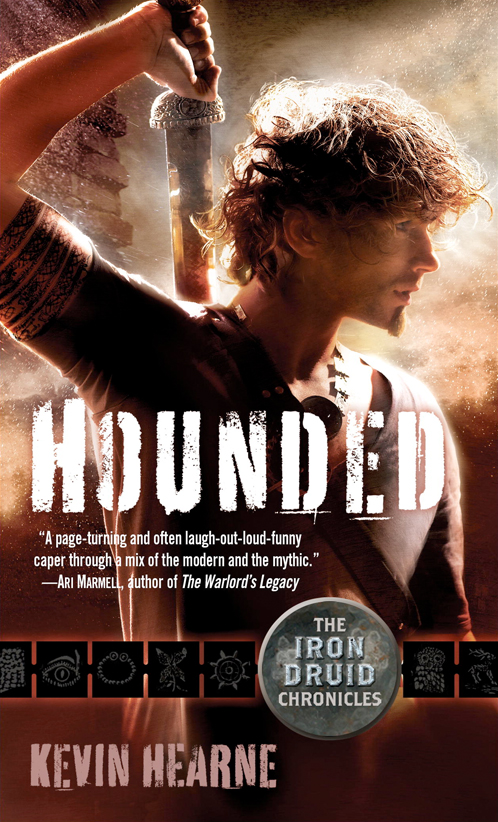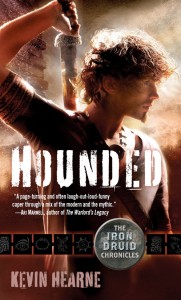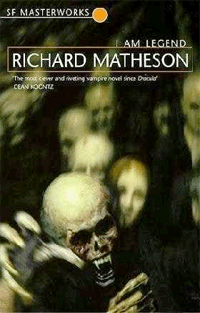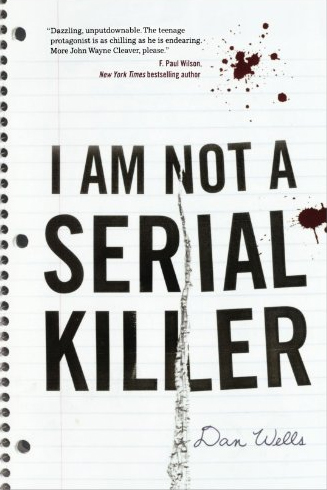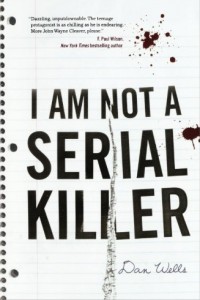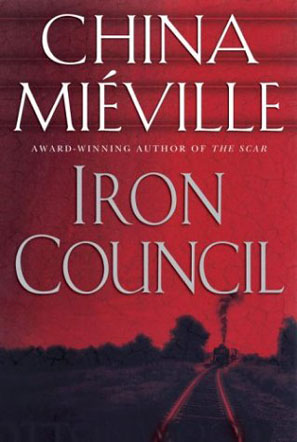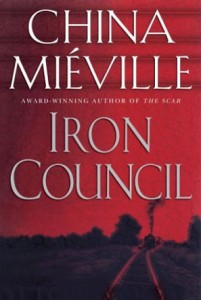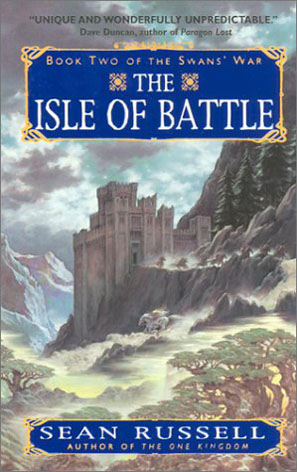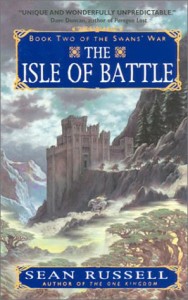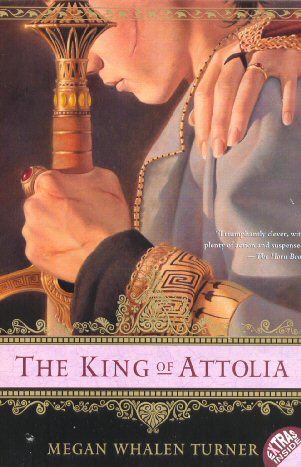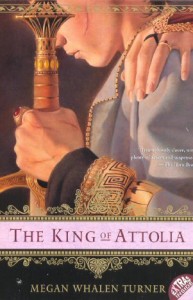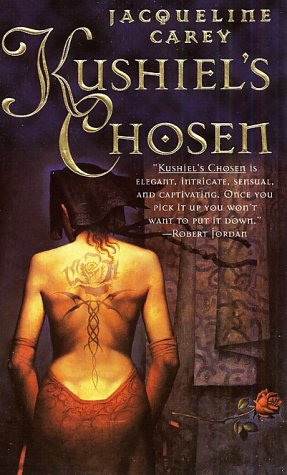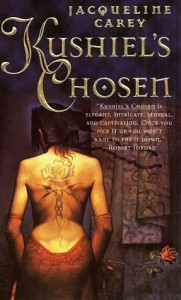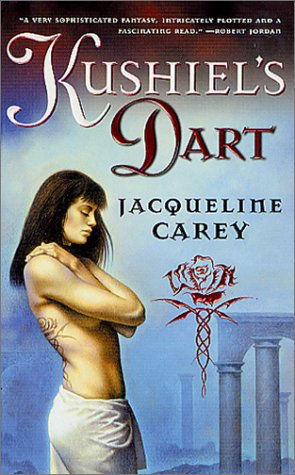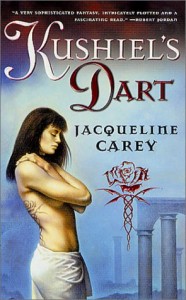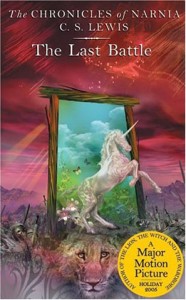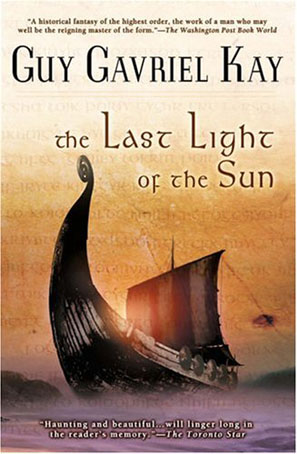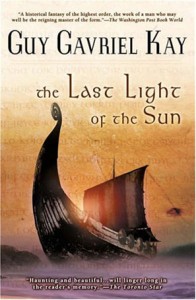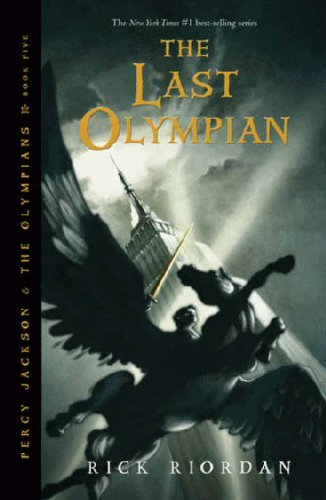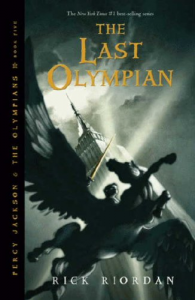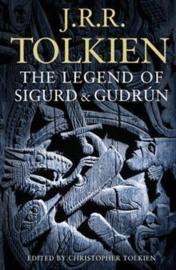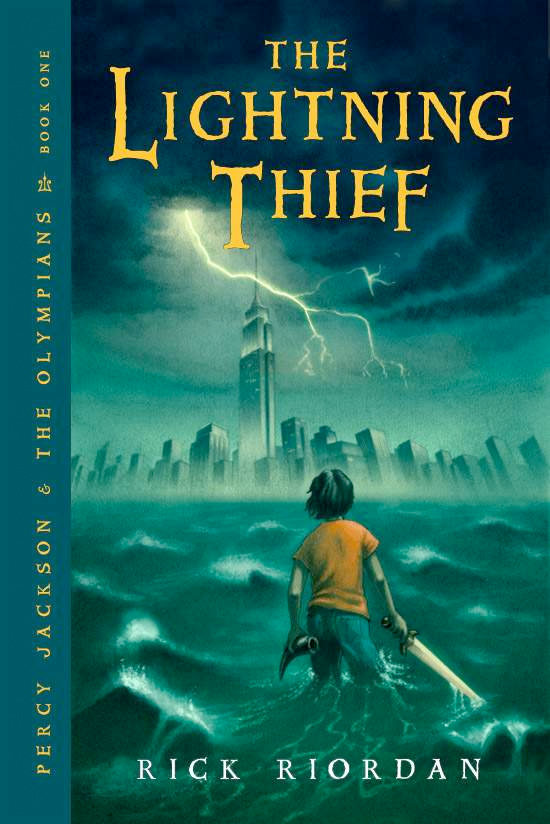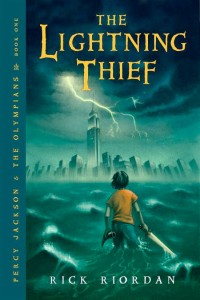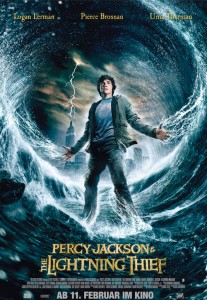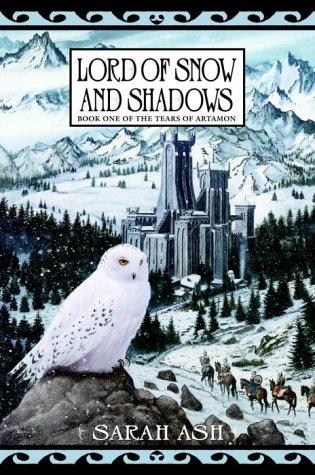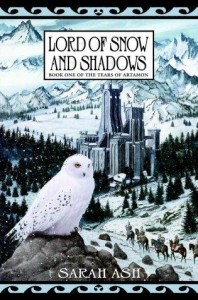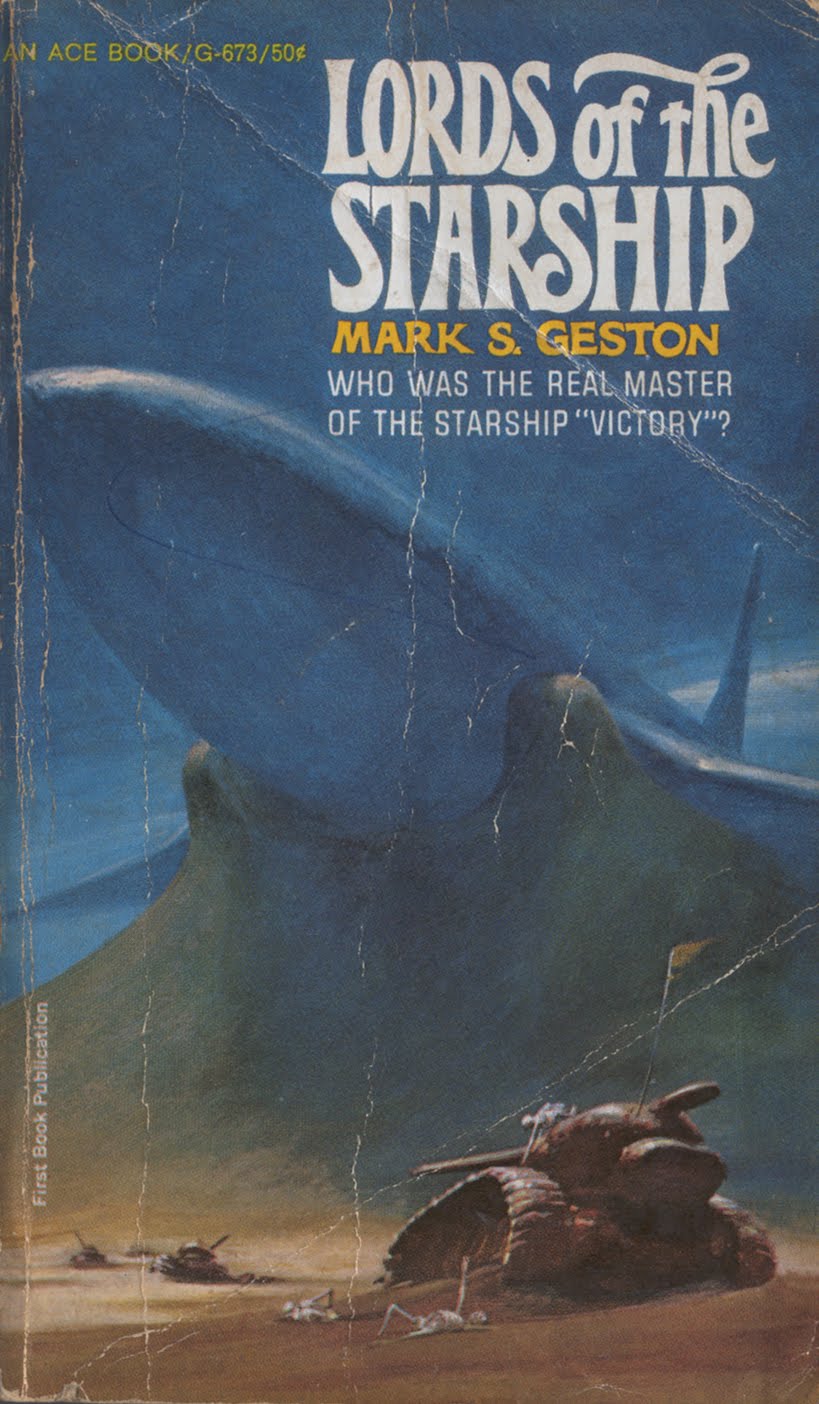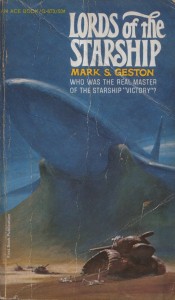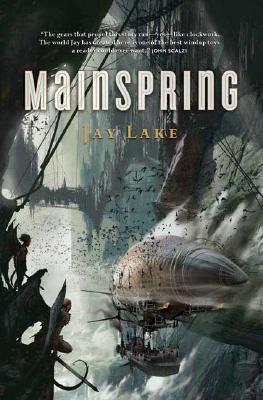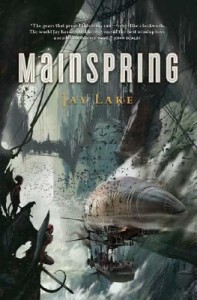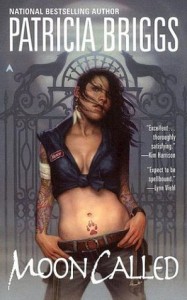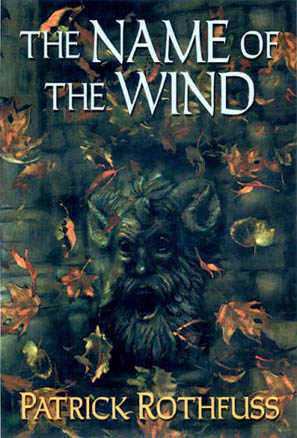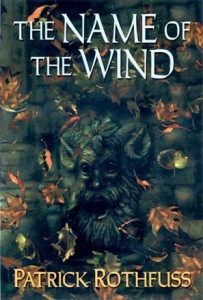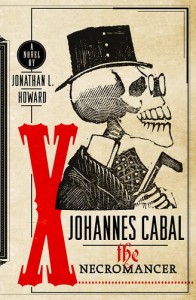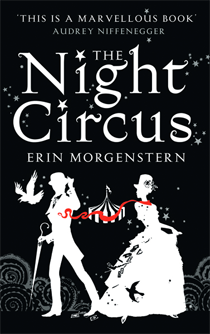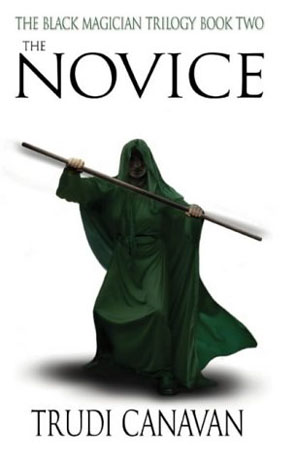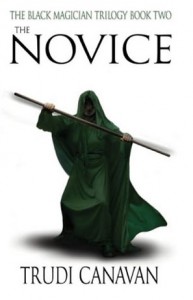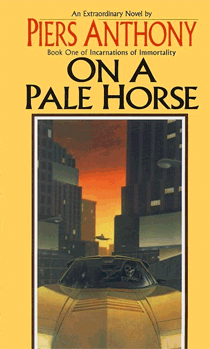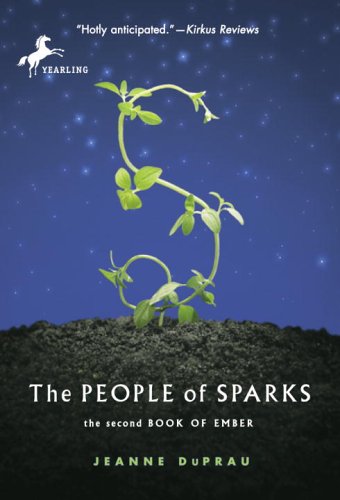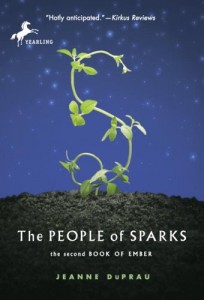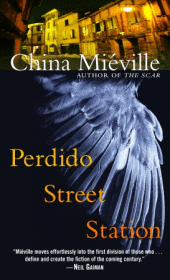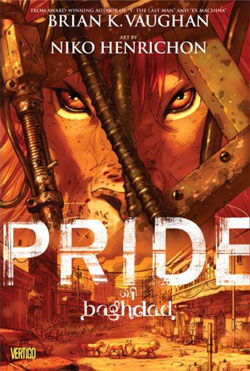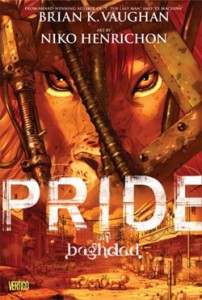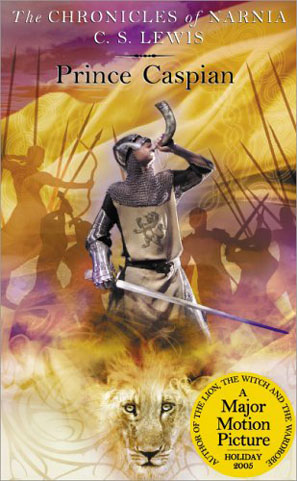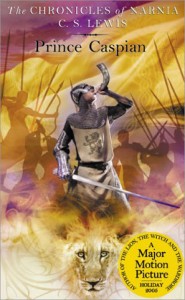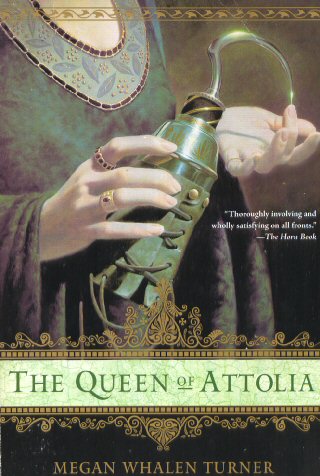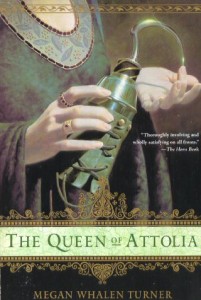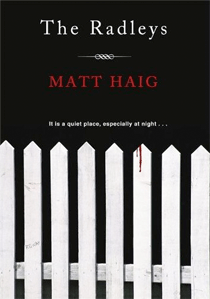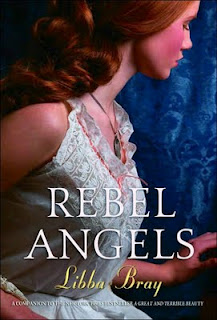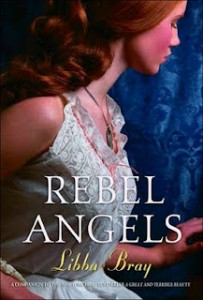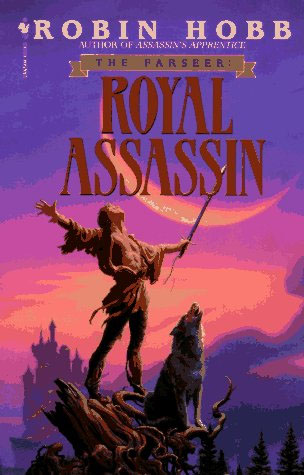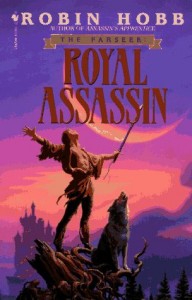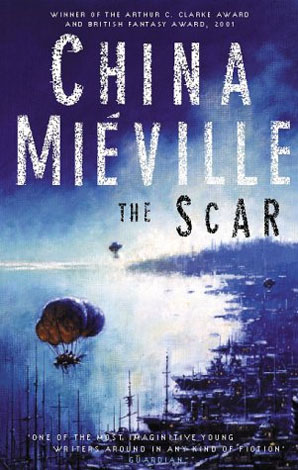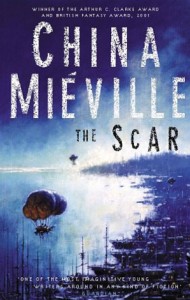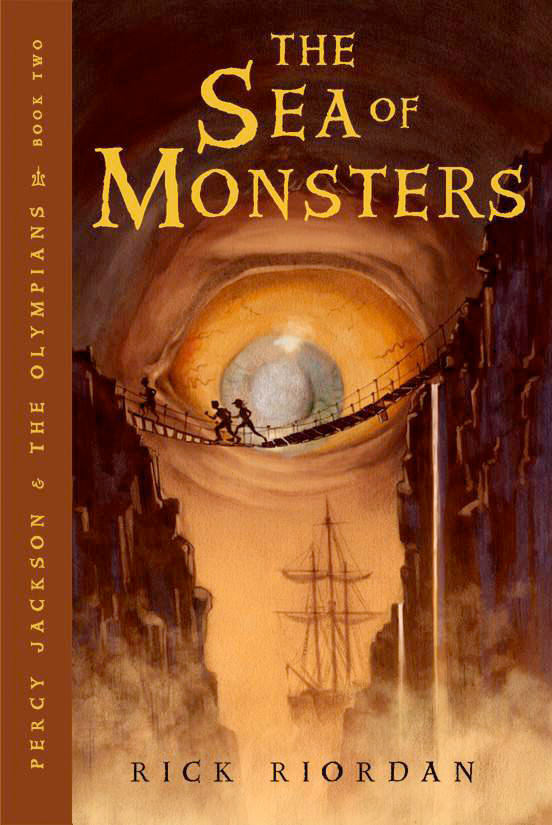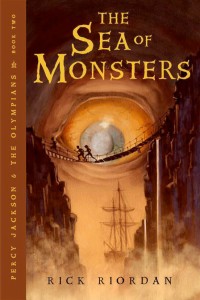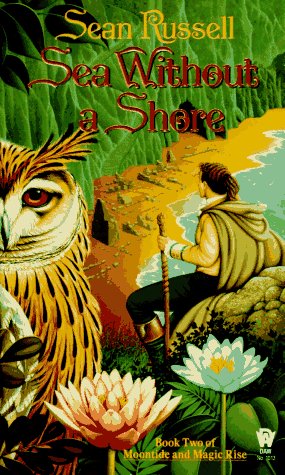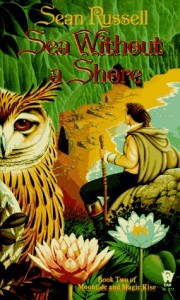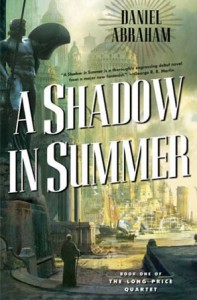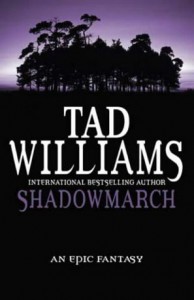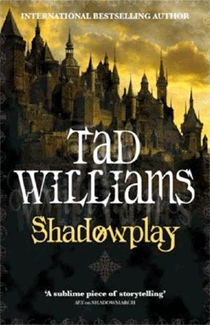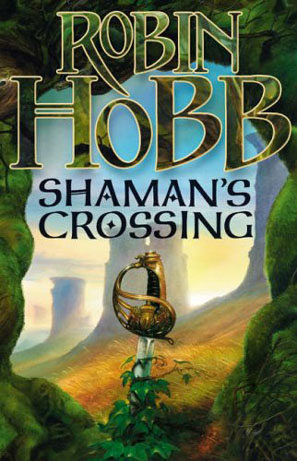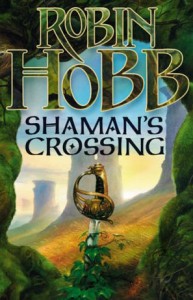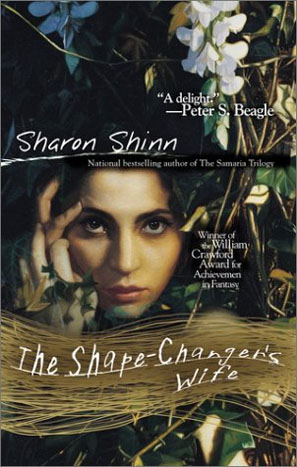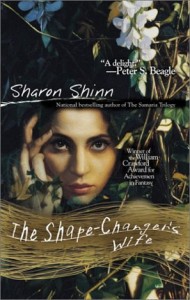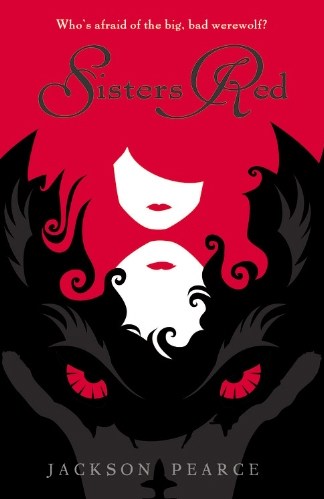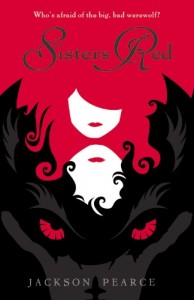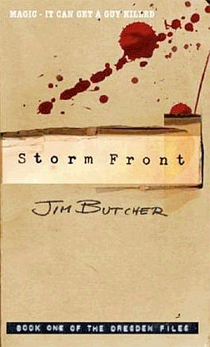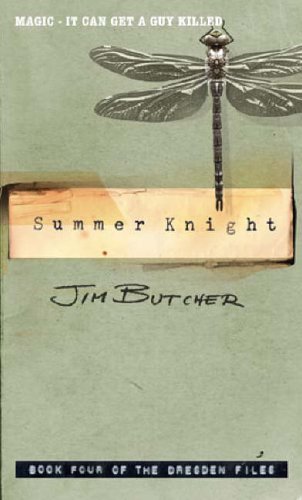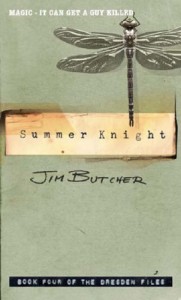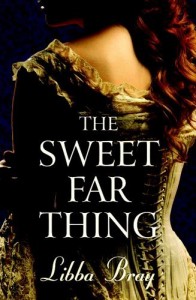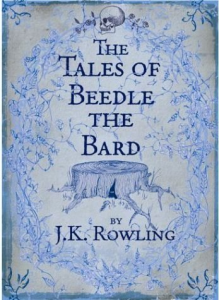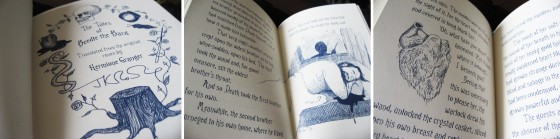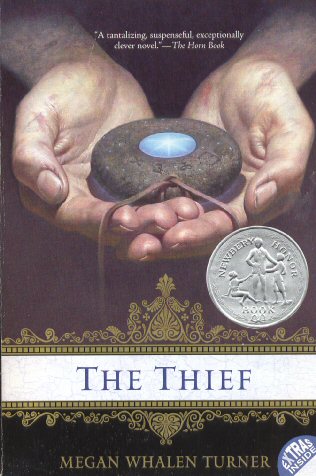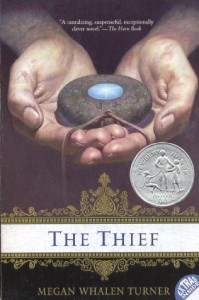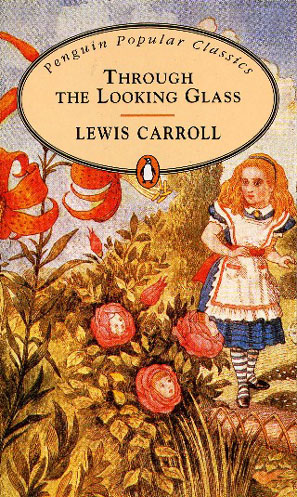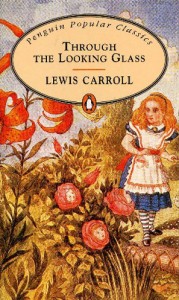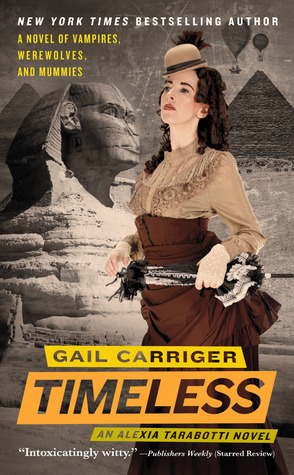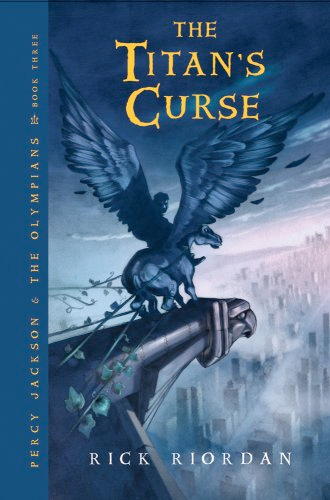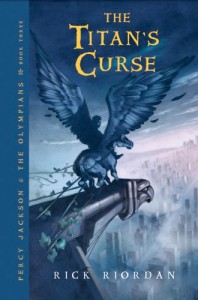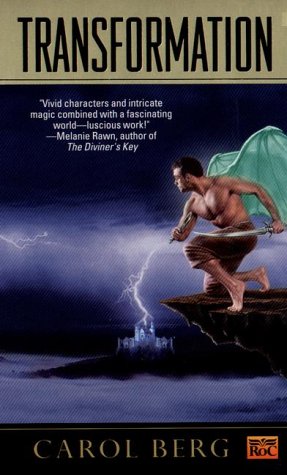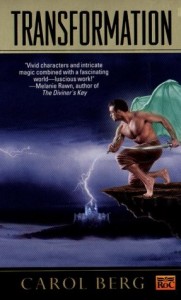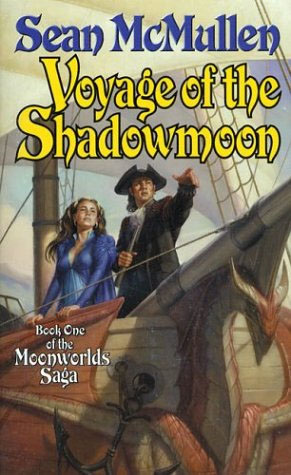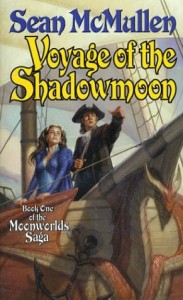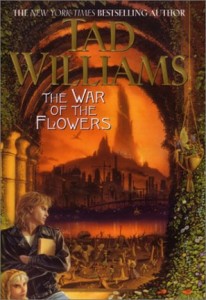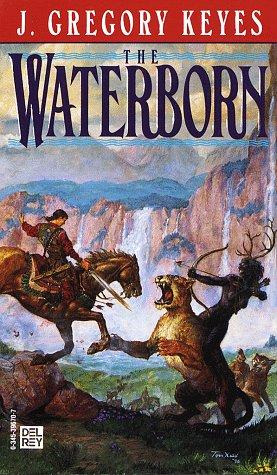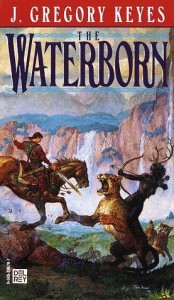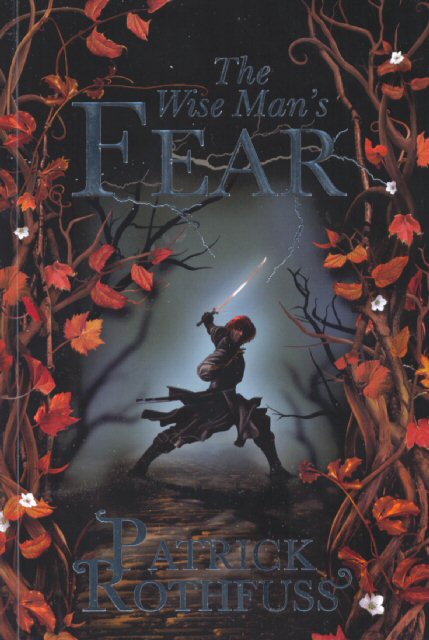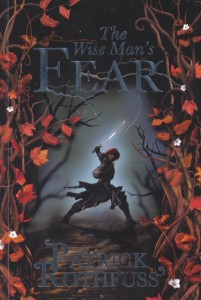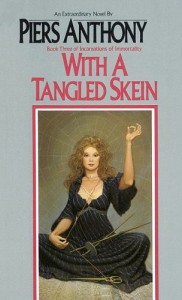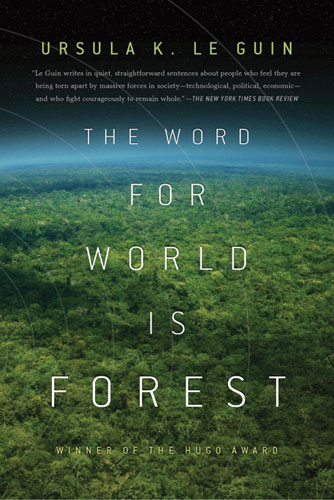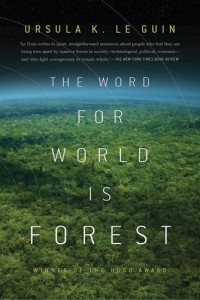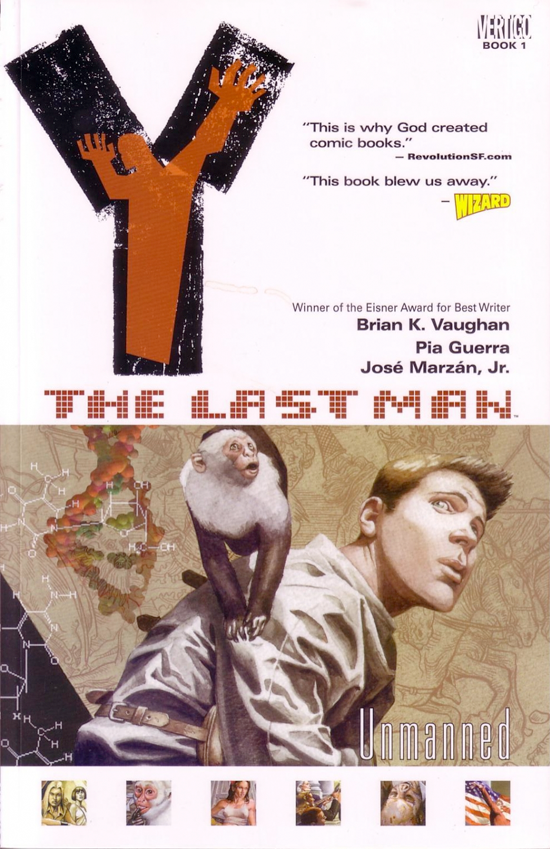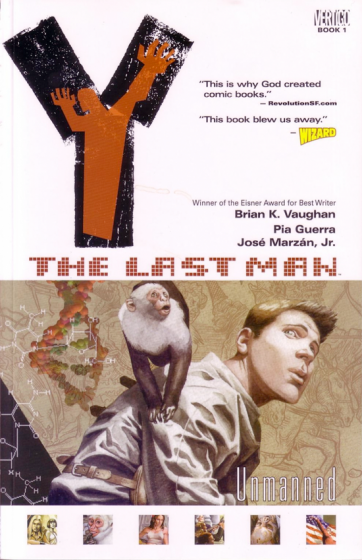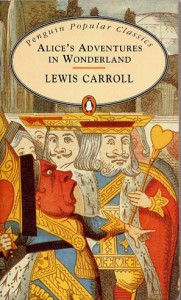 Der kleinen Alice ist zum Einschlafen langweilig. Da läuft plötzlich ein weißes Kaninchen vorüber, das auf seine Taschenuhr schaut und sein Zu-Spät-Kommen laut bedauert. So etwas hat Alice noch nie gesehen, daher folgt sie ihm und fällt lange Zeit durch ein Kaninchenloch an Regalen mit Marmeladengläsern (leider leer) vorbei. Auf der anderen Seite angekommen, stellt sich alles als höchst sonderbar heraus; nicht nur die Leute, auch Alice’s Körper und Gedächtnis (Ist sie überhaupt noch Alice?) verhalten sich nicht so, wie man es von ihnen erwarten sollte.
Der kleinen Alice ist zum Einschlafen langweilig. Da läuft plötzlich ein weißes Kaninchen vorüber, das auf seine Taschenuhr schaut und sein Zu-Spät-Kommen laut bedauert. So etwas hat Alice noch nie gesehen, daher folgt sie ihm und fällt lange Zeit durch ein Kaninchenloch an Regalen mit Marmeladengläsern (leider leer) vorbei. Auf der anderen Seite angekommen, stellt sich alles als höchst sonderbar heraus; nicht nur die Leute, auch Alice’s Körper und Gedächtnis (Ist sie überhaupt noch Alice?) verhalten sich nicht so, wie man es von ihnen erwarten sollte.
-Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank, and of having nothing to do: once or twice she had peeped into the book her sister was reading, but it had no pictures or conversations in it, ‘and what is the use of a book,’ thought Alice, ‘without pictures or conversation?’-
Down the Rabbit-Hole
Wahrhaftig, Alice landet im Wunderland, einer unmöglichen Version des idyllischen Englands des 19. Jahrhunderts. Klare Strukturen sind kaum erkennbar – d.h. nur dann, wenn Alice sie einfordert. Alles kann sich von Moment zu Moment kraß verändern, aber schon die Grundlagen sind reichlich grotesk. Der Glanz aber sind die außerordentlich bizarren Figuren.
Alice ist gut getroffen; sie ist ein kleines Mädchen, das gerade erst zur Schule geht. Mit Längen- und Breitengeraden kann sie nur wenig anfangen – es sind aber schwierige Worte, die der Situation sicherlich angemessen sind. Stolz darauf ein so wichtiges Wort wie “Juror” zu kennen, wiederholt sie es auch ein paar mal. Mühsam hat sie die Regeln der Höflichkeit erlernt (zumindest recht passabel) und nun reagiert sie mit der für Kinder typischen peniblen Korrektheit bei frisch Gelerntem. Einiges erschrickt die Kleine, doch da sie nicht das gesamte Ausmaß der Absonderlichkeiten überblicken kann, bleibt sie viel ruhiger, als ein Erwachsener dieses könnte. Als die Situation für das riesenhaft angewachsene Mädchen zu erdrückend ist, weint sie, nur um kurz darauf ins Zwergische zu schrumpfen und im See ihrer Tränen vom Ertrinken bedroht zu werden.
Die meisten anderen Figuren sind in irgendeiner Art Herausforderungen für Alice, die mit der Logik eines Kindes an die Sache heran geht. Doch niemand meint es böse mit ihr. Es ist ein Panoptikum von Kuriositäten, das ihr den Weg weißt: eine Wasserpfeife rauchende Raupe, die nichts für gegeben hält; die bekannte grinsende Cheshire Cat, die Alice freimütig Auskunft gibt; die verrückte Teegesellschaft – March Hare, Mad Hatter und the sleeping Dormouse – für die es immer tea-time ist, nachdem Zeit (ein er) befürchten muß, vom Hutmacher getötet zu werden; die Königin (eigentlich die Spielkarte “Herzdame”), die auf jedes Problem gleich reagiert: “Kopf-AB!”, neben unzähligen weiteren grotesken Gestalten.
Magie in Form von Zaubersprüchen oder magischen Artefakten gibt es nicht – es ist die Absurdität, die mit normalem Verstand unverständlichen Regeln der Welt, welche die Magie ausmachen.
In der Geschichte relativiert der Autor (und Dozent für Mathematik) Wahrnehmungsweisen und “Zeit” & “Raum”- Verständnis radikal. Mit diesen Unverständlichkeiten muß Alice umgehen, ihr Körper, Geist und ihre Umwelt stellen sie von Episode zu Episode vor neue Rätsel. Es dauert eine Weile, bis Alice beginnt, die vertrackte Logik zu durchschauen und ein wenig Kontrolle zurückzugewinnen. Ein festes Moralverständnis und Selbstvertrauen gehören zwar dazu, aber Lewis will mit dieser Geschichte nicht missionieren.
Humor entsteht in der Geschichte durch die ins absurde geführten Konventionen der englischen Gesellschaft des 19. Jhd., die Wortspiele und den daraus entstehenden Verwechslungen. “Then you should say, what you mean,” [said the March Hare]. “I do,” Alice hastily replied; “at least – at least I mean what I say – that’s the same thing, you know.” “Not the same thing a bit!” said the Hatter. “You might just as well say that ‘I see what I eat’ is the same thing as ‘I eat what I see’!” – Sprachphilosophisch nicht uninteressant.
Sprachlich ist das Werk ebenfalls eine Meisterleistung, doch die Sätze und das Vokabular sind nicht sprachgewaltätig, sondern fließen leicht und elegant dahin, man kann sich den flinken Wendungen kaum entziehen. Wer kann, sollte Alice im Original lesen; auch wenn es eine hervorragende Übersetzung von Christian Enzensberger gibt, so ist dieser perfekte Umgang mit der englischen Sprache einfach nicht ohne zu große Verluste ins Deutsche zu übersetzten.