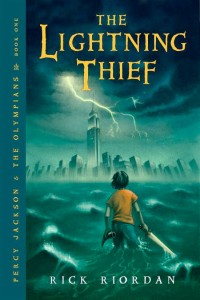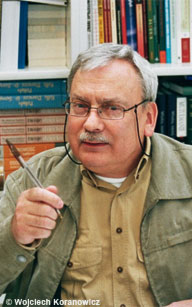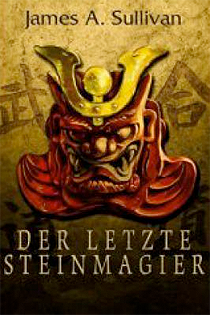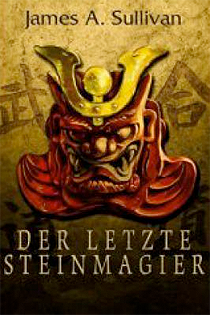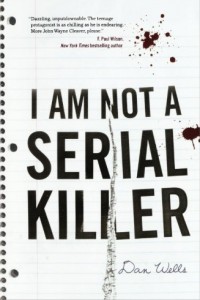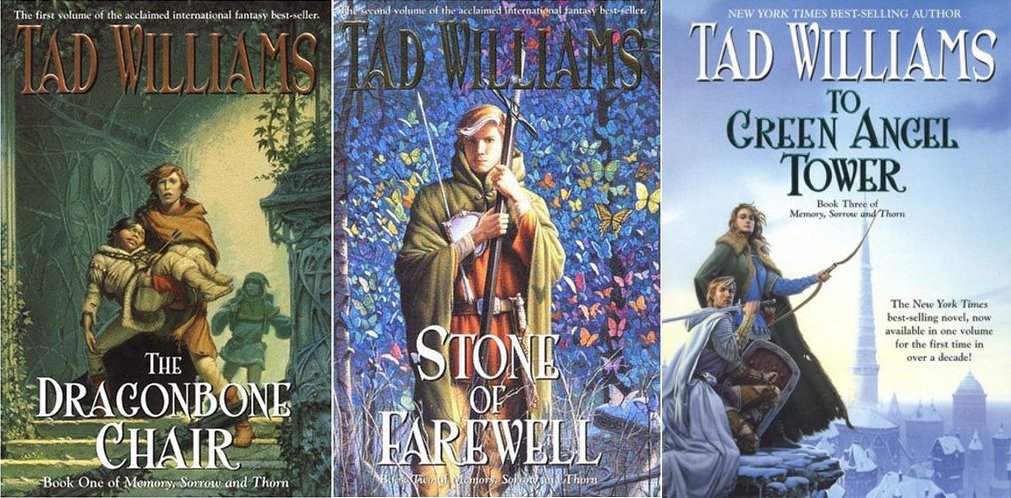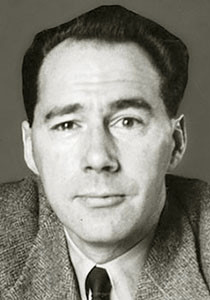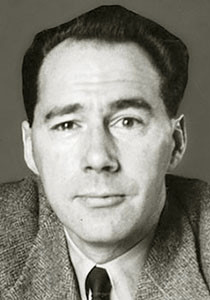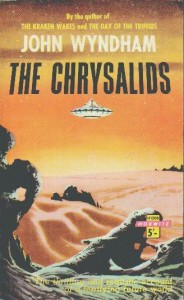Piers Anthony (geb. am 06. August 1934 in Oxford) – mit vollem Namen Piers Anthony Dillingham Jacob – dessen Eltern beide Absolventen der University of Oxford waren, ist bekannt als Autor von Fantasy- und Science-Fiction-Romanen.
Piers Anthony (geb. am 06. August 1934 in Oxford) – mit vollem Namen Piers Anthony Dillingham Jacob – dessen Eltern beide Absolventen der University of Oxford waren, ist bekannt als Autor von Fantasy- und Science-Fiction-Romanen.
Als gebürtiger Brite verließ er im Alter von vier Jahren mit seiner Familie das heimatliche Oxford, um in Spanien zu leben, wo sich seine Eltern während des spanischen Bürgerkriegs für hungernde Kinder einsetzten. Zwei Jahre später – 1940 – flüchtete die Familie jedoch vor Bürgerkrieg und Franco-Regime in die USA, wo Piers Anthony seine restliche Kindheit verbrachte und nur mäßige schulische Erfolge feierte. Weder in England noch in Spanien eine Heimat zu finden, hatte den jungen Piers nach eigener Aussage stark beeinflusst und zerrüttet, so dass er die 1. Klasse zweimal wiederholen musste, ehe er lesen und schreiben konnte. Auch körperlich blieb er bis zum College recht klein und dünn.
Auf dem College lernte Piers Anthony seine zukünftige Frau Carol Ann Marbel kennen, die er 1956 heiratete. Im selben Jahr machte er außerdem seinen College-Abschluss am Goddard College in Vermont. Während seines Kriegsdienstes in der U.S. Army erlangte er 1958 die amerikanische Staatsbürgerschaft und ließ sich anschließend mit seiner Frau in Florida nieder, wo er Vater zweier Töchter (Penny, *1967; ✝ 2009 und Cheryl, *1970)) wurde und bis heute lebt.
Vor seiner Karriere als erfolgreicher Schriftsteller übte Piers Anthony viele verschiedene Jobs aus, um die Familie zu versorgen. So schrieb er Gebrauchsanweisungen für eine Firma für Elektrogeräte und war Hilfsarbeiter in einer psychiatrischen Klinik. Sein Traum war es jedoch, Geschichten zu schreiben. 1962 erklärte sich seine Frau zu der Abmachung bereit, für ein Jahr arbeiten zu gehen, damit ihr Mann versuchen konnte, sich als Schriftsteller zu etablieren. Sollte er in diesem Jahr keinen Durchbruch erzielen, würde er wieder in seine Rolle als Versorger der Familie zurückkehren. Piers Anthony verdiente in diesem Jahr nur lausige 160 Dollar mit Kurzgeschichten und suchte sich nach Ablauf des Jahres eine Anstellung als Englischlehrer. Seine nächste Chance erhielt er 1966, und diesmal schaffte er es, mit seinen ersten Romanen genügend Geld zu verdienen, um den Lebensunterhalt davon zu bestreiten. Er kündigte seinen Job als Lehrer und verkürzte auch seinen Namen.
Bis heute macht er deutlich, dass er seine schriftstellerische Karriere auch der Unterstützung seiner Frau verdankt, und rät neuen Autoren, sich in der Anfangszeit nicht nur auf das Schreiben allein zu verlassen, sondern auch nebenberufliche Einnahmequellen zu nutzen.
 Sein eigentlicher Durchbruch gelang Piers Anthony 1977 mit A Spell for Chameleon (Chamäleon-Zauber), seinem ersten Roman aus der Buchreihe Xanth, mit dem er auch im selben Jahr den British Fantasy Award gewann. Noch heute schreibt er an dieser Buchreihe, die aus bisher 34 veröffentlichten Romanen besteht und Anthonys umfangreichstes Werk darstellt.
Sein eigentlicher Durchbruch gelang Piers Anthony 1977 mit A Spell for Chameleon (Chamäleon-Zauber), seinem ersten Roman aus der Buchreihe Xanth, mit dem er auch im selben Jahr den British Fantasy Award gewann. Noch heute schreibt er an dieser Buchreihe, die aus bisher 34 veröffentlichten Romanen besteht und Anthonys umfangreichstes Werk darstellt.
Xanth ist ein Land, in dem Magie als ein Rohstoff betrachtet und wie selbstverständlich hingenommen wird. Hier leben nur Menschen, die mit einem magischen Talent geboren werden, oder Wesen, die selbst magisch sind wie Sträucher, Einhörner, Drachen etc. Jedes Talent ist einmalig und wiederholt sich nicht, und diejenigen mit den mächtigsten Talenten werden in den Rang eines Magiers erhoben und sind berechtigt, zum König von Xanth gewählt zu werden. Menschen ohne magisches Talent werden mit Eintritt ins Erwachsenenalter nach Mundania verbannt, wo es weder Magie noch magische Wesen gibt – für die Bewohner Xanths der Inbegriff alles Schrecklichen.
Den Reiz der Serie machte Anfangs der liebenswert-naive Stil, der mit vielen Kalauern gespickt war, aus. Doch irgendwann nutzt sich auch der beste Gag ab, und der Erfolg der Xanth-Bücher nahm in Deutschland stark ab, so dass die Übersetzung nach Band 22 eingestellt wurde.
Neben Xanth schrieb Anthony noch zahlreiche weitere Buchreihen, darunter z.B. Battle Circle, Apprentice Adept oder Incarnations of Immortality. Auch eine stattliche Anzahl Einzelromane entsprangen seiner Feder. In beiden Bereichen gewann er verschiedene Auszeichnungen und war mit seinen Büchern mehrmals auf der New York Times Bestseller List vertreten.
Viele seiner populäreren Buchreihen wurden als Filmvorlagen in Betracht gezogen, Xanth wurde Vorlage eines Videospiels (Companios of Xanth von Legend Entertainment) und eines Brettspiels (Xanth von Mayfair Games).
Typisch für Piers Anthonys Bücher ist die Vermischung von realer und phantastischer Realität. Oft sind seine Romane dadurch in der Science Fantasy einzuordnen. Selbst in seinen sehr stark phantastisch geprägten Romanen findet der Leser stets eine thematisch allzu reale Seite. Hier widmet sich der Autor schwierigen Themen wie z.B. dem Suizid oder der Sterbehilfe, wodurch seine Bücher nicht nur reine Unterhaltungskost darstellen, sondern auch ein Auseinandersetzen mit moralisch-ethischen Problemen erfordern. Anthonys Umgang damit ist jedoch nicht in allen Fällen unumstritten: So vertritt er eine verharmlosende Haltung zur Pädophilie und ist dafür zu Recht gerade in den letzten Jahren immer wieder kritisiert worden.
Für gewöhnlich enden Anthonys Bücher mit einem persönlichen Nachwort des Autors, welches nicht selten den Umfang eines ganzen Kapitels einnimmt. Darin schildert er seine Kommunikation mit Lesern oder erklärt, welche realen Einflüsse und Ereignisse ihn dazu bewogen haben, bestimmte Abschnitte des Buches zu schreiben. Der Kontakt zu seinen Lesern war Piers Anthony stets ein Anliegen, und der Stil seiner Nachworte gewährt den Lesern auch einen kleinen Einblick in das Leben des Autors.
Über seine eigene schriftstellerische Tätigkeit hinaus engagiert sich Piers Anthony auch für die Zunft des Schreibens. So unterhält er eine Website zur Förderung und Unterstützung angehender Autoren. 2003 erhielt er hierfür den Friend of EPIC Award und eine Auszeichnung von Preditors and Editors.
Bei Xlibris beteiligte er sich als Privatinvestor und ist heute, zusammen mit Random House, Teilhaber des Unternehmens.
Im Laufe der Jahre hat Piers Anthony mehrmals den Verlag gewechselt und seine Buchreihen mitgenommen, wenn der Verlag ihn zeitlich zu sehr unter Druck zu setzen versuchte. Da die Verlage mit diesem Vorgehen und dem Verlust eines Autors, der sich mehr als gut verkaufte, nicht ohne weiteres einverstanden waren, kam es häufig auch zu Klagen, in denen man Anthony Vertragsverletzung vorwarf. Viele dieser Klagen fielen zugunsten Anthonys aus. Auch das ist ein Zeichen für den immensen Erfolg dieses Autors, denn nicht jeder Schreiberling wäre in der Position, sich derart gegen seinen Verlag durchzusetzen und weiterhin neue Verleger zu finden.
Piers Anthony hat bis heute mehr als 140 Romane geschrieben und ist stolz darauf, zu jedem Buchstaben des Alphabets mindestens einen Roman veröffentlicht zu haben.
________________________________________________________________
Bibliographie:
Aton/Worlds of Chthon
1967: Chthon – Chthon/ Der Planet der Verdammten
1975: Phthor – Der Höhlenplanet
Battle Circle (Titanen-Trilogie)
1968: Sos the Rope – Das Erbe der Titanen
1972: Var the Stick – Die Kinder der Titanen
1975: Neq the Sword – Der Sturz der Titanen
1978: Battle Circle – Zeit der Kämpfer (Sammelband)
Of Man and Manta (Manta-Trilogie)
1968: Omnivore – Die Macht der Mantas/ Omnivor
1970: Orn – Orn
1976: 0X – OX
Jason Stryker – mit Robert Fuentes
1974: Kiail
1974: Mistress of Death
1974: Bamboo Bloodbath
1975: Ninja’s Revenge
1976: Amazon Slaughter
1976: Curse of the Ninja
Xanth
1977: A Spell for Chameleon – Chamäleon-Zauber
1979: The Source of Magic – Zauber-Suche
1979: Castle Roogna – Zauber-Schloß
1982: Centaur Aisle – Zentauren-Fahrt
1982: Ogre, Ogre – Elfen-Jagd
1983: Night Mare – Nacht-Mähre
1983: Dragon on a Pedestal – Drachen-Mädchen
1984: Crewel Lye – Ritter-Geist
1986: Golem in the Gears – Turm-Fräulein
1987: Vale of the Vole – Helden-Maus
1988: Heaven Cent – Himmels-Taler
1989: Man from Mundania – Welten-Reise
1990: Isle of View – Mond-Elfe
1991: Question Quest – Höllen-Mädchen
1992: The Color of Her Panties – Meeres-Braut
1992: Demons Don’t Dream – Dämonen-Spiele
1993: Harpy Thyme – Harpien-Träume
1994: Geis of the Gargoyle – Wasser-Speier
1995: Roc and a Hard Place – Vogel-Scheuche
1996: Yon Ill Wind – Wechsel-Wind
1997: Faun & Games – Wald-Schrat
1998: Zombie Lover – Zombie-Lover
1999: Xone of Contention
2000: The Dastard
2001: Swell Foop
2002: Up In A Heaval
2003: Cube Route
2004: Currant Events
2005: Pet Peeve
2006: Stork Naked
2007: Air Apparent
2008: Two to the Fifth
2009: Jumper Cable
2010: Knot Gneiss
2011: Well-Tempered Clavicle
2012: Luck Of The Draw
2013: Esrever Doom
2013: Board Stiff
2014: FivePoitraits
Cluster
1977: Cluster/ Vicinity Cluster – Flint von Außenwelt
1978: Chaining the Lady – Melodie von Mintaka
1978: Kirlian Quest – Herald der Heiler
1980: Thousandstar – Tausendstern
1982: Viscous Circle
Tarot
1979: God of Tarot – Der Gott von Tarot
1980: Vision of Tarot – Die Visionen von Tarot
1980: Faith of Tarot – Die Hölle von Tarot
1987: Tarot (Sammelband)
Apprentice Adept (Doppelwelt)
1980: Split Infinity – Die Doppelwelt
1981: Blue Adept – Der blaue Adept (2 Teile)
1982: Juxtaposition – Juxtaposition
1987: Out of Phaze – Verbannt auf der Doppelwelt
1988: Robot Adept
1989: Unicorn Point
1990: Phaze Doubt
Incarnations of Immortality (Inkarnation der Unsterblichkeit)
1983: On a Pale Horse – Reiter auf dem schwarzen Pferd
1984: Bearing an Hourglass – Der Sand der Zeit
1985: With a Tangled Skein – Des Schicksals dünner Faden
1986: Wielding a Red Sword – Das Schwert in meiner Hand
1987: Being a Green Mother – Sing ein Lied für Satan
1988: For Love of Evil
1990: And Eternity
2007: Under a Velvet Cloak
Bio of a Space Tyrant (Der Tyrann vom Jupiter)
1983: Refugee – Der Flüchtling
1984: Mercenary – Der Söldner
1985: Politician
1985: Executive
1986: Statesman
2001: The Iron Maiden
The Adventures of Kelvin of Rud – mit Robert E. Margroff
1987: Dragon’s Gold
1988: Serpent’s Silver
1990: Chimaera’s Copper
1990: Orc’s Opal
1992: Mouvar’s Magic
Pornucopia
1989: Pornucopia – Pornutopia
2003: The Magic Fart
Mode
1991: Virtual Mode
1992: Fractal Mode
1993: Chaos Mode
2001: DoOon Mode
Geodyssey
1993: Isle of Woman
1994: Shame of Man
1997: Hope of Earth
1999: Muse of Art
2010: Climate of Change
ChroMagic
2002: Key to Havoc
2003: Key to Chroma
2004: Key to Destiny
2007: Key to Liberty
2008: Key to Survival (2008)
Metal Maiden
2012: To Be A Woman
2012: Shepherd
2012: Flytrap
2012: Awares
Trail Mix
2013: Amoeba
2013: Beetle Juice
Einzelbände
1968: The Ring mit Robert E. Margroff – Der Ring
1969: Macroscope – Makroskop
1969: Hasan – Hassans Reise
1970: The E.S.P. Worm mit Robert E. Margroff
1971: Prostho Plus – Der Retter von Dent-All
1973: Race Against Time
1974: Rings of Ice
1974: Triple Détente
1976: Steppe – Steppe
1976: But What of Earth?
1979: Pretender mit Frances Hall
1981: Mute (die geplante Fortsetzung “Moot” wird nicht erscheinen)
1986: Shade of the Tree – Schatten des Baumes
1986: Ghost
1989: Total Recall – Die totale Erinnerung
1989: Through the Ice mit Robert Kornwise
1990: Firefly
1990: Hard Sell – Die seltsamen Geschäfte des Mr. Fisk
1990: Dead Morn
1991: Balook
1991: MerCycle
1991: Tatham Mound – Tatham Mound
1992: The Caterpillar’s Question mit Philip José Farmer – Die Seelenträumerin
1993: Killobyte
1993: If I Pay Thee Not in Gold mit Mercedes Lackey
1996: Volk
1996: The Willing Spirit mit Alfred Tella
1998: Spider Legs mit Clifford A. Pickover
1998: Quest for the Fallen Star mit James Richey & Alan Riggs
1998: Dream a Little Dream
1999: Realty Check
2000: The Secret of Spring mit Jo Anne Taeusch
2000: The Gutbucket Quest mit Ron Leming
2007: Starkweather: Immortal 0 mit David A. Rodriguez
2007: Tortoise Reform
2011: The Sopaths
2012: A Spell for Chameleon: The Parallel Edition … Simplified
2013: Aliena
2013: Eroma
Kurzgeschichten
1963: Possible To Rue
1963: Quinquepedalian
1964: Sheol (mit H. James Hotaling)
1964: Encounter
1965: Phog
1966: Mandroid (mit Robert E. Margroff und Andrew J. Offutt)
1966: The Message (mit Frances Hall)
1966: The Ghost Galaxies
1967: Within the Cloud
1967: Beak by Beak
1968: The Alien Rulers
1969: The Life of the Stripe
1970: The Whole Truth
1970: The Bridge
1970: Equals Four
1870: Would you?
1970: Small Mouth, Bad Taste
1970: Hearts
1972: In the Barn
1972: Up Schist Crick
1972: Black Baby
1974: KI (mit Roberto Fuentes)
1981: On the Uses of Torture
1982: To the Death
1982: Transmogrification
1982: Deadline
1985: The Toaster
1985: Gone to the Dogs
1985: December Dates
1987: Imp to Nymph
1987: Life
1988: Kylo
1991: Cloister
1992: Love 40
1992: Alien Plot
1992: Nonent
1992: 20 Years
1992: Ship of Mustard
1992: E van S
1992: Revise and Invent
1992: Baby
1993: A Picture of Jesus
1994: Tortoise Shell
1995: Bluebeard
2008: The Courting
2011: Lost Things
2012: Living Doll
2013: Pandora Park
2014: Odd Exam












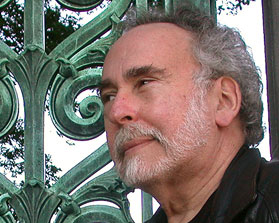
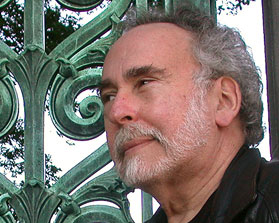
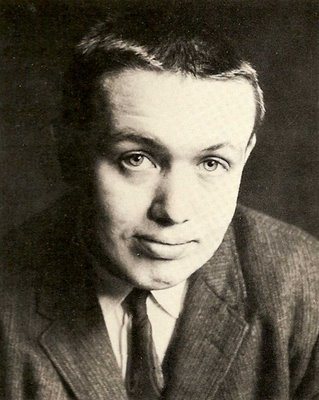





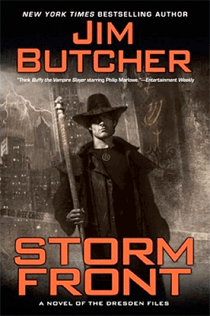
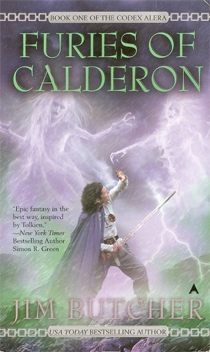

















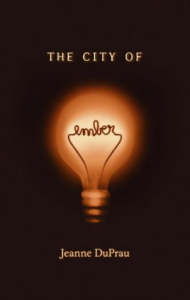


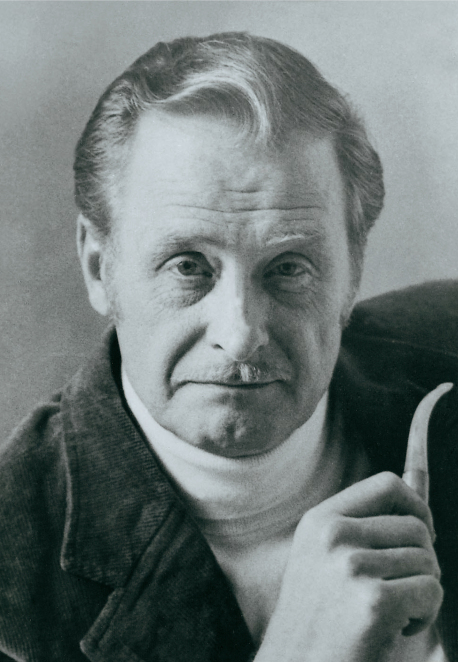

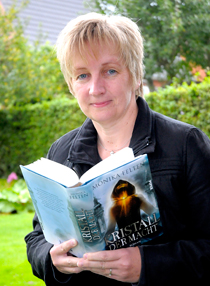
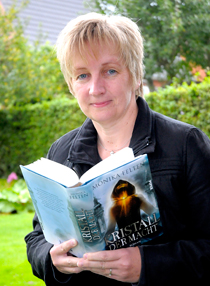

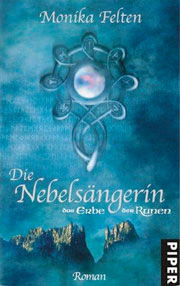
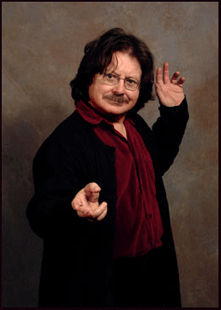





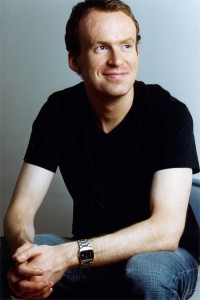


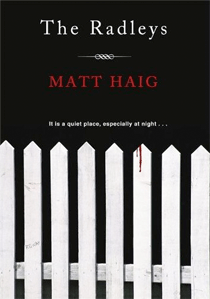








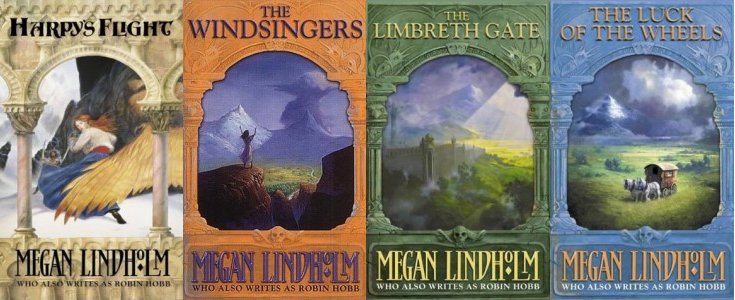





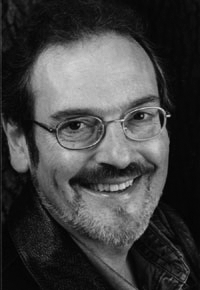
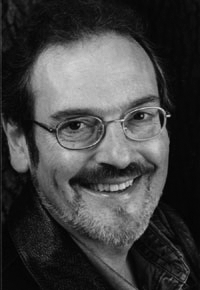
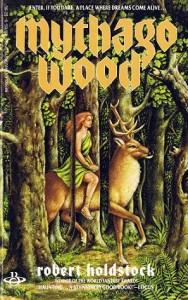











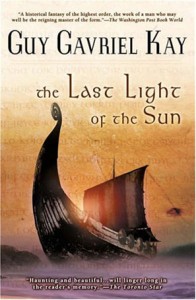





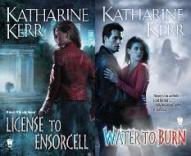
















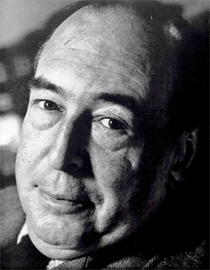
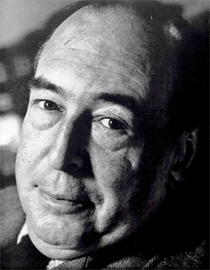











 wie für die damit zusammenhängende Weltkonzeption, wobei er besonders den genetischen Determinismus angriff, der rassische Stereotypisierung stets zutreffen ließ. Aber auch Tolkiens Auffassung, dass ein Ende stets tröstlich für den Leser sein müsste, hielt (und hält) er für falsch und wendet sich gegen eine eskapistische Konzeption von Fantasy. Später hat Miéville für sich auch positive Aspekte an Tolkiens Werk entdeckt, ohne damit seine kritischen Aussagen zu revidieren, und er fasste diese in der Liste list of some Perhaps In Some Cases Somewhat Insufficiently Stressed Reasons We Should All Be Terribly Grateful To Tolkien (der entsprechende Blogeintrag heißt:
wie für die damit zusammenhängende Weltkonzeption, wobei er besonders den genetischen Determinismus angriff, der rassische Stereotypisierung stets zutreffen ließ. Aber auch Tolkiens Auffassung, dass ein Ende stets tröstlich für den Leser sein müsste, hielt (und hält) er für falsch und wendet sich gegen eine eskapistische Konzeption von Fantasy. Später hat Miéville für sich auch positive Aspekte an Tolkiens Werk entdeckt, ohne damit seine kritischen Aussagen zu revidieren, und er fasste diese in der Liste list of some Perhaps In Some Cases Somewhat Insufficiently Stressed Reasons We Should All Be Terribly Grateful To Tolkien (der entsprechende Blogeintrag heißt: