Mit Dragon Kiss und den Nachfolgebänden Dragon Dream, Dragon Touch und Dragon Fire hat die Autorin G.A. Aiken (“… verbringt die meiste Zeit mit Schreiben und dem Versuch, ihren Hund daran zu hindern, sich von der Leine loszureißen.”), nicht nur die Qualitäten des Drachenliebhabers für uns erschlossen, sondern auch aufgezeigt, welche literarischen Dimensionen sich durch den phantastischen Einschlag in einer nur scheinbar simplen Liebesgeschichte eröffnen. Aus der Inhaltsangabe:
Eigentlich ist die Kriegerin Annwyl zäh und widerspenstig. Bis sie dem Drachen Fearghus über den Weg läuft und zu Wachs in seinen Klauen wird. Denn er ist groß, gut aussehend – und absolut tödlich. Und er hat bisher noch nie Widerworte bekommen …
Wir freuen uns, eine renommierte Expertenrunde begrüßen zu dürfen, die Aikens Werk für uns unter die Lupe nimmt: Mag.erl, Dr. gastropodicus Fremdling, MU (Master of the Universe), MWA (Master of Wobbling Antennae), Frau Dr. phil. brüll. Colophonius Stilblüt-Schnatterheimer, Dr. botanicus Bohn, Magistra des losen Mundwerks, Dr. Ulfilas Sans-Merci und als Gastgeberin Dr. rer. sterc. Scarabäus, Hohebibliothekarin des literarischen Misthaufens.
Dr. rer. sterc. Scarabäus: Der Drache als Objekt der Begierde ist ein Gesichtspunkt, der bei der bisherigen Abhandlung der Konstellation Drache-Jungfrau stets vernachlässigt worden ist. Inspiriert von allerhand glitzernden, haarig-mondsüchtigen und sonstigen paranormalen Liebhabern wird der subtilen Symbolik des Drachen nun dieser innovative Ansatz abgewonnen und eine Leerstelle behoben, die uns allen schon immer sauer aufstieß, oder nicht?
Mag.erl, Dr. gastr. Fremdling, MU, MWA: Es geht einem ja oft so, dass einem manche Dinge erst fehlen, nachdem man sie einmal gehabt hat. Nachdem ich also nun in den Genuss dieser Perspektive gekommen bin, kann ich sagen: Dieses Buch hat mir Momente verschafft, die ich wohl nie wieder vergessen (können) werde.
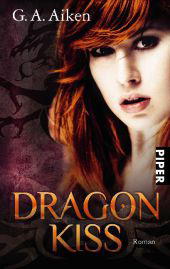 Dr. rer. sterc. Scarabäus: Widmen wir uns zunächst dem geschickt gewählten Beginn in medias res (s. Leseprobe). Gleich mit einer Situation auf Messers Schneide einzusteigen, alle Achtung. Der sich entrollende Schwanz schon im zweiten Absatz kündigt Großes an – und dann: zerreißende Organe, strömendes Blut, lächelnde Soldaten. Spannung und Action pur, mit diesem gewissen poetischen Etwas. Lesen Sie selbst: Der Stahl sirrte durch die Luft, hieb durch den Mann hindurch und trennte ihm den Kopf vom Hals. (S. 11). Ist das nicht der Inbegriff einer gelungenen Kampfszene?
Dr. rer. sterc. Scarabäus: Widmen wir uns zunächst dem geschickt gewählten Beginn in medias res (s. Leseprobe). Gleich mit einer Situation auf Messers Schneide einzusteigen, alle Achtung. Der sich entrollende Schwanz schon im zweiten Absatz kündigt Großes an – und dann: zerreißende Organe, strömendes Blut, lächelnde Soldaten. Spannung und Action pur, mit diesem gewissen poetischen Etwas. Lesen Sie selbst: Der Stahl sirrte durch die Luft, hieb durch den Mann hindurch und trennte ihm den Kopf vom Hals. (S. 11). Ist das nicht der Inbegriff einer gelungenen Kampfszene?
Frau Dr. phil. brüll. Colophonius Stilblüt-Schnatterheimer: Ich finde es äußerst bemerkenswert, wie das geschildert wird. Dieses kurze Innehalten, Augenschließen, kurz bevor man (eh nicht) getötet wird, kennt das nicht jeder von uns? Und dann dieser ungemein findige Trick, zuzuschlagen, wenn der Gegner seine Deckung preisgibt. Dass es dazu noch Tipps von Papa braucht, ist irgendwie bedauerlich …
Dr. bot. Bohn: Es ist aber nicht die kriegerische Finesse unserer Heldin, die den Kampf entscheidet, sondern das unerwartete Eingreifen von Fearghus, dem gelangweilten Drachen von nebenan. Was sagen Sie zur Charakterisierung dieses Drachen?
Dr. rer. sterc. Scarabäus: Die eloquente Vorstellung des Drachen mit den Worten “Aye. […] Mein Name ist Fearghus.” (S. 16) lässt auf einen gemeinen Highlander-Drachen schließen. Schuppen sind der neue Kilt.
Frau Dr. phil. brüll. Colophonius Stilblüt-Schnatterheimer: Wenn es ein schottischer Highlander-Drache ist, was trägt er dann unter den Schuppen?!
Dr. bot. Bohn: Wie die ausgesprochen subtilen Andeutungen in Sachen drachischer Schwanzlänge nahelegen, kann er unter den Schuppen eigentlich nur eines verbergen: Seine herausragenden inneren Werte!
Mag.erl, Dr. gastr. Fremdling, MU, MWA: Darf ich die Aufmerksamkeit in diesem Zusammenhang auf dieses Satzfragment lenken: “Wie seine Stimme, wenn er sprach.” (S. 18) Wie hört sich seine Stimme an, wenn er nicht spricht? Hören sich unser aller Stimmen vielleicht besser an, wenn wir nicht sprechen? Können wir das von diesem Drachen lernen?
Dr. rer. sterc. Scarabäus: Was die Betonung innerer Werte angeht, sollten wir definitiv von den Drachen lernen, denn sie kennen nicht nur die Wirkung der inneren Stimme: In Dragon Touch
“Dagmar ist eine kleine Frau mit praktischer Kleidung und stahlgrauen Augen hinter einer strengen Brille. Ein Eisklotz in Menschengestalt, der sich ob der Reize von Gwenvael dem Schönen völlig unbeeindruckt zeigt. Doch Gwenvael setzt ihrer Zurückhaltung sein ganz eigenes Feuer entgegen.” – aus der Inhaltsangabe
kommt es ganz offensichtlich auf innere Werte an, die mit “praktischer Kleidung” (kein Cape!) und “strenger Brille” geschickt in Szene gesetzt werden. Was ist vom weiblichen Klotz als Gegenpart des geschmeidigen Schöndrachen zu halten?
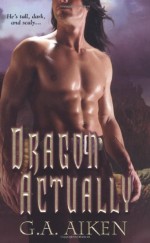 Frau Dr. phil. brüll. Colophonius Stilblüt-Schnatterheimer: Zu diesem Thema empfehle ich mein Buch Klotz im Wandel der Zeiten. Neben Dagmar sind auch weitere Klötze berühmt geworden, unter ihnen besonders Räuber Hotzenklotz sowie Klotz der Quadratische, der Vorbild für die Legosteine wurde. Doch die Kälte der Eisklötzin Dagmar sucht ihresgleichen. Nicht einmal der Eisklotz, der die Titanic zum Sinken brachte, war kälter als sie.
Frau Dr. phil. brüll. Colophonius Stilblüt-Schnatterheimer: Zu diesem Thema empfehle ich mein Buch Klotz im Wandel der Zeiten. Neben Dagmar sind auch weitere Klötze berühmt geworden, unter ihnen besonders Räuber Hotzenklotz sowie Klotz der Quadratische, der Vorbild für die Legosteine wurde. Doch die Kälte der Eisklötzin Dagmar sucht ihresgleichen. Nicht einmal der Eisklotz, der die Titanic zum Sinken brachte, war kälter als sie.
Aber ich schweife ab …
Dr. Ulfilas Sans-Merci: Apropos “Klotz”: Klotzt die Autorin in ihren Romanen nicht mit pseudo-emanzipierten Frauenfiguren, die all ihre Unabhängigkeit und Stärke verlieren, sobald heißer Drachenatem über sie hinwegfegt?
Mag.erl, Dr. gastr. Fremdling, MU, MWA: Ich habe mich gefragt, ob wir es hier nicht mit einer der subversivsten Dekonstruktionen von Geschlechterrollen zu tun haben! Die toughe Kriegerin, die unbewusst nur auf den geeigneten Mann zum Sich-Hingeben wartet, greift viel zu kurz. Betrachten wir unsere Protagonisten einmal genauer:
Wir haben einen männlichen Drachen, der jedoch in seiner häuslichen Rolle keineswegs einen Übermann darstellt, sondern vielmehr eine subtile Anspielung auf das Klischee des “Hausdrachen”, also der ebenso eifer- wie keifsüchtigen Ehefrau. Ersteres drückt sich im Verjagen der männlichen Krieger aus, letzteres durch seine Fähigkeit des Feuerspuckens. Fearghus ist außerdem eine nur von Eingeweihten zu entschlüsselnde Anspielung auf Xanthippe, dem Archetyp des “Hausdrachen”.
Annwyl wiederum ist, obwohl eigentlich eine Frau, so überaus männlich konnotiert, dass sie sofort die stereotype Rolle im Höhlenhaushalt einnimmt – herumliegen und sich bedienen lassen. Zuvor hat sie im Kampf ihre männlichen Qualitäten unter Beweis gestellt, indem sie angesichts “zerrissener Organe” nicht herumgejammert hat – vgl. den sprichwörtlichen Indianer. Unter ihrem maskulinen Blick verwandelt sich der Hausdrache in ein übersexualisiertes Lustobjekt, dessen Objektstatus besonders durch die Betonung bestimmter Attribute – Hörner, überlanger Schwanz – deutlich wird.
Um es nochmal kurz zusammenzufassen: Der männliche Drache ist eigentlich eine Frau, weshalb sich die weibliche Annwyl, die eigentlich ein Mann ist und damit nach modernen Klischeevorstellungen ständig bereit zu blitzdrachenmäßigen Entladungen, auch so an ihm erregen kann – sie ist damit eigentlich keine “läufige Hündin” (lt. Amazon S. 243), sondern eher ein räudiger Köter – und der subversive Bruch besteht nun darin, dass er (also sie) ihr (also ihm) “sein Zeichen ins Fleisch zu brennen” (lt. Amazon S. 245) vermag, weil das mit den konstruierten Geschlechterstereotypenkonstellationen bricht! Alles klar?
Dr. Ulfilas Sans-Merci: Nein! Denn diese auf die Paarbeziehung verengte Sichtweise lässt den historischen Kontext völlig außer Acht. Angesichts der Tatsache, dass der als Bruder der Heldin erwähnte Lorcan anscheinend schon 1225 heiliggesprochen wurde, sehe ich das Ganze mittlerweile eher als ins Gewand einer Liebesgeschichte gehüllte Metapher auf das Ringen von christlicher und paganer Ethik im mittelalterlichen Irland. Fearghus ist ein Repräsentant der alten heidnischen Ethik, in der der “heroische” Einzelkampf zweier Anführer genügt, um einen Krieg zu beenden.
Dementsprechend haben für ihn auch Beinamen wie “der Zerstörer”, “der Schlächter” oder “die Blutrünstige” eher einen ehrenden Charakter, während Annwyl, unterbewusst beeinflusst durch ihren eindeutig christlichen Bruder, schon eine Umwertung vorgenommen hat und deshalb auch das Ritual des Bades im Blut des erschlagenen Gegners (in Sagen gut belegt, siehe etwa Siegfrieds Bad in Drachenblut) ablehnen muss. Beeinflusst von missionarischer Propaganda verdächtigt sie ihren heidnisch-andersweltlichen Gastgeber, seine Gäste verzehren zu wollen, und ist sich der geheiligten Bedeutung der Gastfreundschaft für tribale Kulturen nicht bewusst – einer Gastfreundschaft, die freilich immer eine Beziehung ist, die auf Gegenleistungen beruht, wie Fearghus durch die Andeutung, dass er einen Gefallen einfordern wird, subtil deutlich macht.
In Bezug auf den anscheinend irisch konnotierten Handlungsort kommt darüber hinaus dem mehrfachen Verweis auf abgeschlagene Köpfe eine nicht zu unterschätzende Bedeutung zu (Thema keltischer Kopfkult): Ein Rückgriff auf alte Traditionen, mithin ein Abschlagen des Kopfes des besiegten Gegners, könnte, wie Fearghus klar erkennt, der pagan-keltischen Lebensweise noch einmal zum Durchbruch verhelfen. Die Tatsache, dass auch Annwyl trotz ihrer Bedenken gegen heroisch-lobende Beinamen instinktiv im Kampf zum altbewährten Mittel der Enthauptung greift, deutet darauf hin, dass sie zwischen den Kulturen hin- und hergerissen ist (wie auch ihre Unsicherheit, was mit ihrer Seele nach dem Tode geschehen wird – ganz offensichtlich ist sie mit mehreren Jenseitsvorstellungen vertraut).
Die den gesamten Text durchziehende Sinnlichkeit ist angesichts all dessen nicht Selbstzweck, sondern vielmehr Ausdruck heidnisch-dionysischer Lebenswirklichkeit, während Bischof Lorcans Versuch, seine Schwester durch männliche Krieger töten zu lassen, als Symbol der asketisch-christlichen Ausmerzung insbesondere weiblicher Körperlichkeit zu werten ist (siehe auch die Vorstellung der Militia Christiana).
Dr. rer. sterc. Scarabäus: Wir danken für Ihre erhellenden Analysen, meine Damen und Herren! Lesen Sie demnächst, wie sich unser literarisches Quintett der Interpretation des “Nacktkriegers” annimmt.

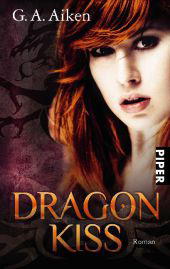
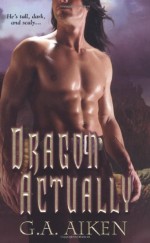
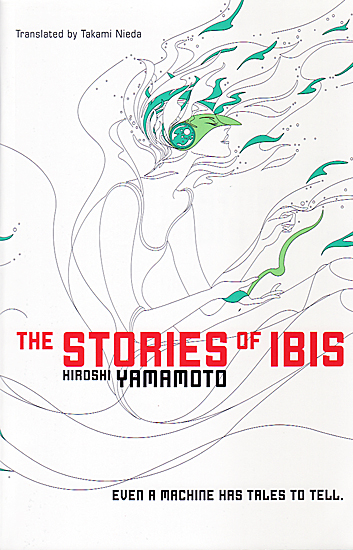
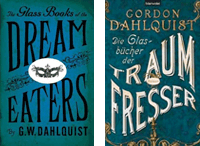

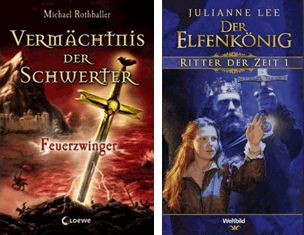
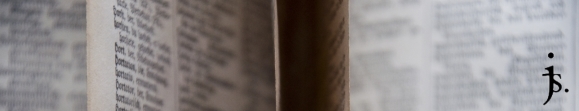
 Regel aufbietet, sind außerdem gewisse Verluste abzusehen. Erst durch ein ambivalentes Ende stellt sich bei vielen klassischen Fantasygeschichten das Gefühl der Vollständigkeit ein.
Regel aufbietet, sind außerdem gewisse Verluste abzusehen. Erst durch ein ambivalentes Ende stellt sich bei vielen klassischen Fantasygeschichten das Gefühl der Vollständigkeit ein.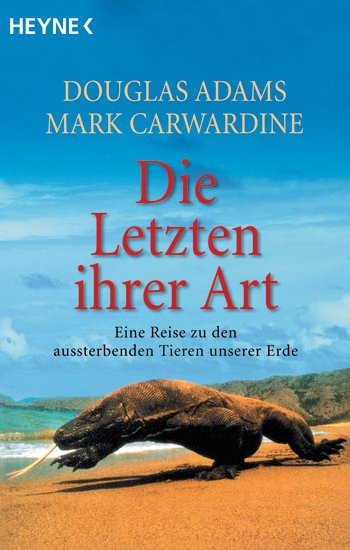
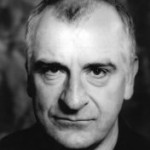
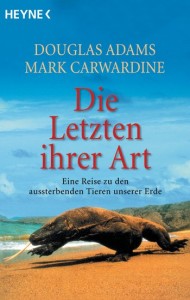

 Das ist ja nun auch kein Malheur, schließlich geht es ja um Fantasy. Die Welten sprühen im Idealfall vor Einfallsreichtum und sind angereichert mit Magie, alternativen Techniksystemen oder phantasievollen Gesellschaftsformen. Und genau da liegt auch der Hase im Pfeffer, denn bei all dem glänzen die Geschlechterbeziehungen oft durch einen gewissen Konservatismus und spiegeln eher antiquierte Vorstellungen wider, anstatt Alternativen zu entwerfen, die gerade in einer phantastischen Welt jede Möglichkeit hätten, sich zu entfalten. Wo, wenn nicht in der Fantasy wäre Platz für das Experimentieren mit kulturell neu codierten Rollenverteilungen?
Das ist ja nun auch kein Malheur, schließlich geht es ja um Fantasy. Die Welten sprühen im Idealfall vor Einfallsreichtum und sind angereichert mit Magie, alternativen Techniksystemen oder phantasievollen Gesellschaftsformen. Und genau da liegt auch der Hase im Pfeffer, denn bei all dem glänzen die Geschlechterbeziehungen oft durch einen gewissen Konservatismus und spiegeln eher antiquierte Vorstellungen wider, anstatt Alternativen zu entwerfen, die gerade in einer phantastischen Welt jede Möglichkeit hätten, sich zu entfalten. Wo, wenn nicht in der Fantasy wäre Platz für das Experimentieren mit kulturell neu codierten Rollenverteilungen? scheinen. Männergeschichten erfüllen sich anders als Frauengeschichten, und spätestens bei einer Liebesgeschichte ist der Bedarf an traditionellen Rollenbildern groß: Der Vampir, Dämon oder Werwolf der aktuellen Paranormal Romance ist nichts anderes als ein Übermann, vor dem auch eine sonst ganz toughe Frau ohne Gesichtsverlust niederknien kann. Offen bleiben muss dabei wohl, ob AutorInnen und LeserInnen bewusst ist, dass gerade diese Überwindung einer sonst starken und kriegerischen Frau durch einen (potentiellen) männlichen Sexualpartner ein uraltes Motiv ist und es der scheinbar so “modernen” Heldin auch nicht besser ergeht als einer
scheinen. Männergeschichten erfüllen sich anders als Frauengeschichten, und spätestens bei einer Liebesgeschichte ist der Bedarf an traditionellen Rollenbildern groß: Der Vampir, Dämon oder Werwolf der aktuellen Paranormal Romance ist nichts anderes als ein Übermann, vor dem auch eine sonst ganz toughe Frau ohne Gesichtsverlust niederknien kann. Offen bleiben muss dabei wohl, ob AutorInnen und LeserInnen bewusst ist, dass gerade diese Überwindung einer sonst starken und kriegerischen Frau durch einen (potentiellen) männlichen Sexualpartner ein uraltes Motiv ist und es der scheinbar so “modernen” Heldin auch nicht besser ergeht als einer