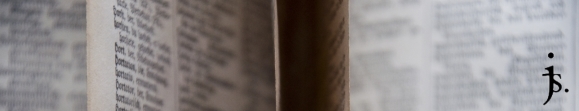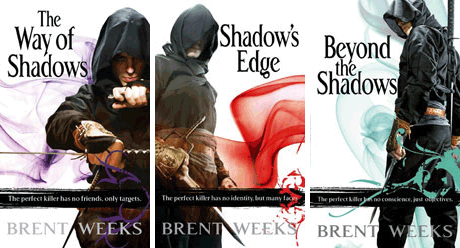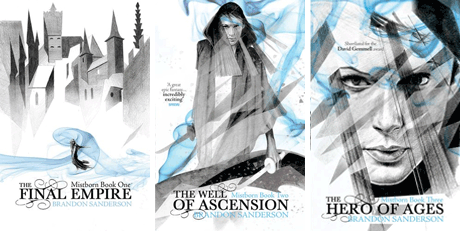Dass Elke Heidenreich keine Fantasy mag, wie sie in ihrem Focus-Interview (ganzer Text nur Printausgabe) wieder vehement unterstrichen hat, dürfte niemanden überraschen, der die Mainstream-Kritik an der Genre-Literatur schon eine Weile verfolgt. Aber auch in einem offenen Brief der Verlegerin Lisette Buchholz (gefunden via Petra van Cronenburg) klingt an, dass die Fantasy – schrill, bunt, stapelweise die Buchläden und Bestsellerlisten dominierend – stellvertretend für all das steht, woran der aktuelle Literaturmarkt krankt.
Als Liebhaber des Genres können wir die Klagen zwar in Teilen nachvollziehen – auch wir mögen sie nicht, die Fantasy, die nur den kleinsten gemeinsamen Nenner bedient, dem neuesten Trend hinterherhechelt und schnell wieder aus Läden und Gedächtnis verschwunden ist. Trotzdem fühlt man sich berufen, bei Pauschalverurteilungen (mit denen das Genre seit jeher zu kämpfen hat) ein wenig gegenzuhalten.
Zeit also, dass wir bei Bibliotheka Phantastika Argumente für die Fantasy und Phantastik zusammentragen, um darzulegen, warum dieses Genre nicht die Müllkippe der Literatur ist, sondern ein wesentlicher und lohnender Bestandteil.

1.) Diejenigen, die das Genre in Bausch und Bogen verdammen, sind vielfach möglicherweise weniger mit einzelnen Inhalten als mit der allgemeinen “Verpackung” vertraut – grelle, billig wirkende Cover, an denen wir selbst schon oft Kritik geübt haben, gleichgeschaltete Werbebotschaften. Das ist ein Punkt, den wir bis zu einem gewissen Grade sogar verstehen können. Aber die äußere Präsentation erlaubt eben nicht immer Rückschlüsse auf die Inhalte und ihren literarischen Wert.
siehe auch: Unsere Lieblingscover Teil 1, Teil 2
2.) Massenphänomene wie Harry Potter, Twilight oder auch die Herr der Ringe-Filme waren für das Genre Segen und Fluch zugleich – Segen, weil sie Fantasy in breiteren Kreisen überhaupt erst als etwas bekannt gemacht haben, das nicht nur von Kindern, Jugendlichen und allenfalls noch merkwürdigen Randgruppen gelesen wird, Fluch hingegen, weil diesen gewaltigen Erfolg jeweils Werke hatten, die nicht verraten, was wirklich im Genre steckt (im Falle von Tolkien verraten die Filme nicht viel von der literarischen Qualität der Buchvorlage, sondern konzentrieren sich sehr auf die Action und oberflächlich Spektakuläres). Wenn jemand das alles von außen kommend für repräsentativ für die Fantasy hält, ist die Annahme “Aha, da geht es also ausschließlich ums Monstermetzeln, um lüsterne Vampire und um unbedarfte Zauberlehrlinge” irgendwo verständlich, wenn auch grundfalsch.
3.) Wenn wir auf die Geschichte des Erzählens zurückblicken, haben wir eigentlich fast immer phantastisches Erzählen vor Augen – von Gilgamesch über Homer bis Parzival und Shakespeare, Goethe und Wilde. Der Gedanke, plötzlich nur noch an der Realität orientiertes Erzählen als ‘zulässig’ und wertvoll zu erachten, ist relativ neu (und auch nicht überall in der Welt gleich akzeptiert – siehe z.B. Magischer Realismus).
Als Genre steht die Fantasy sogar in der Tradition einer allgemein literaturwissenschaftlich anerkannten Strömung, der Romantik, die auch ein Gegengewicht zu aufklärerisch-vernunftbetonten Tendenzen sein wollte, in denen das, was den Menschen seelisch anspricht, verloren gehen kann. In E.T.A. Hoffmanns Klein Zaches etwa ist die Ausgangssituation explizit, dass in einem Kleinstaat “die Aufklärung eingeführt wird”, so dass märchenhaftere Gestalten verbannt werden – oder sich tarnen müssen, wie z.B. eine Fee als Stiftsdame.
Beispiele: Der Meister und Margarita, Zwischen neun und neun
4.) Fantasy erlaubt, Probleme der realen Welt durchzuspielen, ohne exakt an die Nachzeichnung realer Umstände gebunden zu sein oder irgendjemandem aus ebendieser realen Welt mit Schuldzuweisungen etc. auf die Füße zu treten – sei es, dass es um allgemeingültige Schwierigkeiten geht, die in Mittelerde ebenso auftreten wie in Mitteleuropa, sei es, dass bestimmte Dinge im weitesten Sinne symbolisch zu verstehen sind. Auch das ist im Grunde eine sehr alte literarische Technik (man nehme z.B. Shakespeare, dessen Stücke gern im Ausland, in mythischer Vorzeit oder zumindest so weit in von ihm aus gesehenen historischen Epochen angesiedelt sind, oder auch moderne Formen wie Arthur Millers The Crucible/ Hexenjagd, das eigentlich jeder als Chiffre auf die McCarthy-Ära versteht und nicht als unbedingt historisch korrekt angelegte Auseinandersetzung mit den tatsächlichen Vorgängen irgendwann in Salem). Während die Technik einer Zukunfts- oder Rückprojektion oder einer Versetzung ins Reich der Fabel bei eindeutig dystopischen Werken relativ anerkannt ist (Brave New World oder Animal Farm), ist man bei “klassischer” Fantasy anscheinend weniger tolerant – oder weniger bereit, nach tieferen Themen zu suchen und Parallelen gelten zu lassen.
Beispiele: Ein neues Land, Scheibenwelt
5.) Fantasy ist eine Experimentierwiese für philosophische, soziale, kulturelle, psychologische Fragestellungen, die in allen erdenklichen Varianten der Frage “Was wäre, wenn …?” auf die Spur geht. Sie lässt völlig neue Prämissen und darauf fußende Gedankengebäude zu, die in ihrer besten Ausprägung Denkanstöße geben und die Möglichkeit bieten, alle erdenklichen Szenarien zu erproben, die himmelweit darüber hinausgehen, jemandem nur einen Zauberstab an die Hand zu geben, der alles richten kann. Damit spricht sie nicht nur Forscherdrang und Neugier an, sondern vor allem auch das Verlangen, die conditio humana zu ergründen.
Beispiele: Aether, Perdido Street Station, The Windup Girl
6.) Man sollte den Reiz des nicht selbst Erlebbaren nicht unterschätzen. Zwar wird gegen Fantasy gern die Eskapismuskeule geschwungen – das Geschilderte ist eben nicht echt, so etwas gibt es in der realen Welt nicht -, dabei aber übersehen, dass eigentlich sehr viele literarische Werke gerade mit dem Element des aus der eigenen Lebenswelt nicht Erfahrbaren, Exotischen arbeiten. In einer schon stark globalisierten Welt und aus der Lebenssituation in einer reichen Industrienation heraus, in der z.B. eine Reise nach Afrika auch vielen Durchschnittsmenschen möglich ist, rückt Fantasy, was dieses nicht selbst Erlebbare betrifft, bis zu einem gewissen Grade in eine Lücke, die vor 100 Jahren vielleicht in der realen Welt angesiedelte Abenteuergeschichten füllen konnten. Literatur ist immer auch ein Eintauchen in fremde Erfahrungswelten, ganz gleich, ob diese nun innerlich oder äußerlich “fremd” sein mögen, und welches Genre bietet auf dem Sektor so viel wie Fantasy?
Beispiele: Who Fears Death, Welt aus Stein
7.) Fantasy ist im besten Falle letztlich auch eine philosophische Erfahrung, die den Leser davor warnen kann, sich zu sehr auf eingefahrene Denkstrukturen und damit auch auf blinde Wissenschaftsgläubigkeit zu verlassen, da sie immer wieder Mächte und Situationen präsentiert, die der Mensch mit normalen Mitteln nicht deuten oder gar kontrollieren kann, sondern denen er mit einem gewissen Respekt begegnen muss. Gerade die ganz klassische (Questen-)Fantasy baut doch das Thema sehr aus, dass man zwar mit vereinten Kräften auch letztlich Unbegreifliches und unüberwindlich Scheinendes zu meistern versuchen kann, dass ein solcher Versuch aber auch auf physischer und psychischer Ebene seinen Preis hat und dass es letztlich vielleicht die größte Schwierigkeit ist, dabei die eigene moralische Integrität zu wahren (siehe dazu das Ringproblem bei Tolkien, aber z.B. auch die Art, wie letztlich der Oberböse in Osten Ard überwunden werden kann). Das geht im modernen grim & gritty zwar verloren, aber die Kritiker, die nur auf mangelnden Realismus oder angeblich so simple Schwarzweißmalerei verweisen, übersehen, dass Fantasy letztlich auf ihre Art die uralte Frage nach der Rolle des Menschen in der Welt und nach dem ethisch richtigen Handeln des scheinbar so “kleinen” und unbedeutenden Einzelnen und dem, was er bewirken kann, stellt und immer wieder neu zu beantworten versucht.
Beispiele: Die Legende von Isaak, Die magischen Städte
8.) Fantasy hat einen ästhetischen Wert. Wenn man manche Cover sieht, mag man das zwar nicht glauben, aber das Phantastische, nicht Reale hat in der künstlerischen Vorstellungswelt ebenso seinen Platz wie die Wiedergabe der Wirklichkeit und hat die Menschen immer beschäftigt und beeindruckt. Warum stehen wir sonst z.B. noch heute begeistert vor jahrhunderte- oder gar jahrtausendealten Darstellungen von Fabelwesen? Dass z.B. der Löwenmensch, der/die Sphinx von Gizeh, die Chimäre von Arezzo oder die Teppichserie der Dame mit dem Einhorn so bekannt sind und so viele Fans haben, hängt ja nicht nur damit zusammen, dass uns die Kunstfertigkeit ihrer Herstellung beeindruckt oder dass wir ein rein wissenschaftliches Interesse an historischen Gedankenwelten haben, sondern dass das Phantastische daran uns fasziniert und die eigene Vorstellungskraft anregt.
Beispiele: Day of the Minotaur, Das Silmarillion
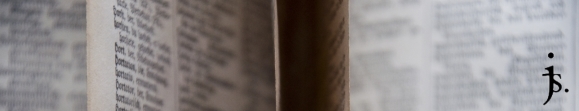
Dass die Trennlinie zwischen E- und U-Literatur (eine Unterscheidung, die man auch prinzipiell in Frage stellen kann) entlang von Genregrenzen gezogen wird, dient also eher dazu, traditionelle Machtstrukturen des Literaturbetriebs aufrecht zu erhalten, als dass sie reale Verhältnisse widerspiegelt. Die Bedeutung phantastischer Elemente in der Literatur einerseits sowie die Behandlung ernsthafter Themen in der Phantastik andererseits zeigen, dass man diese Unterscheidung bestenfalls anhand von Inhalten, aber nicht oberflächlich anhand von Genres vornehmen kann.
Da die nächste Runde Fantasy vs. Feuilleton so sicher kommt wie der nächste Kampf gegen einen dunklen Herrscher (wobei wir hier natürlich keine Vergleiche ziehen möchten!), postet doch bitte auch eure Argumente gegen Fantasy-Verächter in den Kommentaren!