Je mehr Publikationen in unterschiedlichen Medien ein bestimmtes Franchise erhält, desto heftiger ist zumeist die Auseinandersetzung der Fans, welche davon nun dem offiziellen Kanon entsprechen und welche nicht.
Würde man zehn Star Trek oder Star Wars Fans zu dem Thema befragen, dürfte man wahrscheinlich elf unterschiedliche Ansichten dazu erhalten. Für die einen sind es nur die Filme (TV- und/oder Kino), für andere nur bestimmte Romane, für den nächsten auch bestimmte Comics, Teile des Rollenspiels und so weiter und so fort.
Der Lizenznehmer sollte sich dabei natürlich eng an den Kanon halten und seine Geschichten und Settings eng abstimmen. Genau aus diesem Grunde gibt es ja dieses Modell überhaupt. Der Lizenzgeber gestattet den Transport des Franchise/des Universums in ein bestimmtes Medium, die umsetzende Partei stellt aber dabei nicht plötzlich die Geschichte/die Welt/das Universum auf den Kopf, sondern beide Seiten achten auf eine gewisse Stringenz der Erzählungen.
Betrachten wir mal ein Monster-Werk wie Perry Rhodan in dieser Hinsicht.
Grundsätzlich kann man hier sagen, dass zumindest die 2500+ PR-Hefte sowie die ca. 900 Atlan-Hefte als kanonisch anzusehen sind. Gerade in früheren Taschenbüchern haben sich die Autoren oft bei Themen ausgetobt, bei denen man vermutete, dass diese nicht nochmals in der Heft-Serie aufgegriffen werden. Dass dem leider oft nicht so ist und war, wurde schon recht schnell sichtbar, weshalb über die Jahre viele der sog. Planeten-Romane nicht mehr kanonisch sind.
Selbst innerhalb der Heft-Serie, die nun seit beinahe 50 Jahren wöchentlich erscheint, gibt es viele Widersprüche in der fortlaufenden Handlung, die zum Teil mit dem Eingreifen von Superintelligenzen, Erlebnissen in Parallel-Universen, Veränderungen im Raum-Zeit-Kontinuum und ähnlichem erklärt werden mussten. Nicht immer schön, aber verständlich, und es wird ohne Murren von den Lesern hingenommen. Je größer ein Universum wird, desto wahrscheinlich ist es, dass man irgendwelche Korrekturen vornehmen muss.
Zurück zum aktuellen Anlass dieses Beitrages, welches ein Posting im neu eingerichteten “Redaktions-Stübchen” auf den Ulisses-Foren ist, wo folgende Frage aufkam:
Zählen Hintergrundinformationen, die nur in Romanen zu finden sind, zum offiziellen Aventurien? Oder erst dann, wenn sie in einer Spielhilfe oder einem offiziellen Abenteuer verwendet werden?
Reichlich erstaunt war ich über die erste Antwort von Alex Spohr (Einer der beiden neu einberufenen Redakteure) darauf:
Romane sind generell nicht Teil des Rollenspiel-Kanons.
Das ändert sich aber dann, wenn DSA-Rollenspielmaterial auf Inhalt von Romanen oder direkt auf Romane sich bezieht.
Noch erstaunter war ich allerdings über die Aussage des Autors Michael Masberg hierzu:
In der Tat ist das keine neue Infos. DSA-Romane waren immer schon nur bedingt kanonisch, spätestens ab dem Zeitpunkt, als die Spiel-Redaktion mit dem Wechsel der Spiel-Lizenz vor ein paar Jahren keinen Einfluss mehr auf den Inhalt der Romane hatte. Zwar gab es eine Zusammenarbeit bis zu einem gewissen Grad, aber die Verantwortlichkeit der inhaltlichen Stimmigkeit lag meist in der Eigenverantwortung der Schreiberlinge oder interessierter Redakteure. […] Ein gesamteinheitliches Aventurien hat es in dem Sinne nicht mehr gegeben, seit die Lizenz massiv aufgesplittet ist. Jeder Lizenznehmer hat die Deutungshoheit, sein Parallelaventurien aufzumachen. […]
Im selben Thread schreibt Alex Spohr (aka Disaster) nochmals:
Michael liegt da richtig. In vielen Fällen fand eine Anstimmung statt, in vielen Fällen sind die DSA-Romane auch im Kanon drin (es gibt ja nicht gerade wenig Bezüge).
Dennoch gilt die Regeln (und nicht erst seit Ulisses DSA verlegt): Die Romane sind erst einmal nicht kanonisch.
Nachdem ich darüber leicht kopfschüttelnd ins Bett gegangen bin, wurde am nächsten Tag aber auch ziemlich zurück gerudert:
Da die Frage aufgeworfen wurde, was zum Kanon von DSA zählt und was nicht, hier eine kurze Erklärung bzw eine Richtigstellung:
Generell zählt alles zum Kanon, was unter den DSA-Lizenzen publiziert wird. Beispielsweise Computerspiele und Romane.
Es kann jedoch durchaus passieren, dass die Geschehnisse nicht weiter (oder erst sehr viel später) thematisiert werden.
Nun wird sich der geneigte Leser fragen, wie kann so etwas passieren?
Hier sollte man wahrscheinlich zwei Dinge genauer betrachten. Zum ersten hat Alex in seinem ersten Post schon gewisse Dinge (möglicherweise unbewusst) auf den Punkt gebracht:
Romane sind generell nicht Teil des Rollenspiel-Kanons.
Sobald ich ein Universum in ein anderes Medium transportiere, wird es sehr wahrscheinlich nötig sein, an den Regeln dieses Universum gewisse Veränderungen vorzunehmen. Was in einem (Pen & Paper) Rollenspiel gut funktioniert, mag am Computer todlangweilig sein. Gute Action am Computer wird in einem Roman evtl. schnell zu einer Einschlafhilfe. Wenn ich jedoch an den Regeln etwas ändere, verändere ich auch implizit das zugrunde liegende Universum. Dies wird wohl niemals ausbleiben. Unterschiedliche Publikationsformen ergeben unterschiedliche Sichten auf ein und dieselbe Geschichte, deshalb mag die Geschichte auf einmal in einem ganz anderen Licht erscheinen. Hierin sehe ich allerdings erst mal keinen Widerspruch.
Zum zweiten war möglicherweise die Frage im Ulisses-Forum schon deplatziert.
Die Frage, was zum Kanon von Aventurien gehört, kann meines Erachtens Ulisses als Lizenznehmer überhaupt nicht beantworten. Jedenfalls nicht für Produkte jenseits des Pen&Paper-Rollenspiels. Solche Entscheidungen unterliegen meines Erachtens einzig der Significant Fantasy GbR als Lizenzgeber.
Ich persönlich habe überhaupt kein Problem damit, Unterschiede in Romanen, Computerspielen und anderen Medien zum Rollenspiel am Tisch zu haben.
Bei den Romanen kann ich mir dies z.B. immer gut mit einem unzuverlässigen Erzähler erklären. Selbst im letzten Computer-Spiel (Drakensang 2) würde dies wunderbar zu der ganzen Geschichte passen, die ja rückblickend aus der Sicht von Forgrimm geschildert wird.
Und natürlich gehören bestimmte Sachen aus dem Kanon herausgenommen, etwa wenn ein Autor wie Andreas Brandhorst einfach mal sämtliche Vorgaben ignoriert und einfach irgendwas schreibt, oder wenn Raumschiffe und Atomreaktoren aus einem Solo-Abenteuer von anno dazumal wirklich nicht in das heutige Aventurien passen.
Fazit: Bei so signifikant (no pun intended) unterschiedlichen Medien und Stilmitteln bleibt eine gewisse Diskrepanz wohl niemals aus.
Für mich ist der gesamte Kuchen (RPG, Roman, Computer-Spiel…) das Ganze und somit Kanon.
Ob man sich persönlich hier nur bestimmte Stückchen mit seinen besonderen “Rosinen” heraussucht, bleibt wohl jedem selber überlassen.
Und ich kann zur Abstimmung von Lizenzgebern und -nehmern naturgemäß nichts sagen. Allerdings weiß ich, mit welchen Argus-Augen z.B. Lucas Arts über Star Wars wacht. Sollte hier tatsächlich ein gewisses Defizit vorliegen, sollten die Macher des wohl größten Rollenspiel-Franchise Deutschlands dies mal zum Anlass nehmen, ein wenig darüber nachzudenken und ggf. die Situation zu verbessern.
Allerdings gilt auch hier: Dies obliegt wohl nicht Ulisses alleine, sondern allen Beteiligten.
Demnächst in Teil 2: Wüstenwelten, Handtücher und andere Fortsetzungen.

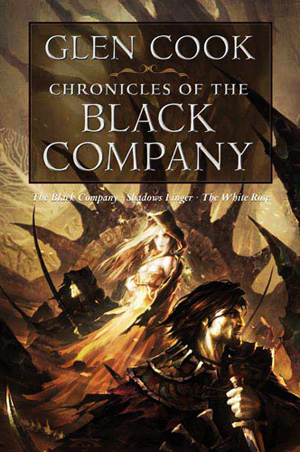
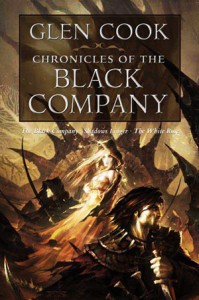
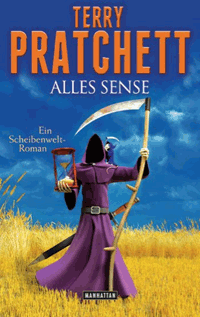


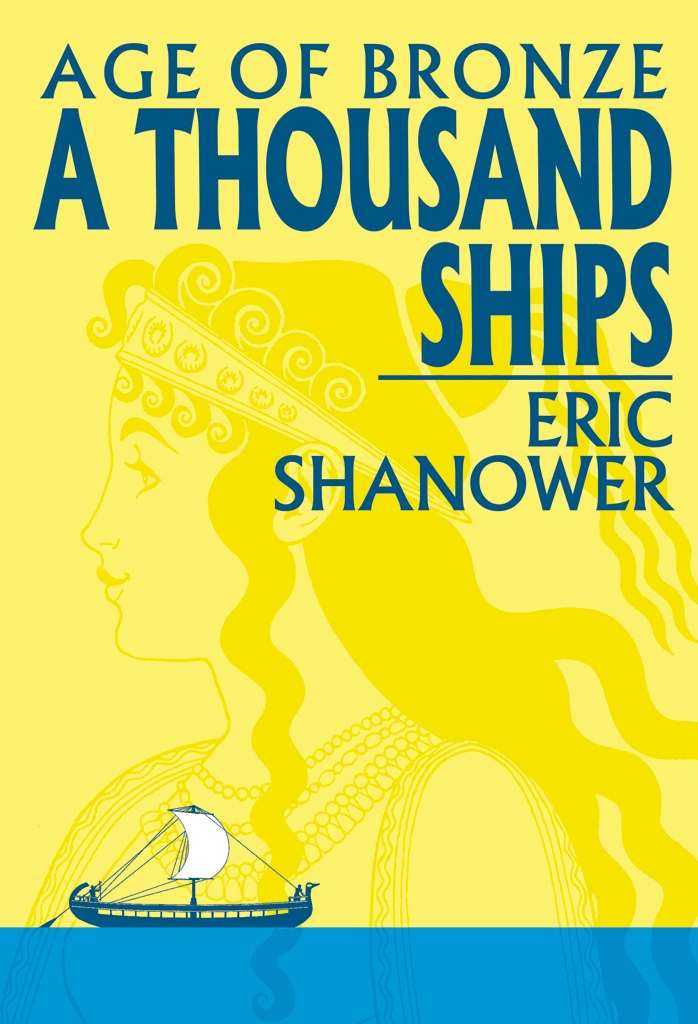

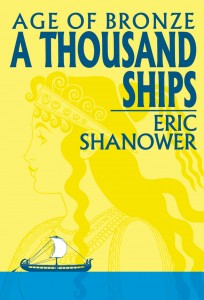
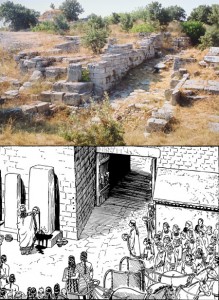
 Die Beantwortung dieser Frage ist schwierig, denn Videospiele sind an sich schon ein sehr eklektizistisches Medium, das sich etwa bei der Inszenierung sowohl an Filmen, als auch an Comics orientieren kann, wie etwa das jüngste Beispiel
Die Beantwortung dieser Frage ist schwierig, denn Videospiele sind an sich schon ein sehr eklektizistisches Medium, das sich etwa bei der Inszenierung sowohl an Filmen, als auch an Comics orientieren kann, wie etwa das jüngste Beispiel 
 Allerdings auch mit einem “traumatischen” Erlebnis zu Beginn: Mein Faible für düstere Welten und ambivalente Helden hat mich kurz nach der Entdeckung der Bibliotheka – und man muss dazu sagen, dass meine Leseerfahrung in der Fantasy sich damals mehr oder weniger auf den Herr der Ringe und die drei großen Hs der deutschsprachigen Fantasy (
Allerdings auch mit einem “traumatischen” Erlebnis zu Beginn: Mein Faible für düstere Welten und ambivalente Helden hat mich kurz nach der Entdeckung der Bibliotheka – und man muss dazu sagen, dass meine Leseerfahrung in der Fantasy sich damals mehr oder weniger auf den Herr der Ringe und die drei großen Hs der deutschsprachigen Fantasy (