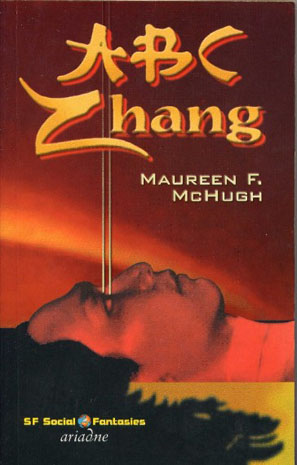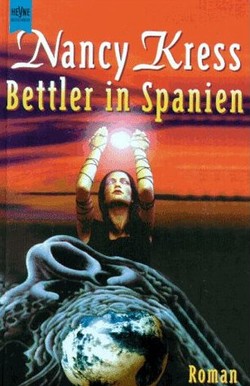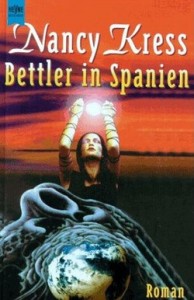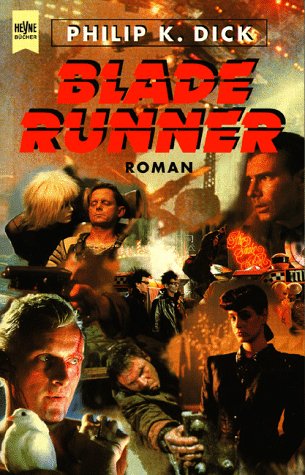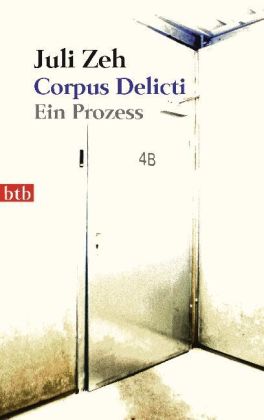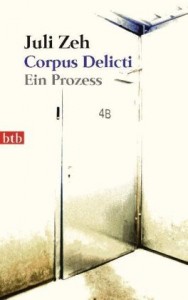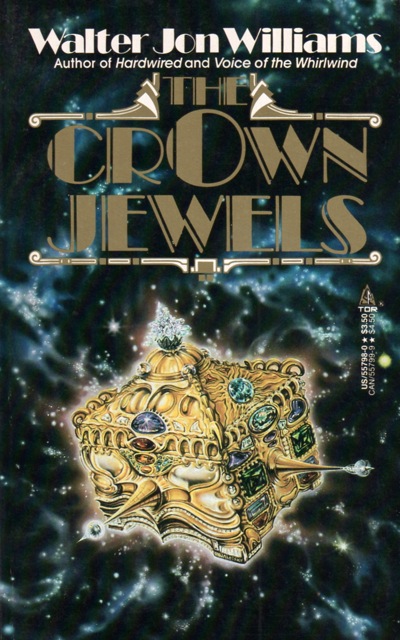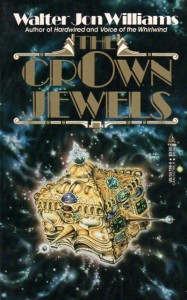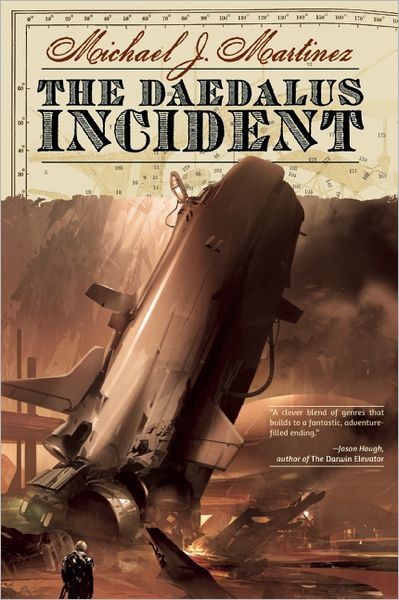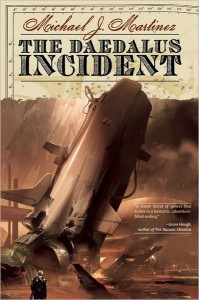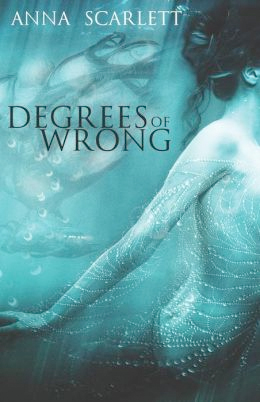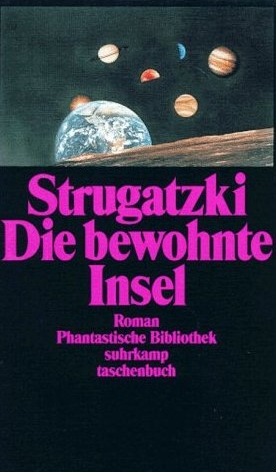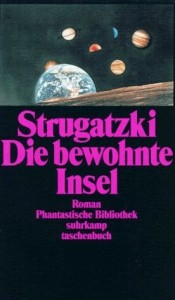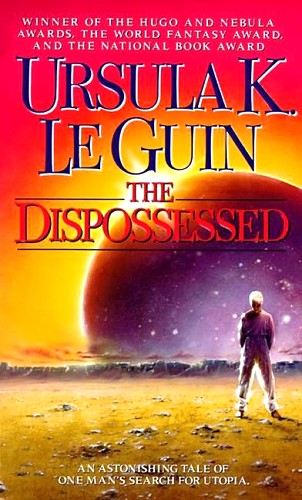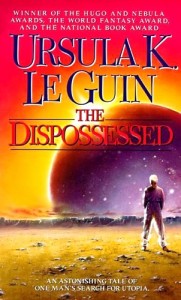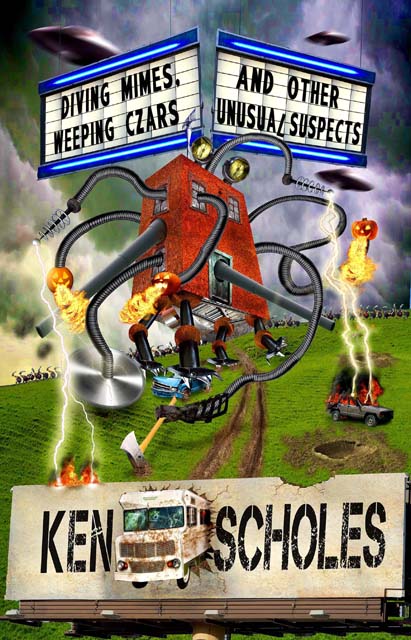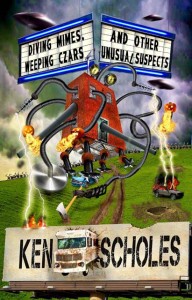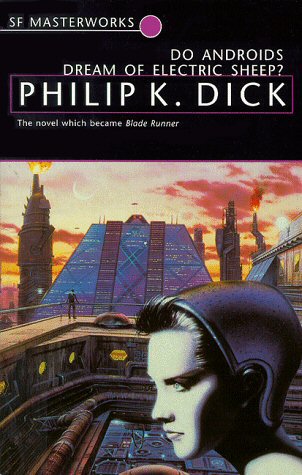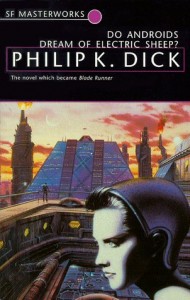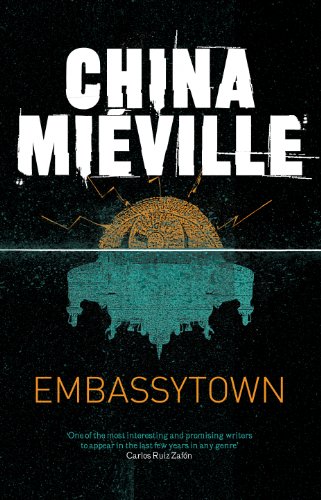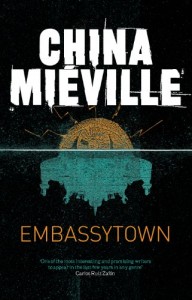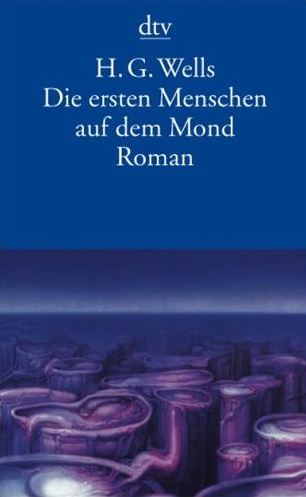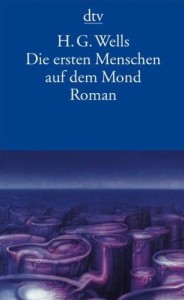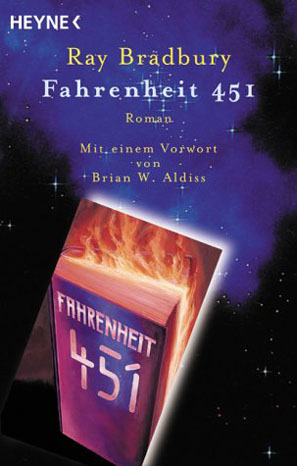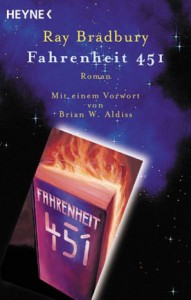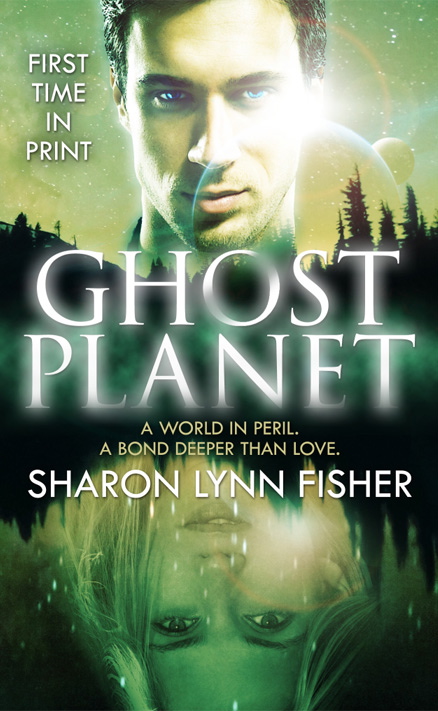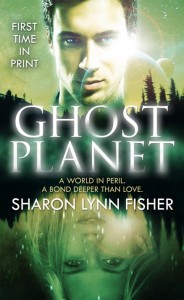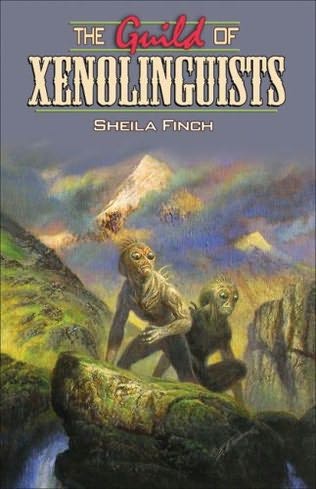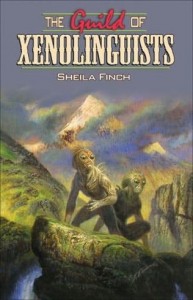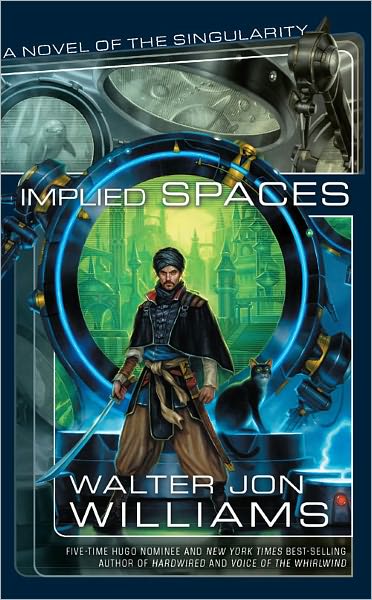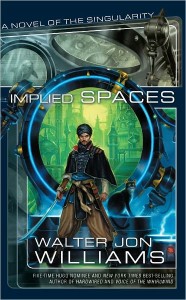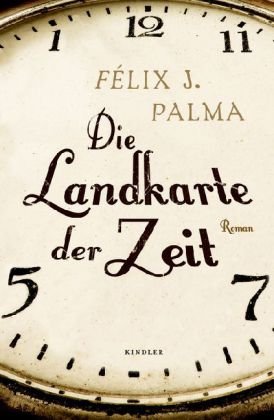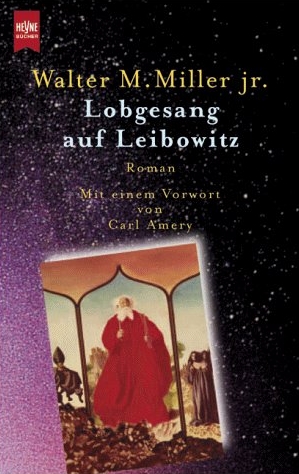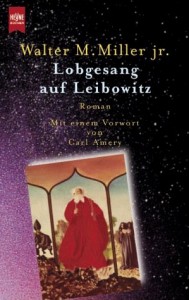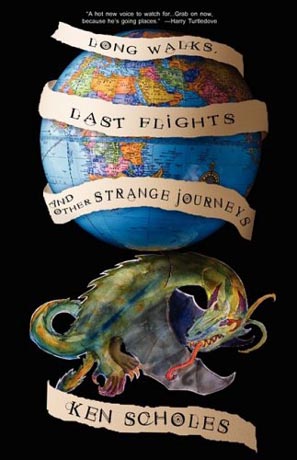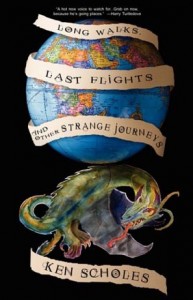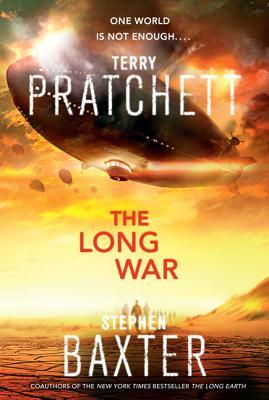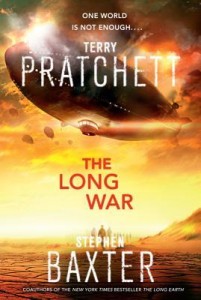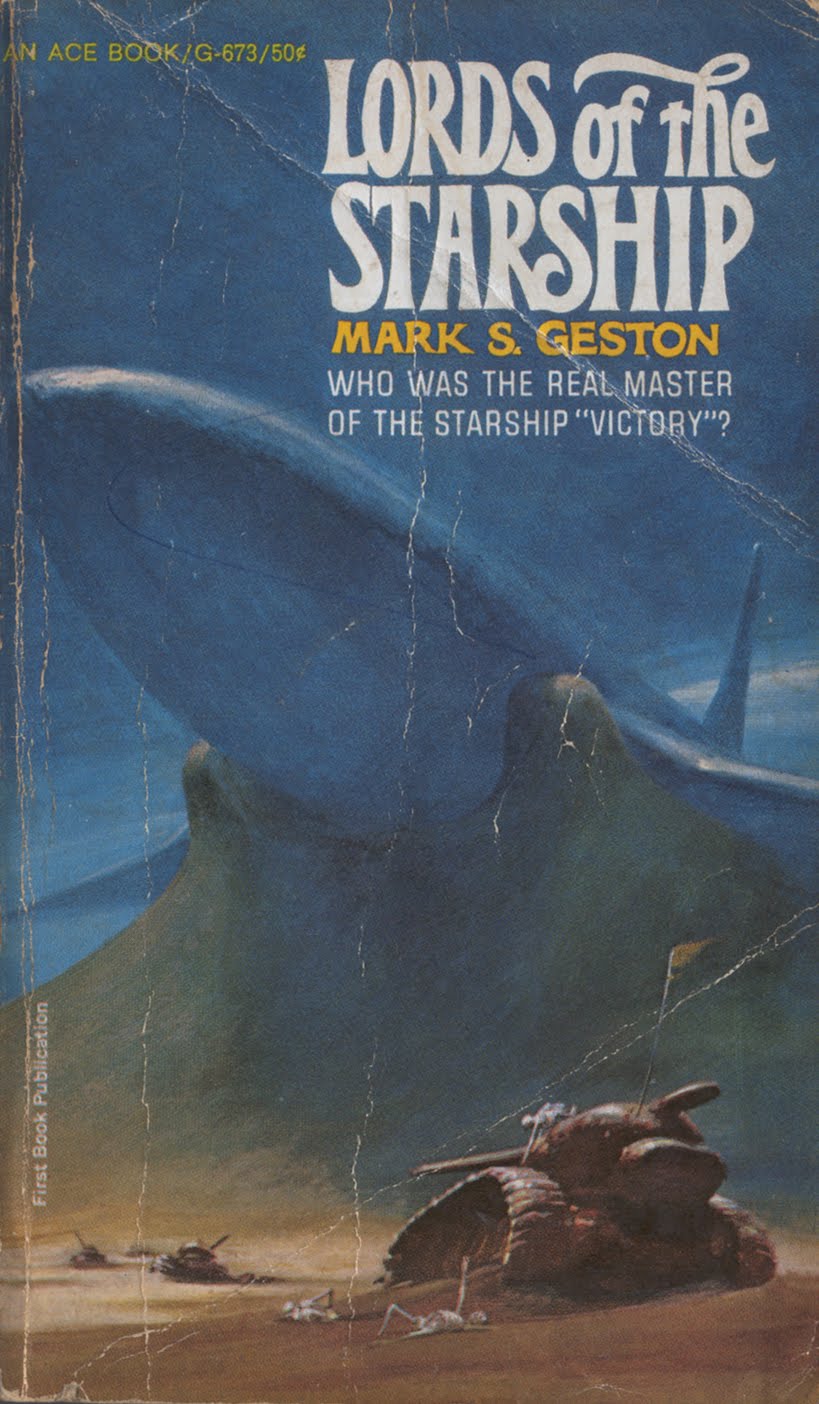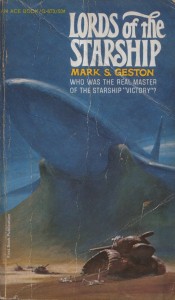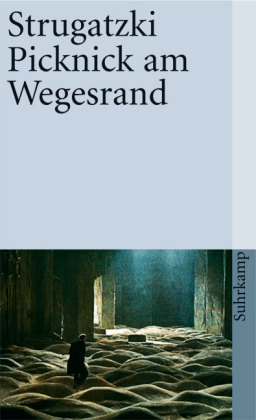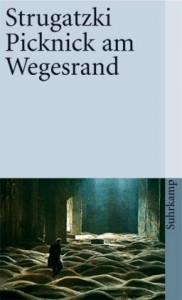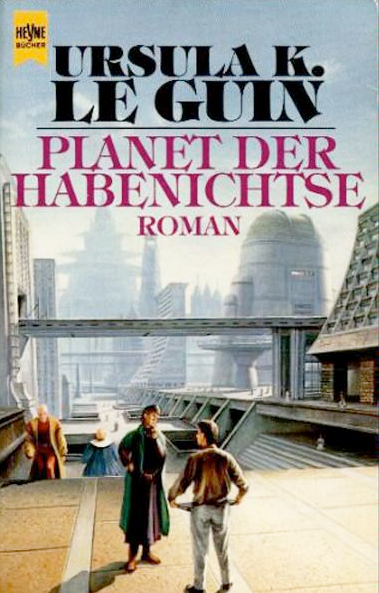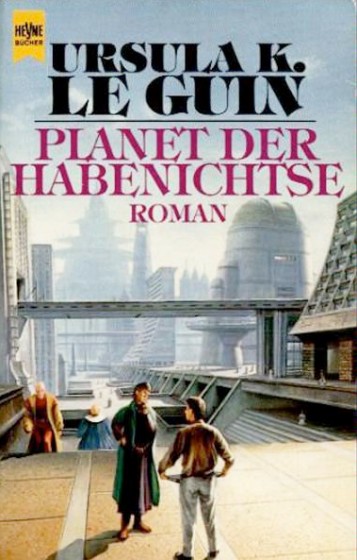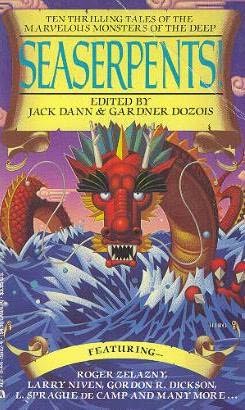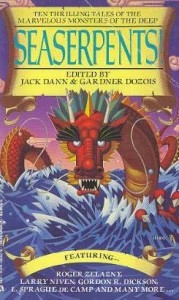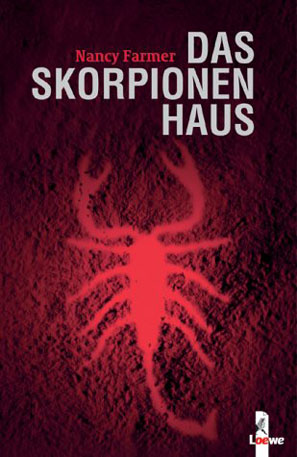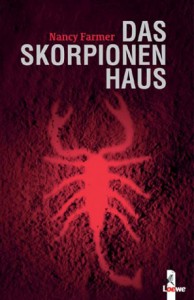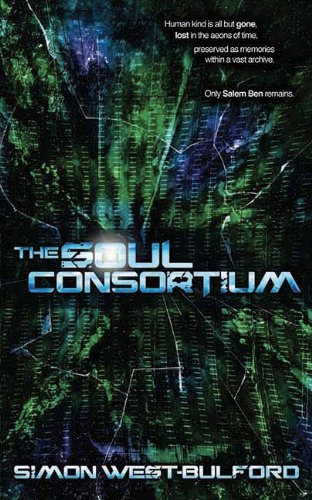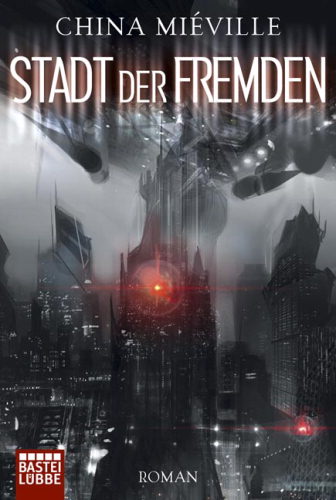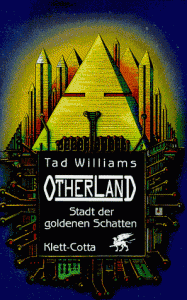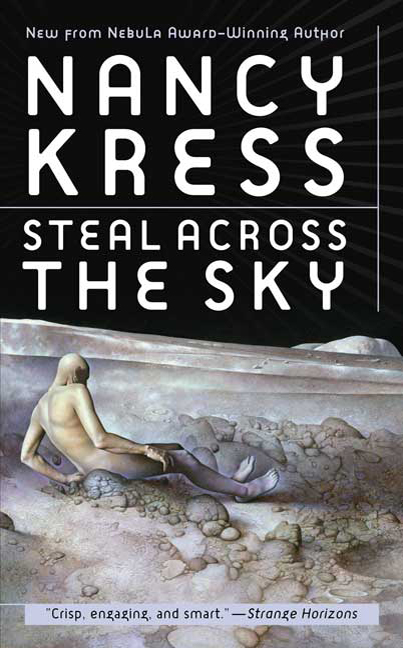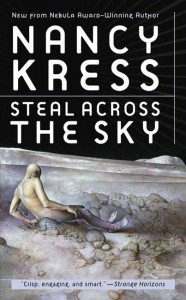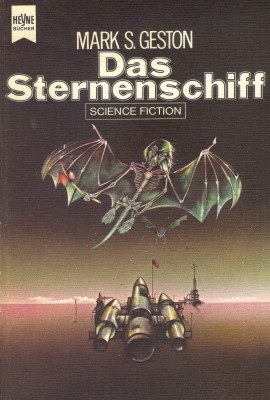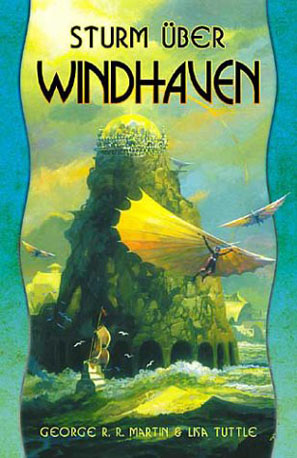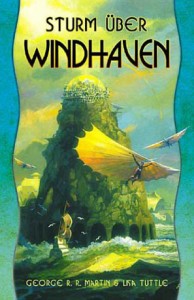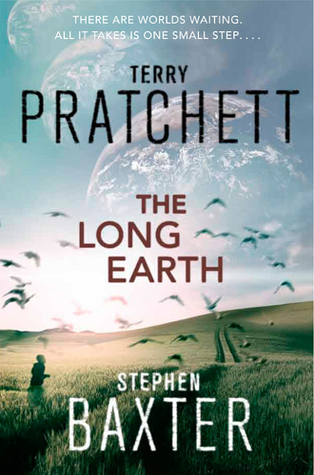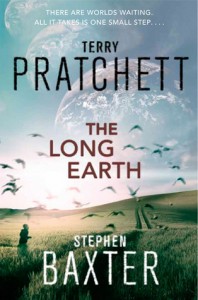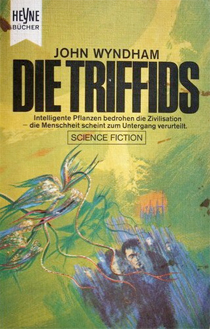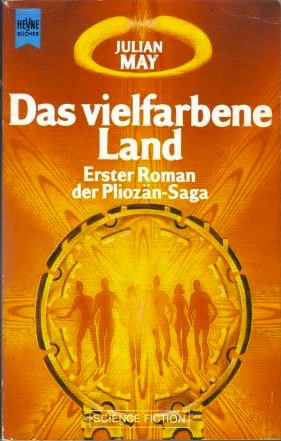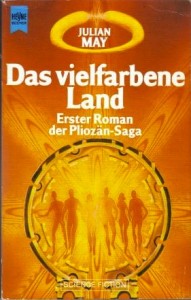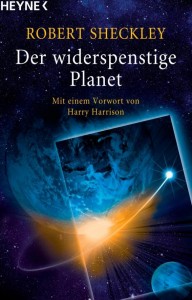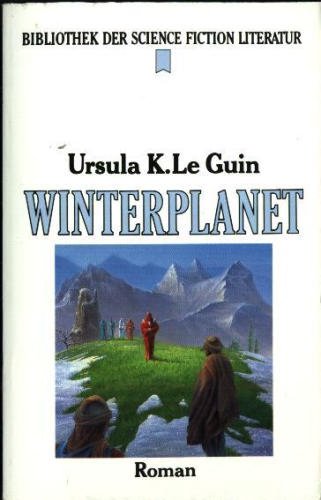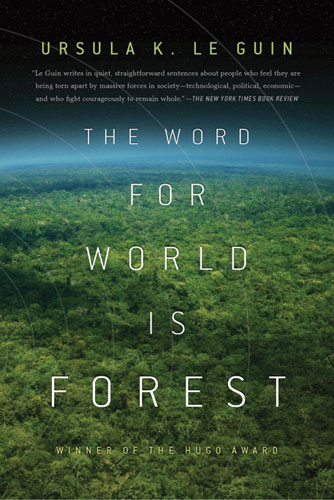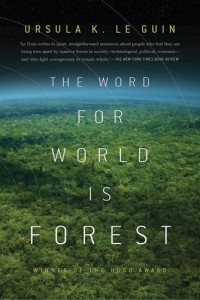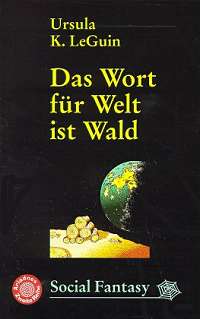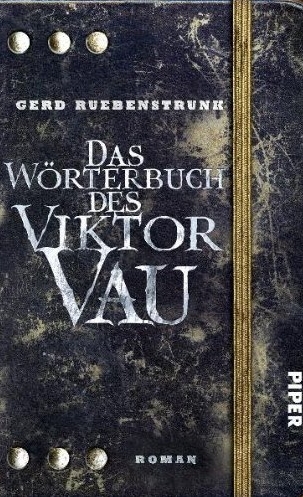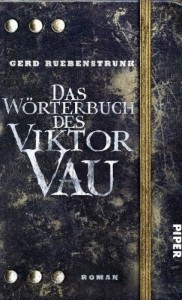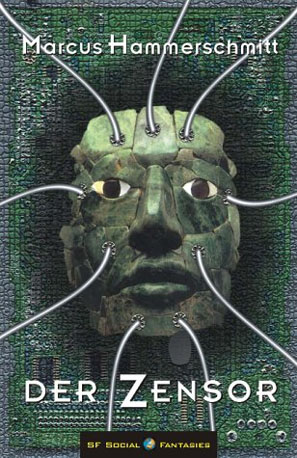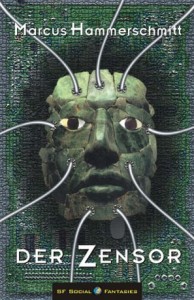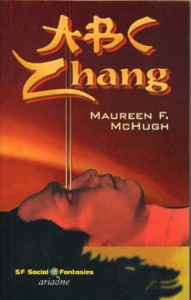 Techniker Zhang ist schwul. Das ist im Zweite-Welt-Land Amerika strafbar, in China, der Schirmherrin Amerikas, werden Homosexuelle zum Teil sogar hingerichtet. In Episoden, die aus einem Zeitraum von vier Jahren stammen, wird das Leben Zhangs und einiger weiterer Personen, deren Leben er berührt, in dieser fortschrittlichen Welt erzählt. Es wird geschildert, wie er seine Arbeit verliert, weil er die San-xiang, die Tochter seines Vorgesetzten, nicht heiraten will; wie er einen deprimierenden Job auf Baffin Island, jenseits des Polarkreises gelegen, annehmen muß und schließlich in China landet um Bauingenieur zu werden.
Techniker Zhang ist schwul. Das ist im Zweite-Welt-Land Amerika strafbar, in China, der Schirmherrin Amerikas, werden Homosexuelle zum Teil sogar hingerichtet. In Episoden, die aus einem Zeitraum von vier Jahren stammen, wird das Leben Zhangs und einiger weiterer Personen, deren Leben er berührt, in dieser fortschrittlichen Welt erzählt. Es wird geschildert, wie er seine Arbeit verliert, weil er die San-xiang, die Tochter seines Vorgesetzten, nicht heiraten will; wie er einen deprimierenden Job auf Baffin Island, jenseits des Polarkreises gelegen, annehmen muß und schließlich in China landet um Bauingenieur zu werden.
-Der Vorarbeiter schnatterte Meihua, die herrliche Sprache, Singapur-Englisch.-
China Mountain – Zhang
Die Geschichte spielt im 22. Jh. auf einer Parallelwelt, doch die Unterschiede, die zu dieser Annahme führen, sind nur kosmetischer Natur (z.B. findet der Zusammenbruch der Sowjet Union im frühen 21. Jh. statt). Die Schauplätze sind sehr unterschiedlich, New York, Baffin Island, Jerusalem Ridge auf dem Mars, Nanjing und Wuxi in China. New York ist heruntergewirtschaftet, viele Gebäude sind noch aus dem 20. Jh. – und dieses sind zumeist die besseren, denn neuere Gebäude haben zum Teil in den oberen Stockwerken kein fließend Wasser. Nach der “Großen Läuterung” ist Amerika ein sozialistisches Land geworden – die Kapitalisten sind allerdings rehabilitiert – und der Staat organisiert die Grundbedürfnisse und verteilt die Arbeit. Dieses alles aber zumeist auf einem niedrigen Niveau, wer mehr will, muß sich auf dem Freien Markt behaupten. Alleine wohnt fast niemand, da der Wohnraum exorbitant teuer ist – ein Luxus, den sich Zhang gönnt, allerdings ist seine Wohnung eine kleine Bruchbude, in der er sich nur zum Schlafen aufhält. Üblich ist das Leben in Kommunen, sich selbst organisierenden Verwaltungseinheiten auf wirtschaftlicher und politischer Basis. In New York ist Homosexualität strafbar, aber sie wird selten geahndet, auf Coney Island läßt man die Homosexuellen sogar weitgehend gewähren. In China ist das Leben ganz anders; Homosexuelle kommen in ein Umerziehungslager oder werden gleich per Genickschuß hingerichtet. Auch wenn die Bürger nicht scharf überwacht werden, geht man mit diesem “Verbrechen” nicht lax um. Technologisch ist China viel weiter entwickelt; während in New York nur passive Systeme, in die man sich aktiv einklingen muß – wie ein Bibliothekscomputer, der auf Anfragen Daten herausgibt, direkt ins Bewußtsein gespeist – existieren, sind in Wuxi aktive Systeme, die sich selbst einklinken üblich – wie ein Gebäudekomplex, der die Bedürfnisse der Anwesenden überprüft und entsprechend reagiert, z.B. die Temperatur so regelt, daß einem nicht zu warm und nicht zu kalt ist.
Das Leben auf dem Mars ist viel härter, es gibt nur wenig Land, nur wenige, veraltete Geräte, aber es gibt auch weniger Vorschriften – die Kommunen entscheiden selbst wie sie verfahren wollen. Aber auch hier sind nicht alle gleich – die Mächtigsten sind die alteingesessenen Pächter – aus ganz pragmatischen Gründen, wie sie versichern, denn die Pächter müssen sich um ihre Pacht kümmern und können daher wenig anderes machen (als andere an die Polkappen abzukommandieren).
Die insgesamt neun Episoden werden von fünf unterschiedlichen Ich-Erzählern bestritten, Zhang Zhong Shan Rafael erzählt in fünfen von seinem Leben, so daß diese ein wenig Ähnlichkeit mit einem Entwicklungsroman erhalten. Er ist das Kind einer Spanierin und eines Chinesen, seine Eltern haben seine Gene manipulieren lassen, so daß er als ABC – American Born Chinese (oder Another Bastard Chink, wie die Langnasen sagen) – durchgeht, immer am Bangen, daß er keine Genanalyse durchhalten muß und auffliegt. Außerdem ist er schwul. Wie er feststellen wird, ist er ein echter New Yorker, es zieht ihn immer wieder in diese Stadt, auch wenn sie das letzte Loch ist, und er anderswo deutlich bessere Chancen hätte.
Wie Zhang selbst sind auch die anderen Episodenerzähler, von denen jeder nur eine erzählt, liebenswerte, alltägliche Menschen mit Macken und Stärken. Daneben tauchen noch viele weitere Figuren auf, die alle interessant und glaubwürdig sind.
Die Episoden erzählen vom Alltag der Figuren, in dem allerdings nicht immer Alltägliches geschieht. So erfährt der Leser viel über die Möglichkeiten der aktiven Systeme in China, die Krankenhauspatienten in die richtige Stimmung versetzen, Hochgefühle beim illegalen Glücksspiel auslösen und den großen Komplexen, in denen der Mensch quasi als Sinnesorgan des gesamten Körpers fungiert, aber auch davon, wie Zhang in eine Razzia gerät und flüchten muß – die Hinrichtung droht. Wer nach echten Helden oder großen Aufgaben sucht wird hier allerdings enttäuscht.
Sprachlich ist das Werk sehr gut, es gelingt der Autorin die Stimmung der Szenen und Emotionen der Protagonisten eindringlich zu schildern; so ist einem die neue San-xiang auf Anhieb unsympathisch, man sieht jedoch schnell, in welche Falle sie zu laufen droht – und man gönnt es ihr nicht.
Wenn es ein Manko hat, dann ist es das fehlende Etwas, es fehlt einfach der Funke Genialität um das Buch perfekt zu machen.
Wer nach Fantasy im engeren Sinne sucht, sollte dieses Buch meiden; es enthält viele Elemente von guter Science Fiction, mit Zhangs Episoden die eines Entwicklungsromans, ist aber auch gute Social Fantasy – nur eben ohne Magie.