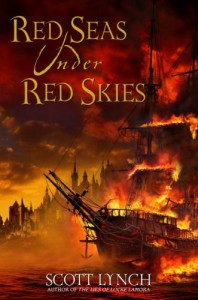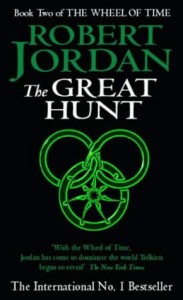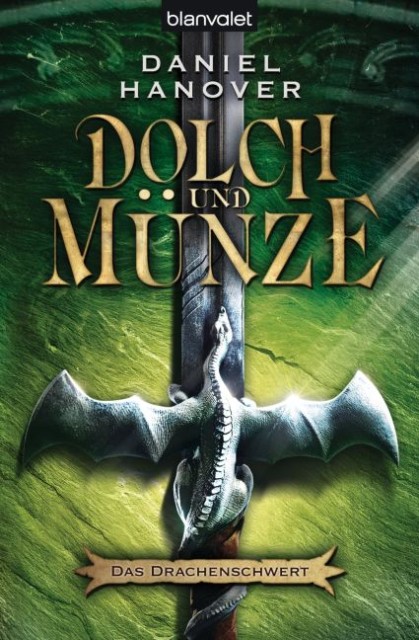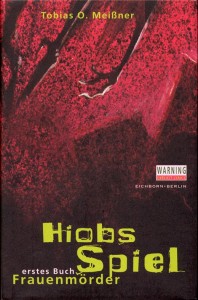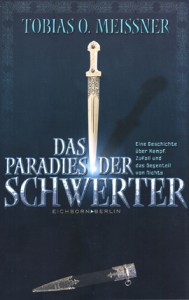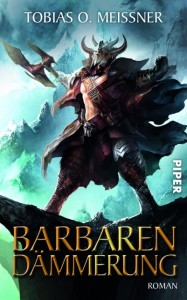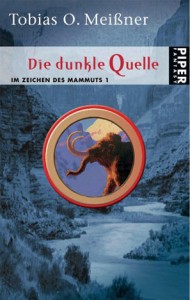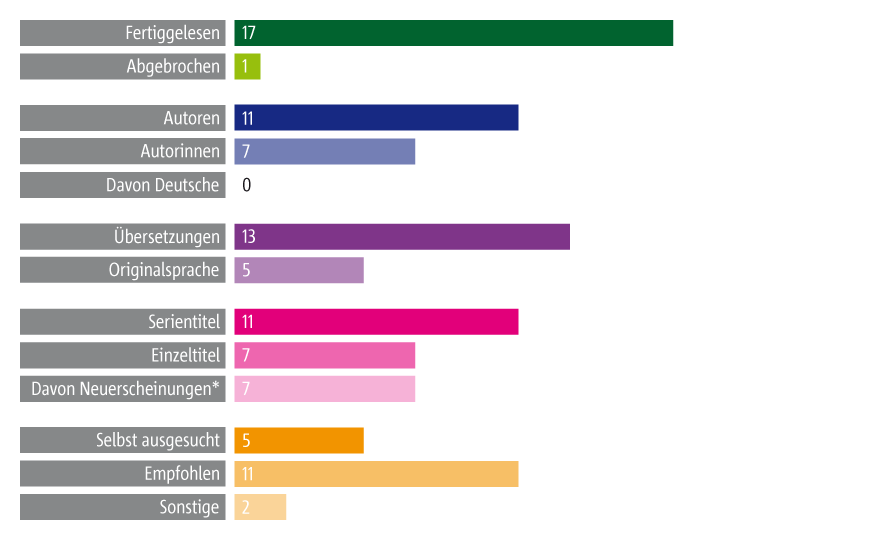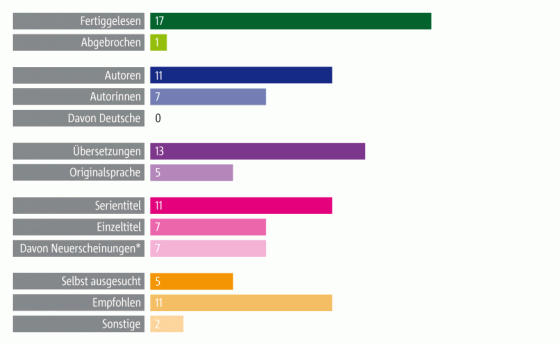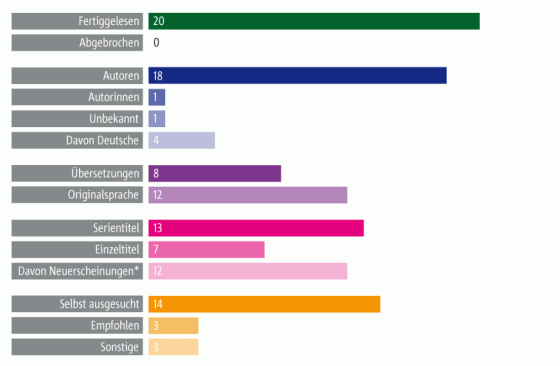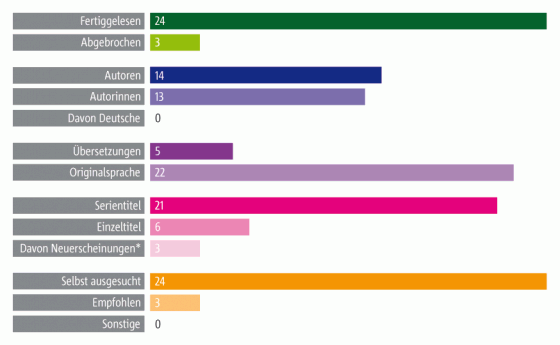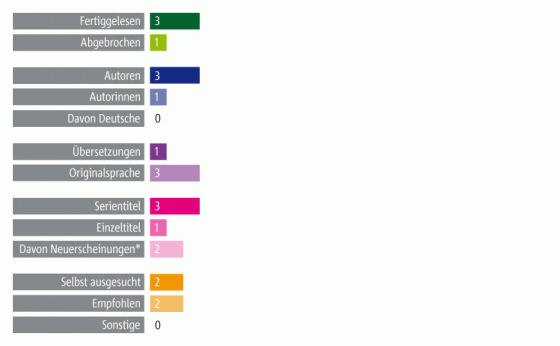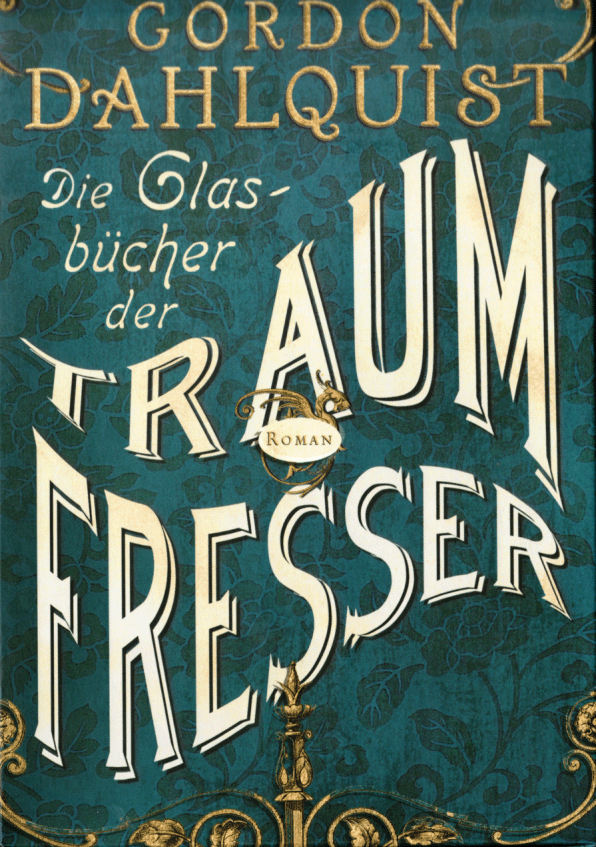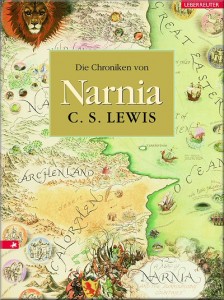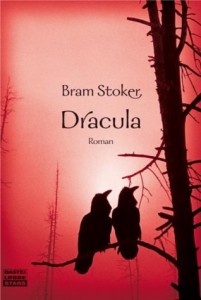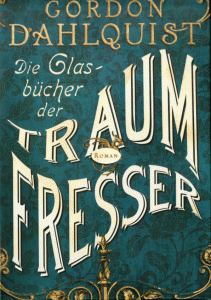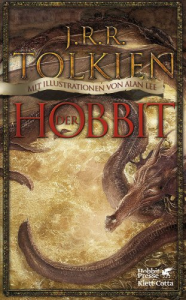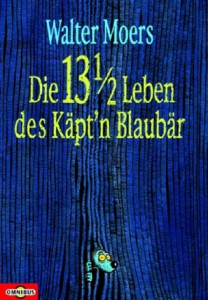In diesem Frühsommer ist Tobias O. Meißners jüngster Roman Barbarendämmerung erschienen und noch heuer soll der dritte Band seiner Reihe Hiobs Spiel veröffentlicht werden. Er ist einer der experimentierfreudigsten deutschsprachigen Phantastikautoren und hat sich ein bisschen Zeit freigeschaufelt, um für Bibliotheka Phantastika ein paar Fragen zu beantworten und spricht mit uns unter anderem über seinen jüngsten Roman und seine neuesten Projekte …
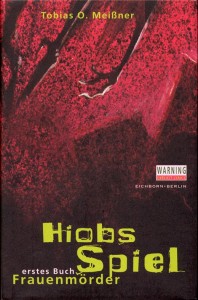 Bilbiotheka Phantastika: Hiobs Spiel wird demnächst bei Golkonda fortgesetzt, dein sonstiger Hausverlag ist Piper. Wie siehst du deine Situation als Autor heute zwischen großen Publikumsverlagen und kleinen Liebhaberprojekten, zwischen Self-Publishing und traditionellen Formen?
Bilbiotheka Phantastika: Hiobs Spiel wird demnächst bei Golkonda fortgesetzt, dein sonstiger Hausverlag ist Piper. Wie siehst du deine Situation als Autor heute zwischen großen Publikumsverlagen und kleinen Liebhaberprojekten, zwischen Self-Publishing und traditionellen Formen?
Tobias O. Meißner: Für mich ist es natürlich komfortabel, dass ich einerseits in Zusammenarbeit mit einem Publikumsverlag verhältnismäßig sicher meine Brötchen verdienen kann, andererseits aber auch für völlig verrückte und unbequeme Projekte noch Abnehmer finde. Kreativ betrachtet ist der Unterschied zwischen beidem jedoch gar nicht so groß, wie man glauben könnte. Das liegt daran, dass Piper mir erstaunlich freie Hand lässt beim Gestalten meiner Projekte.
bp: Zu deinem Mammut-Zyklus ist mit Die Vergangenheit des Regens letztes Jahr nach 6 der geplanten 12 Bände ein “Finale” erschienen: Ist das das Ende? Gibt es in Zeiten des eBooks eventuell eine Möglichkeit, die Geschichte fortzuführen, oder soll sie mit den vagen Aussichten am Ende von Band 6 offen bleiben?
TOM: Ich würde das Projekt sehr gerne noch so wie ursprünglich geplant zuende führen, also: zwölf Bände, Gesamtumfang 4000 Seiten. Immerhin ist der gesamte Handlungsverlauf bereits detailliert schriftlich entworfen worden.
Das Problem dabei ist halt die Finanzierung. Ich würde für jedes fehlende Buch ein halbes Jahr Arbeitszeit brauchen, also drei Jahre für den gesamten Rest. Diese drei Jahre über muss ich jedoch meine Miete zahlen können, und das scheint im Augenblick mit diesem Projekt nicht möglich zu sein. Aber ich betrachte das langfristig. Wer weiß, wie sich die Lage in ein paar Jahren geändert haben wird.
bp: Die RPG-Elemente im Mammut, Das Paradies der Schwerter, bei dem die Ergebnisse ausgewürfelt wurden, Hiobs Spiel: Inwiefern prägt der Spiel-Gedanke deine Literatur? Kommst du oft aus dieser Richtung, mit ungewissen Ausgängen, festen Regeln oder der Betrachtung von Literatur allgemein als Spielwiese?
TOM: Ich finde, dass Spielregeln etwas Philosophisches haben: Sie versuchen, komplexe Geschehnisse zu ordnen und erfahrbar zu machen. Sie sind gleichzeitig abstrakt und konkret. Genau wie gute Literatur. Ich sehe da Zusammenhänge, wahrscheinlich beeinflussen sich deshalb Buch und Spiel bei mir immer gegenseitig.
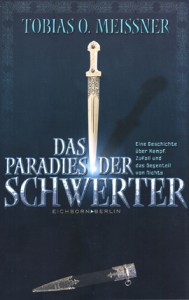 bp: Fast alle deine Werke, vom Debut Starfish Rules bis zum aktuellsten Roman Barbarendämmerung, setzen sich aus vielen, kleinen in sich geschlossenen Texten/Geschichten/Abenteuern zusammen, die sich in ein größeres Ganzes fügen, woher kommt diese Art des Erzählens – von Pen-&-Paper-Rollenspielen, von Computerspielen?
bp: Fast alle deine Werke, vom Debut Starfish Rules bis zum aktuellsten Roman Barbarendämmerung, setzen sich aus vielen, kleinen in sich geschlossenen Texten/Geschichten/Abenteuern zusammen, die sich in ein größeres Ganzes fügen, woher kommt diese Art des Erzählens – von Pen-&-Paper-Rollenspielen, von Computerspielen?
TOM: Eher von meinem Faible für Comics. Das serielle Erzählen, das Plotten in Fortsetzungen bin ich von Comics und Romanheften gewöhnt, Literaturformen meiner Kindheit. Und ich habe darin immer sehr große Stärken gesehen. Heute verfahren auch Fernsehserien nach diesem Muster. Es gibt sowohl Episodenzusammenhänge als auch einzelne Episoden, die für sich stehen, aber Randbereiche der Gesamtserie ausloten. Das ist ein ausgesprochen komplexes und ergiebiges Feld.
bp: An die vorherige Frage anschließend: Würde es dich reizen, mehr Kurzgeschichten zu schreiben oder ist es gerade der große Rahmen, der diese zusammenhält, der für dich interessant ist?
TOM: Tatsächlich fasziniert es mich am meisten, wenn das Kurze Teil eines Größeren ist. Ich finde, dass dann das Kurze sowohl zur Geltung kommt, als auch einem übergeordneten Ziel dient. Das beste beider Welten sozusagen.
bp: In einem Interview vor ein paar Jahren hast du dich mal dazu geäußert, mit einer zwölfbändigen Fantasy-Reihe (dem Mammut-Zyklus *g*) Neuland zu betreten. Ist diese Form deiner Meinung nach gescheitert – es kommen ja generell in letzter Zeit eher einzelne oder lose verbundene Bände heraus als lange Fantasy-Reihen, und auch deine letzten Sachen waren Einzelbände?
TOM: Es sieht so aus, als gäbe es für ausgeklügelte Zyklen á 4000 Seiten momentan nur einen sehr, sehr engen Markt. Aber wie gesagt kann das in zehn Jahren ja schon wieder ganz anders aussehen.
bp: Du hast ja nun schon mehrere Romane veröffentlich, die formal unter die sogenannten “Völkerromane” fallen. Ist das ein notwendiges Übel, oder bist du der Meinung, dass man sich diese Form auch zu eigen machen kann?
TOM: Ich hatte ja vollkommene kreative Freiheit und musste keines von Tolkiens Völkern nehmen. Das hätte mich überhaupt nicht gereizt, da wäre ich mir wie ein Wilderer vorgekommen. Aber so, mit der Dämonen-Trilogie, konnte ich in einem bereits etablierten Format etwas vollkommen Eigenständiges machen. Und so zu arbeiten ergibt für mich in jeder Hinsicht sehr viel Sinn.
bp: Beim Mammut stand zunehmend die Frage nach dem richtigen Handeln im Vordergrund (z.B. wenn Ökos es mit autochthonen Völkern zu tun haben).Wie kann Fantasy Fragestellungen behandeln, die für den modernen Menschen von Belang sind? Und was für Fragen treiben dich um?
TOM: Fantasy kann wirklich ALLE Fragen behandeln, von der sexuellen Unerfüllbarkeit bis hin zum Völkermord. Und da mich Grundprobleme von Ethik, Menschlichkeit, Unmenschlichkeit und verantwortungsvollem Handeln („Wie weit würdest du gehen, um einer gerechten Sache zu dienen?“) brennend interessieren, werden diese Bereiche auch immer wieder in meinen Romanen eine wichtigere Rolle spielen als zum Beispiel die Frage „Kriegen sie sich am Schluss?“ (an deren Antwort „Ja“ ich nie so richtig glaube, weil sie sich ja fünf Tage später schon wieder scheiden lassen können …)
bp: (Phantastische) Literatur kann entweder subversiv-aufrüttelnd sein oder affirmativ-tröstend; bei dir steht ja eher ersteres im Vordergrund. Mit welchen Mitteln versuchst du deine LeserInnen aus der Komfortzone zu locken?
TOM: Ich scheue mich nicht, dahin zu gehen, wo’s wehtut.
Und was ich auch überhaupt nicht mag, sind eindeutige Gut-Böse-Zuordnungen. Wenn Fantasy nur noch Kitsch ist, dann gehört sie meiner Meinung nach eingestampft. Und aus der Pulpe solch zahnlosen Mainstreams könnte man dann wahnwitzig subversives Zeug drucken.
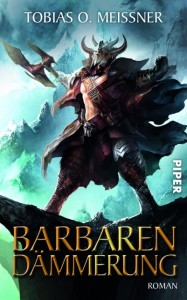 bp: Du hast in einem Interview anlässlich der Leipziger Buchmesse gesagt, dass du von deinem Leben in Neukölln zum Roman Barbarendämmerung inspiriert worden bist, möchtest du dazu ein bisschen was sagen? Angesichts der laufenden Migrationsdebatte ist der Roman mit dem Aufeinandertreffen unterschiedlicher Wertesysteme und der Mischung aus Furcht und Faszination, die dem „Anderen“ entgegengebracht wird, hochaktuell.
bp: Du hast in einem Interview anlässlich der Leipziger Buchmesse gesagt, dass du von deinem Leben in Neukölln zum Roman Barbarendämmerung inspiriert worden bist, möchtest du dazu ein bisschen was sagen? Angesichts der laufenden Migrationsdebatte ist der Roman mit dem Aufeinandertreffen unterschiedlicher Wertesysteme und der Mischung aus Furcht und Faszination, die dem „Anderen“ entgegengebracht wird, hochaktuell.
TOM: Es geht nicht nur um Migranten, sondern ganz allgemein um eine Gesellschaftsschicht, die niemals Bücher liest, aber immer großspurig auftritt und sich mit Gewalt Gehör zu verschaffen sucht. Neukölln war jahrelang ein schmuddeliger Problembezirk (ich lebe seit über zwanzig Jahren hier), und in den letzten Jahren wurde es von Hipstern zum Trend erklärt. Das ist absurd, weil die Barbaren sich dadurch nur umso entschlossener zusammenrotten werden, um ihre Recht aufs Barbarenbleibendürfen einzufordern.
bp: Die Gewaltdarstellung ist in den meisten deiner Werke sehr explizit. Wann ist für dich die Grenze zwischen „Gewalt als Stilmittel“ und „Gewalt als Selbstzweck“ überschritten?
TOM: Ich sehe das gar nicht als Gegensatzpaar. Ich setze Gewalt sehr bewusst ein, um Handlung zu beschleunigen, so, wie ein Choreograph Tanzsprünge einsetzt oder ein Maler Action Painting. Es geht mir nicht immer um ein Hinterfragen und Problematisieren á là „Gewalt ist keine Lösung“. Davon gehe ich ohnehin aus, und 99 % aller Leser ebenfalls. Aber wenn ich einen Roman wie Barbarendämmerung mache, muss die Gewalt zum Selbstzeck werden, muss sogar stellenweise zum alleinigen Inhalt heranreifen können. Ansonsten würde ich mich um das Thema der Barbarei herum mogeln, und dann braucht man ein solches Buch ja gar nicht erst zu beginnen.
bp: Kann man wirklich annehmen, dass ein Großteil der LeserInnen bei einer plakativen Gewaltdarstellung die (gewalt-)kritische Metaebene entweder schon hat oder gleich mitrezipiert? Gerade unter dem Gesichtspunkt – um einen direkten Werkbezug herzustellen – dass du in Barbarendämmerung zeigst, wie fadenscheinig die Grenzziehung zwischen „Barbarei“ und „Zivilisation“ ist, besteht doch auch immer die Gefahr, dass die unproblematisierte Darstellung von Gewalt auch aus den falschen Gründen von Lesern geschätzt werden und eine fragwürdige positive Resonanz hervorrufen könnte.
TOM: Bücher sind eine sehr abstrakte Angelegenheit. Sie können nicht so unmittelbar körperliche Reaktionen auslösen wie z. B. Musik das kann, oder auch Filme oder Computerspiele (die ja beide ebenfalls mit Musik arbeiten). Dass jemand durch das Lesen einer ausschließlich mit Buchstaben bedruckten Seite zum axtschwingenden Killer wird, ist vielleicht höchstens in einem religiös fanatisierten Kontext denkbar, bei Fantasy und anderen unterhaltsamen Abenteuerromangenres jedoch noch niemals vorgekommen. Und wenn jemand sagt: „Die Gewalt in Meißners Büchern ist geil!“, dann findet diese Begeisterung immer noch auf einer harmlosen, weil eben sehr abstrakten Ebene statt, und muss nicht sonderlich beunruhigen.
bp: Du arbeitest hauptsächlich mit männlichen Protagonisten – Frauen sind bei dir tendenziell eher Randfiguren. Liegen dir männliche Figuren eher, oder hast du das Gefühl, dass sie erzählerisch mehr Möglichkeiten bieten?
TOM: Dieser Missstand ist mir selbst schon vor zwei Jahren bewusst geworden. Deshalb gibt es in dem Manuskript, an dem ich gerade arbeite, überhaupt keine wichtige Männerfigur mehr, sondern lediglich zwei handlungstragende Frauen, in meinem nächsten Buch für Piper wird eine Frau die Protagonistin sein, und in Die Dämonen – Am Ende der Zeiten war die Hauptfigur ein Hermaphrodit, also männlich und weiblich zugleich. Man könnte sagen, da zeichnete sich der Wechsel in meinem Gesamtwerk bereits ab. Aber ich habe vor etwa zehn Jahren schon ein Hörspiel fürs DeutschlandRadio geschrieben, in dem es nur drei Figuren gab, und alle drei waren Frauen.
bp: Wenn du dazu schon was verraten willst – schreibt sich das neue Projekt mit der starken Fokussierung auf Frauenfiguren anders? Was können wir da erwarten?
TOM: Etwas sehr Heikles. Würde ich bei meinem Fokus auf Frauenfiguren die erotische Ebene ausblenden, käme ich mir wie ein Heuchler vor. Also versuche ich, aus einer erotisch faszinierten Sichtweise heraus nicht einfach nur Männerfantasien zu entwickeln, sondern so etwas wie Frauenbeunruhigungen angesichts einer männlich dominierten Perspektive zu formulieren. Klingt kompliziert und ist es auch, mal sehen, ob dabei etwas Außergewöhnliches herauskommt.
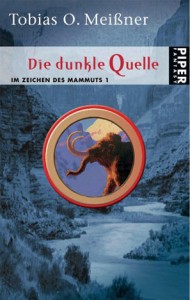 bp: Du arbeitest mit Querverweisen zwischen deinen eigenen Romanen und Zyklen, hast eine Verbindung zwischen deiner Mammut-Reihe und dem Zeitalter der Wandlung deines Kollegen Markolf Hoffmann geschaffen: Sind das Gelegenheiten, die du beim Schopfe packst, oder steckt mehr dahinter?
bp: Du arbeitest mit Querverweisen zwischen deinen eigenen Romanen und Zyklen, hast eine Verbindung zwischen deiner Mammut-Reihe und dem Zeitalter der Wandlung deines Kollegen Markolf Hoffmann geschaffen: Sind das Gelegenheiten, die du beim Schopfe packst, oder steckt mehr dahinter?
TOM: So jemanden wie Markolf Hoffmann muss man einfach am Schopfe packen, wenn er des Weges kommt, man kann ja vorher nicht wissen, dass es so ein Talent überhaupt gibt. Was Querverweise innerhalb meiner eigenen Bücher angeht, plane ich sehr langfristig. So ist Das Paradies der Schwerter beispielsweise in meinem Roman Neverwake eine Art Kultroman mit gesellschaftsrelevanten Auswirkungen. Und sogar zwischen Hiobs Spiel und Im Zeichen des Mammuts gibt es eine seit Jahrzehnten vorbereitete Verzahnung.
bp: Wenn du darüber schon etwas verraten möchtest, würde uns interessieren, wie du angesichts dessen die weitere Entwicklung des Hiobs Spiel-Zyklus planst?
TOM: Darüber möchte und kann ich eigentlich nicht allzu viel verraten, weil Hiobs Spiel außer seiner insgesamten Laufzeit von 50 Jahren keinen Regeln unterworfen sein soll. Das heißt, dass ich keine Versprechungen machen möchte, weil ich jederzeit auch wieder alles umstürzen könnte. Ich habe aber grobe thematische Abläufe für die Bände 4, 5 und 6 im Kopf. Darüberhinaus – und ob es überhaupt mehr als sechs Bücher werden – bin ich überfragt.
bp: Im Mammut spielen göttliche Eingriffe in den Weltenlauf eine große Rolle, und auch hinter Das Paradies der Schwerter steckt letztlich ein ähnliches Thema. Inwiefern reflektierst du in deinem Schreiben, dass der Autor Gott auf seiner Welt ist, oder eben Gamemaster?
TOM: Der Autor ist Gott. Es sei denn, er beschließt zu würfeln. Dann wird er zum rasenden Reporter.
bp: Für dieses schöne Schlusswort und das ganze Interview sagen wir vielen Dank!
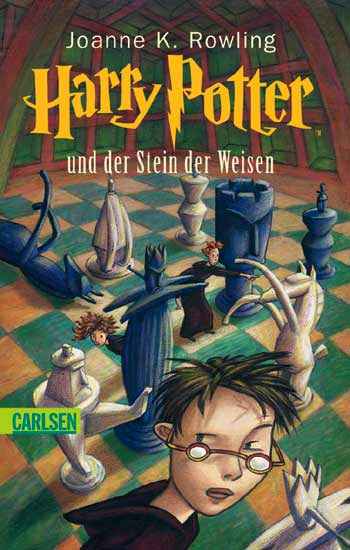 2. Harry Potter und der Stein der Weisen (J.K. Rowling)
2. Harry Potter und der Stein der Weisen (J.K. Rowling) aber gut: wenn die Zwerge zum Kaffeetrinken (!) bei Bilbo Beutlin vorbeikommen, wünschen sie sich Rotwein, Himbeermarmelade, Eier, Apfeltörtchen, Rosinenkuchen, Essiggurken, Käse, Pasteten, Salat, kaltes Hühnchen, „und noch ein paar Kuchen“. Dass mir auch dabei der Mund wässrig wird, zeigt deutlich, dass Fantum auch ungesunde Züge annehmen kann.
aber gut: wenn die Zwerge zum Kaffeetrinken (!) bei Bilbo Beutlin vorbeikommen, wünschen sie sich Rotwein, Himbeermarmelade, Eier, Apfeltörtchen, Rosinenkuchen, Essiggurken, Käse, Pasteten, Salat, kaltes Hühnchen, „und noch ein paar Kuchen“. Dass mir auch dabei der Mund wässrig wird, zeigt deutlich, dass Fantum auch ungesunde Züge annehmen kann.