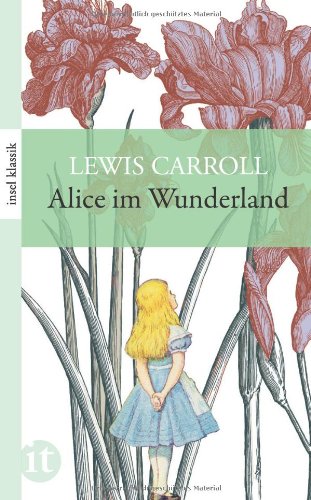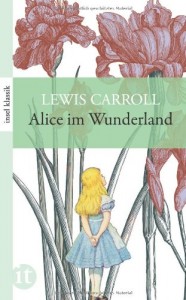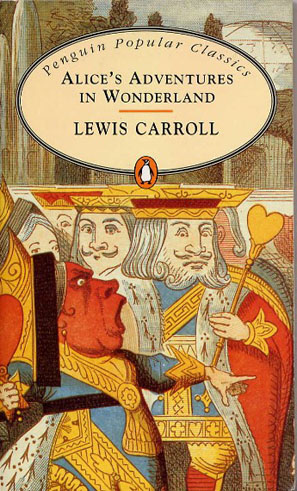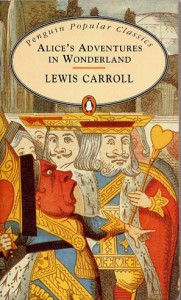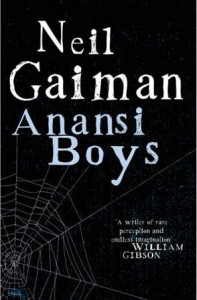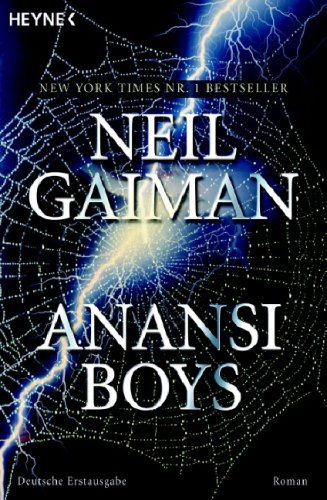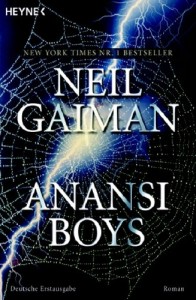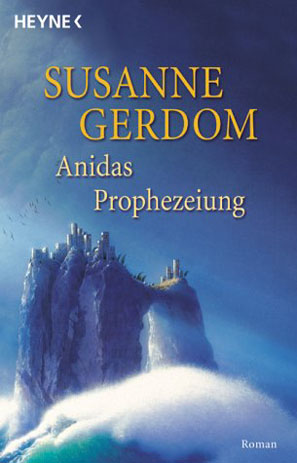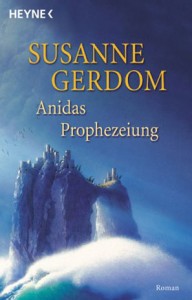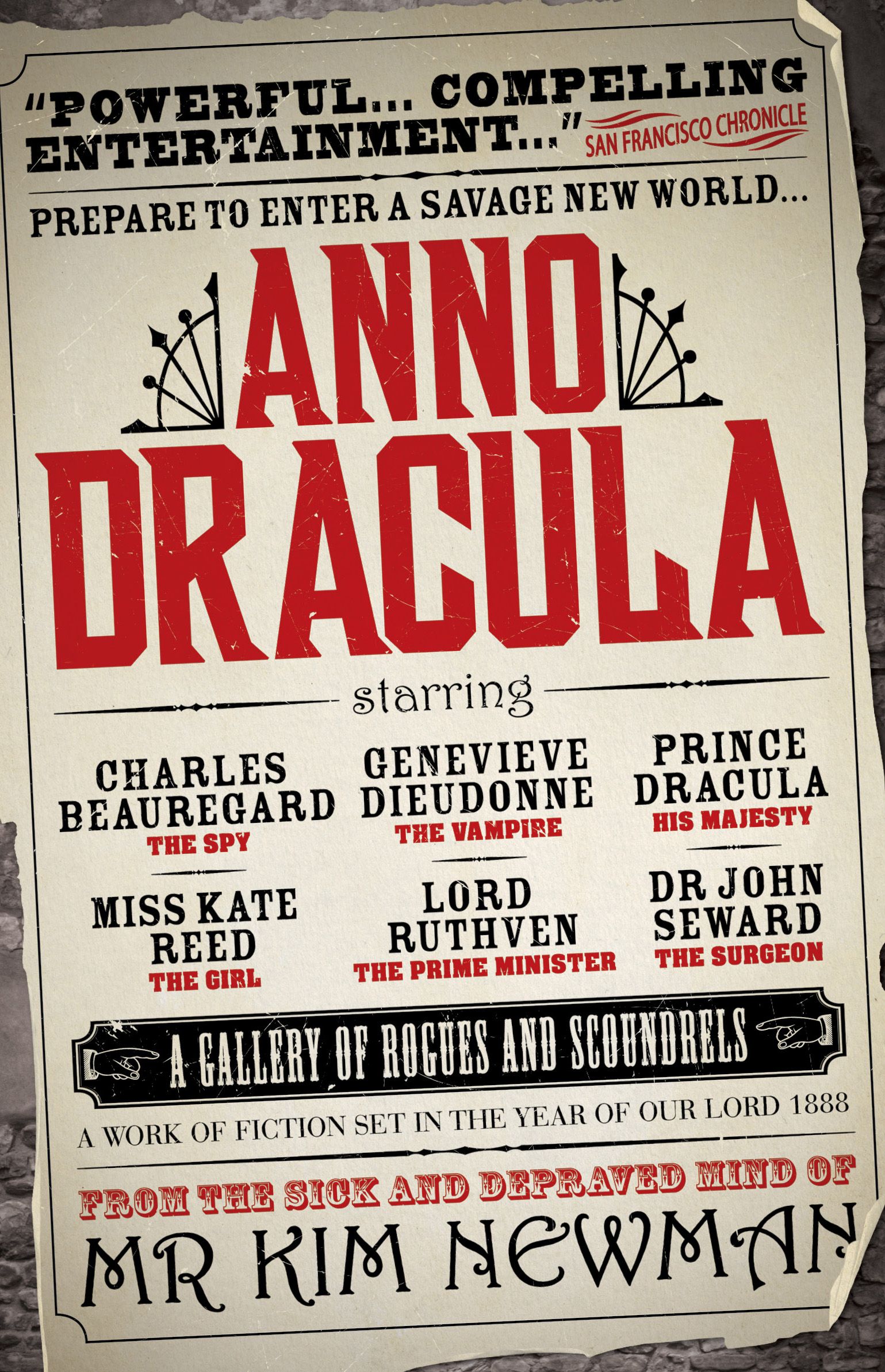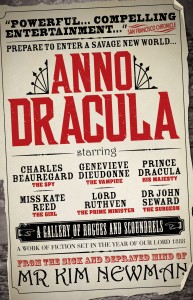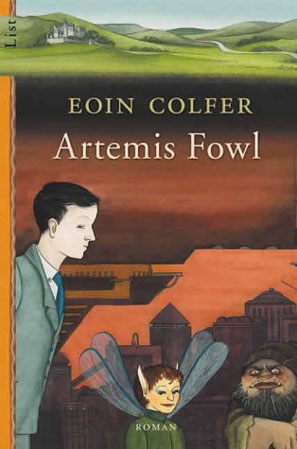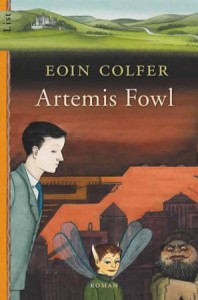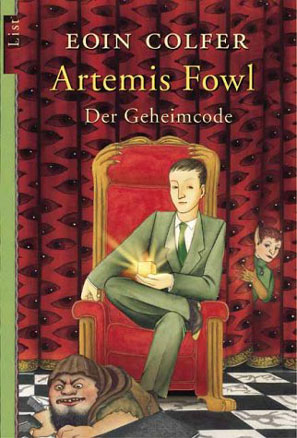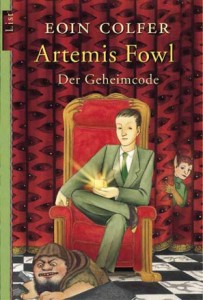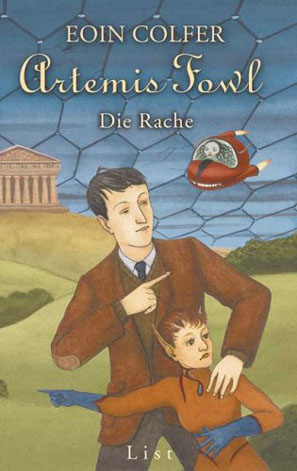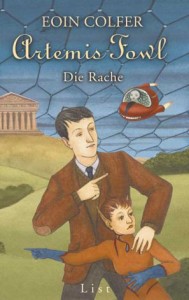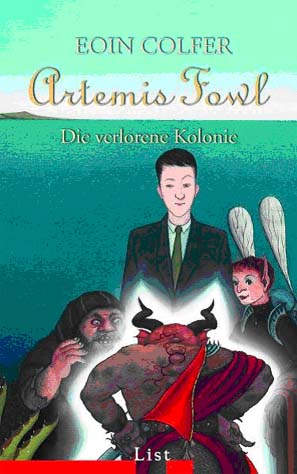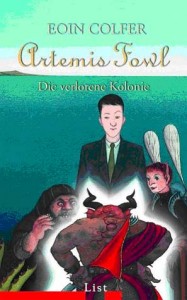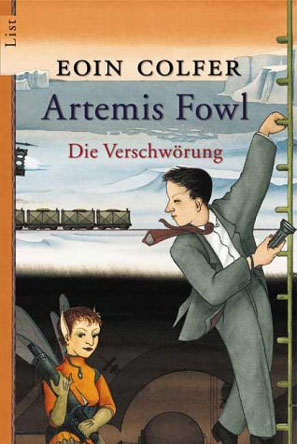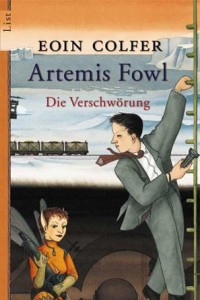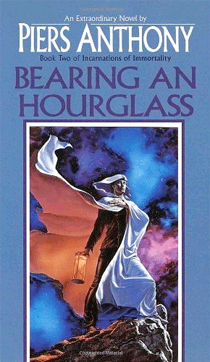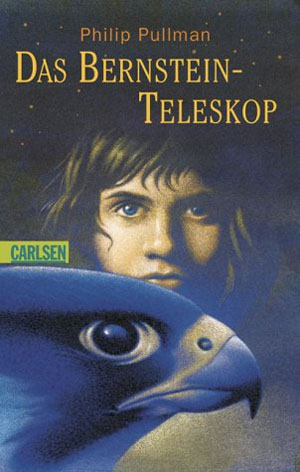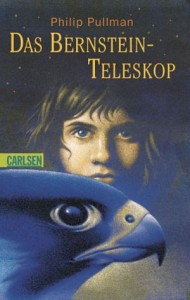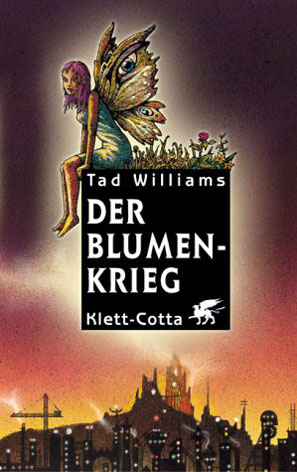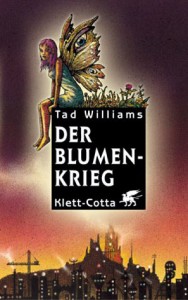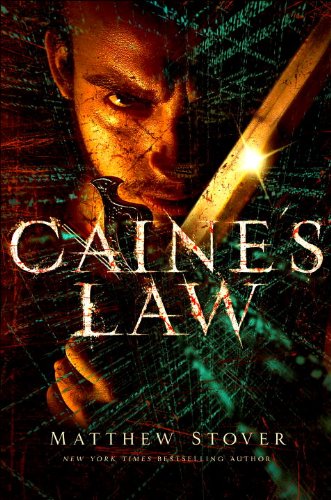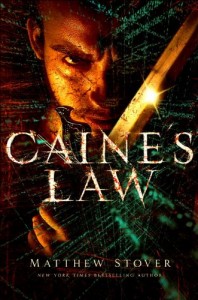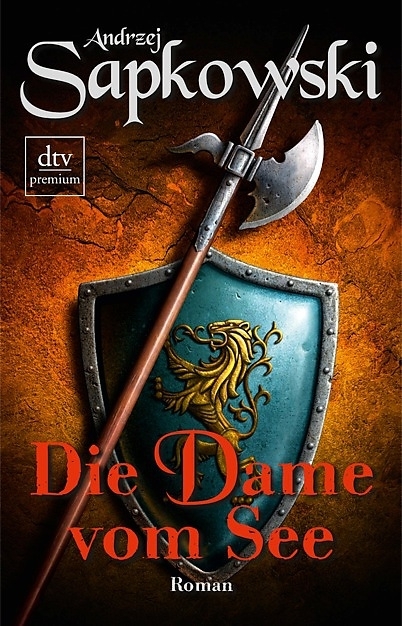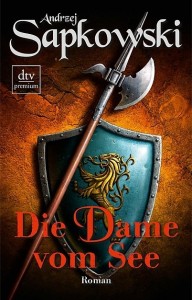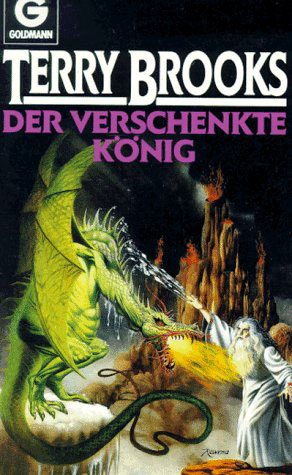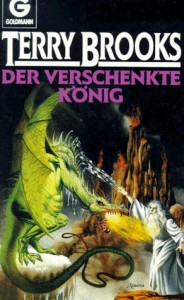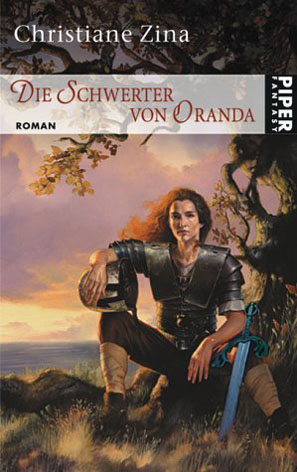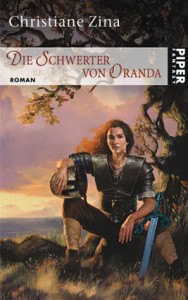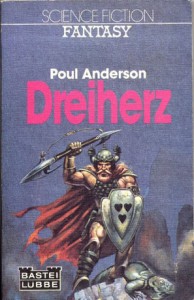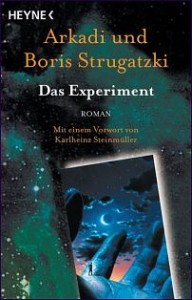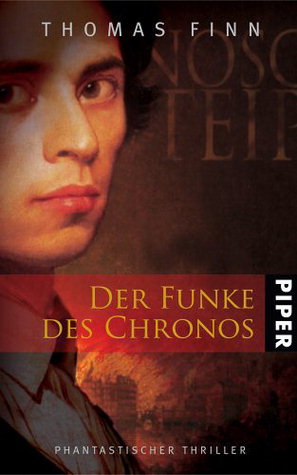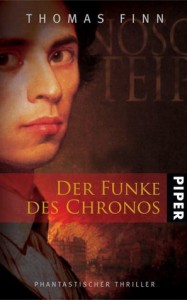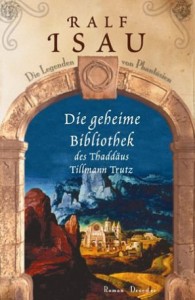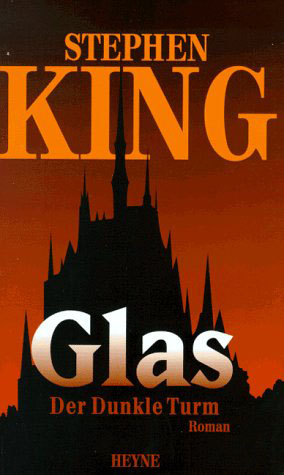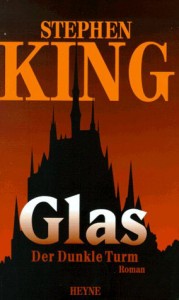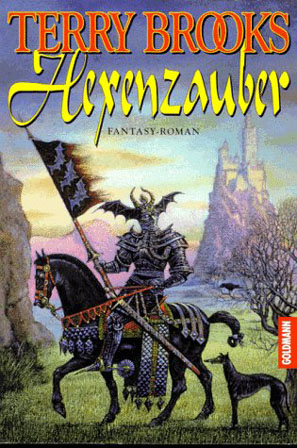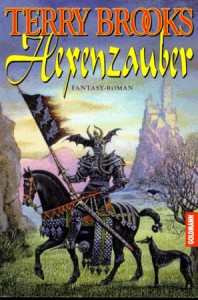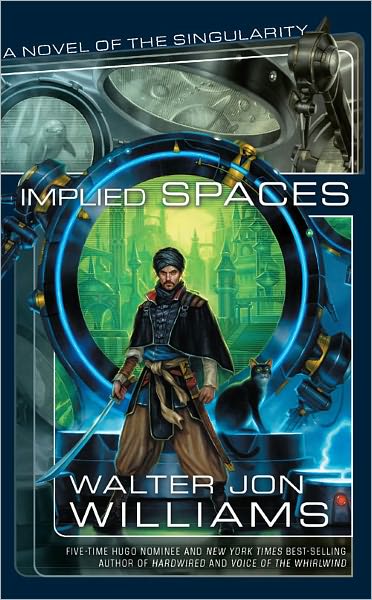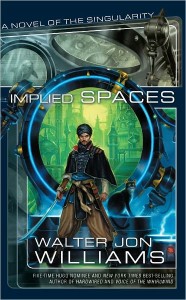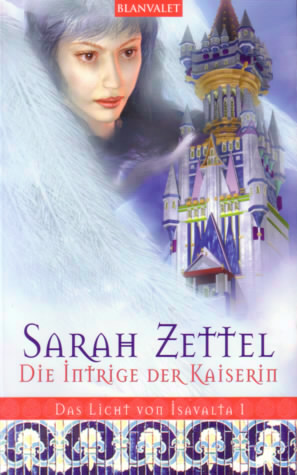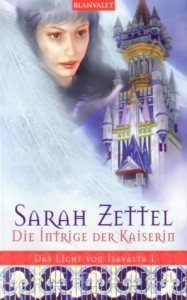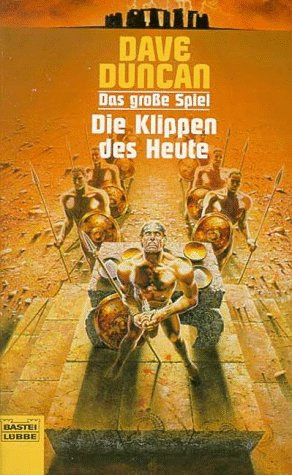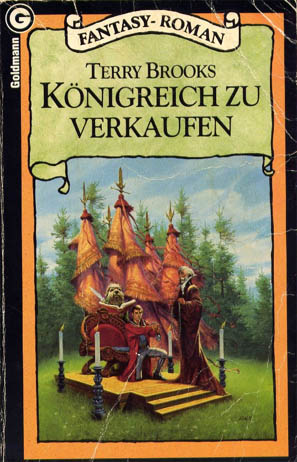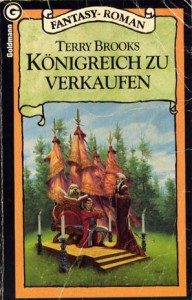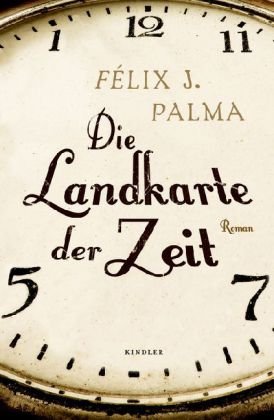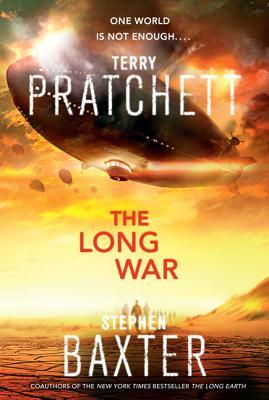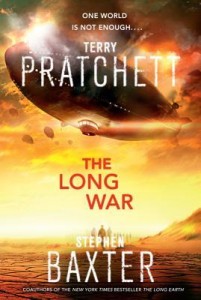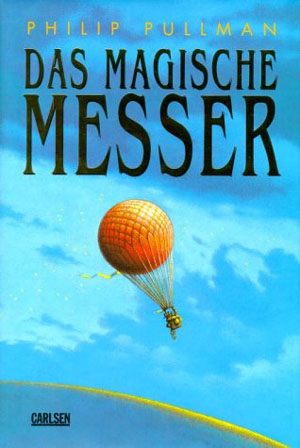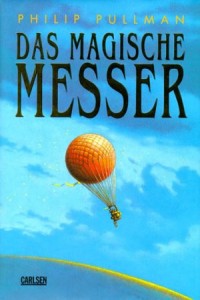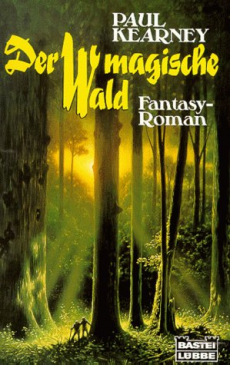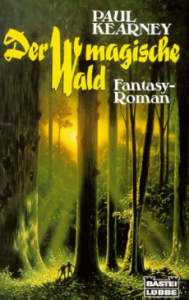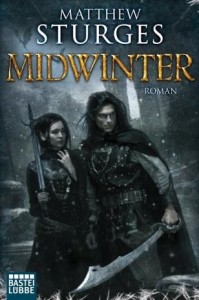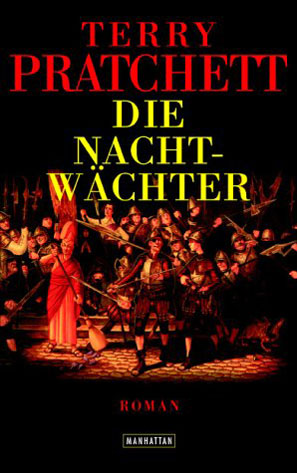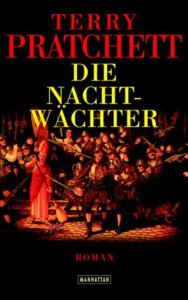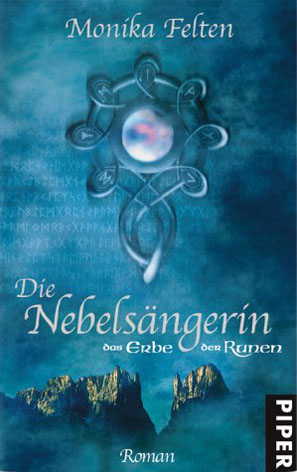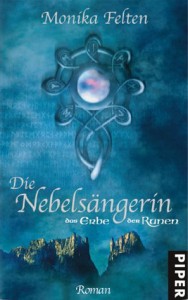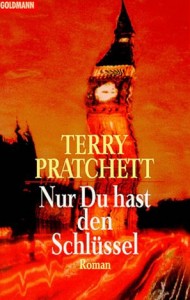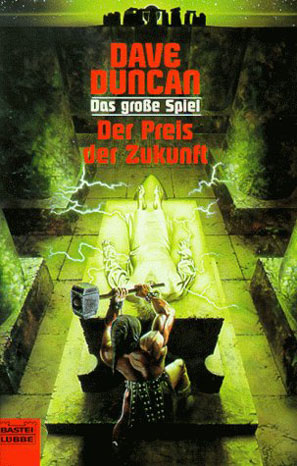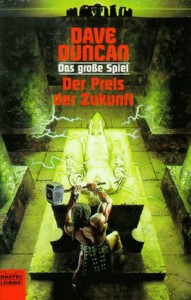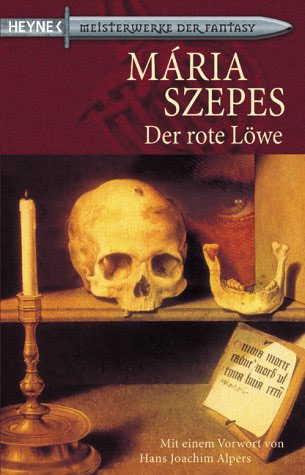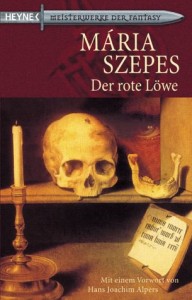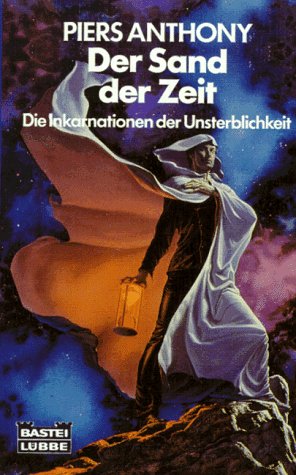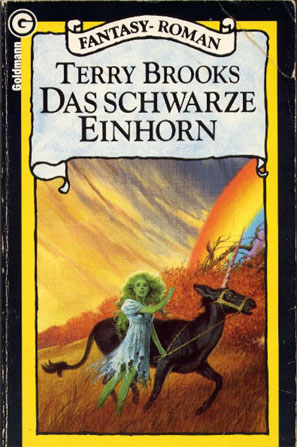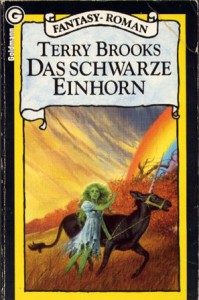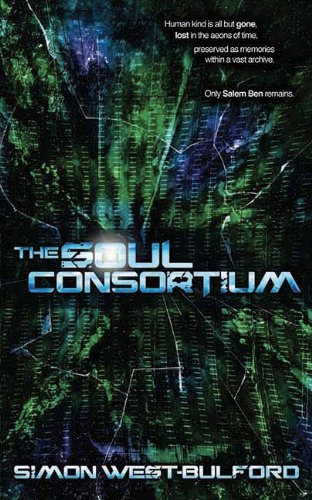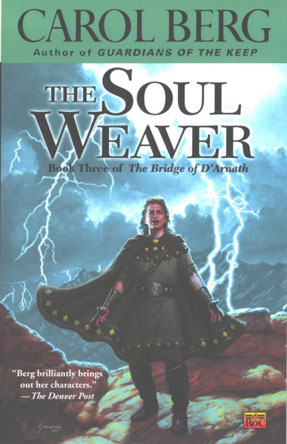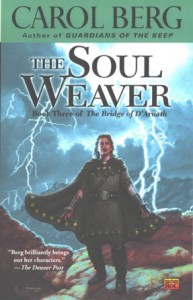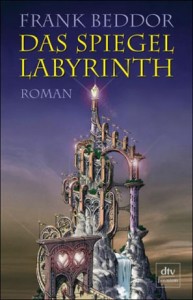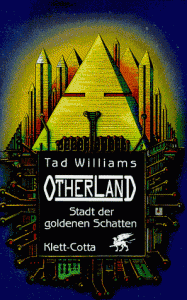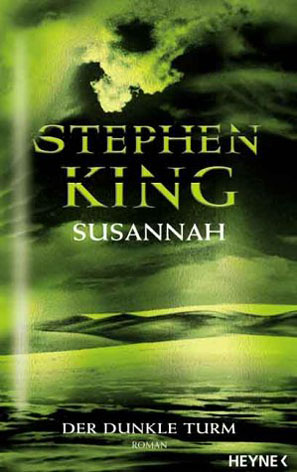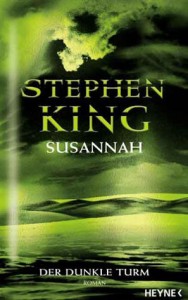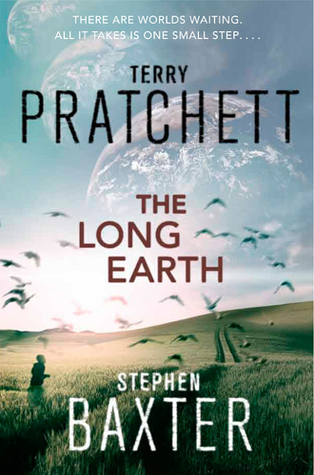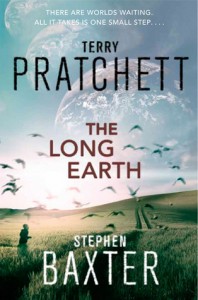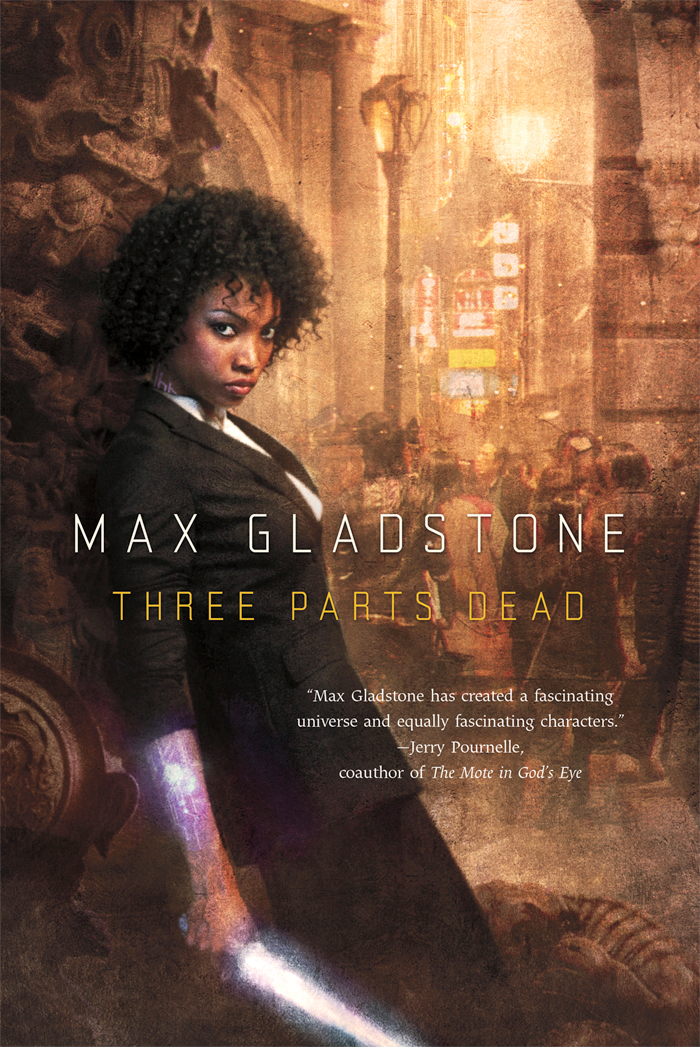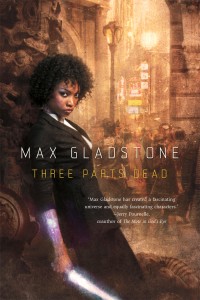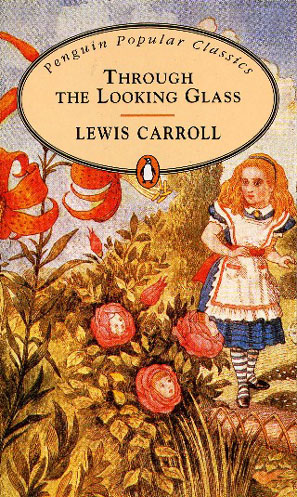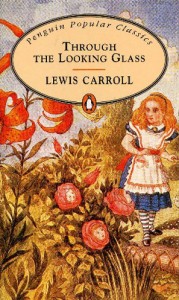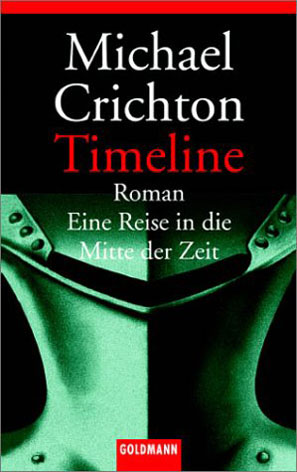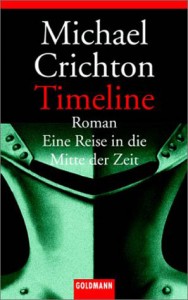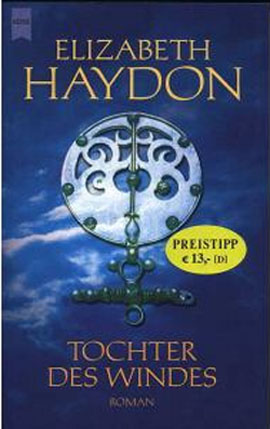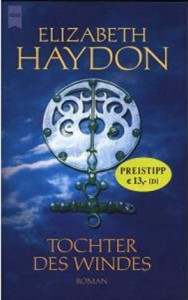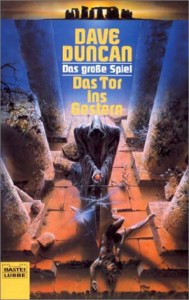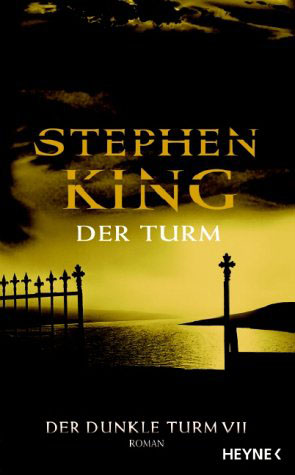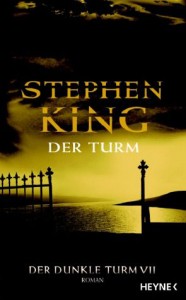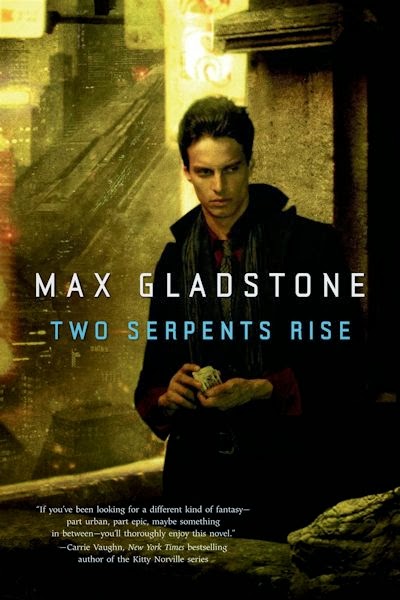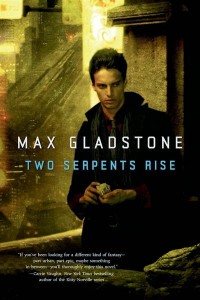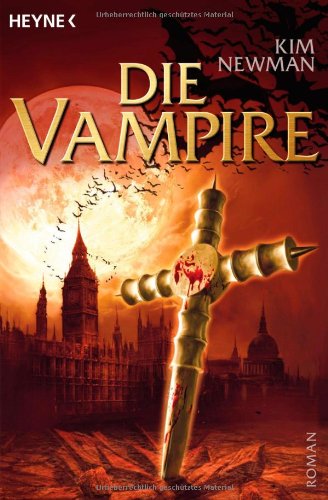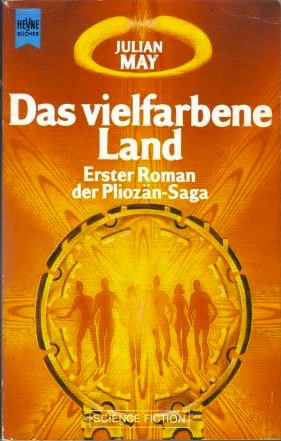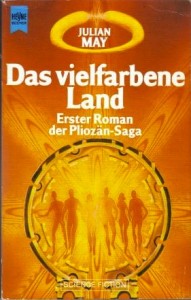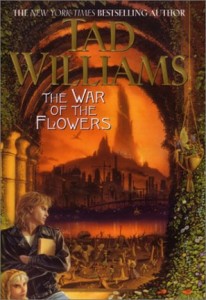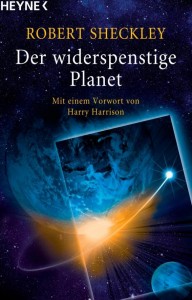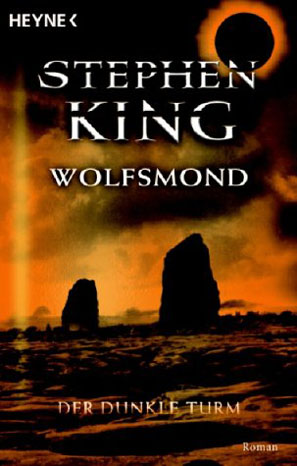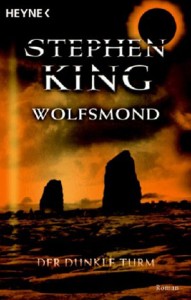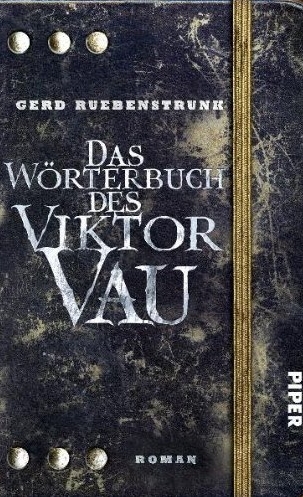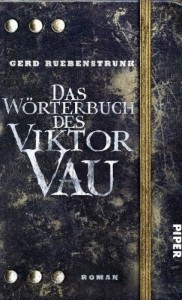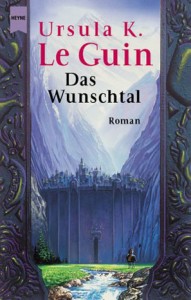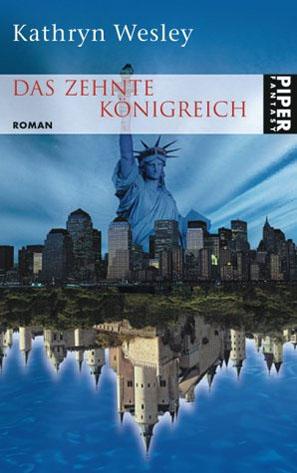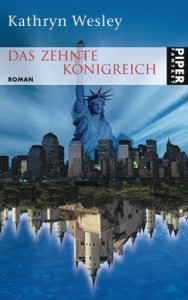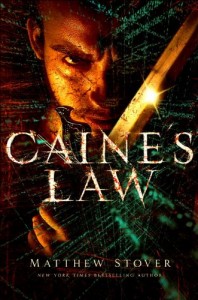 Wieder einmal ist Caine ganz unten: In den Händen der Regierung, ohne Zugriff auf Overworld und seine dortigen Kräfte, verkrüppelt, an ein Bett gefesselt – und seine Peiniger haben noch Schlimmeres mit ihm vor, während in seiner Wahlheimat Overworld die Erde ihren Einfluss wieder erhöht und die Dinge zum Schlechten stehen. Caine macht der Erdregierung ein Angebot, das sie leider ohne mit der Wimper zu zucken ablehnt, und ab diesem Zeitpunkt reißen die Merkwürdigkeiten nicht mehr ab …
Wieder einmal ist Caine ganz unten: In den Händen der Regierung, ohne Zugriff auf Overworld und seine dortigen Kräfte, verkrüppelt, an ein Bett gefesselt – und seine Peiniger haben noch Schlimmeres mit ihm vor, während in seiner Wahlheimat Overworld die Erde ihren Einfluss wieder erhöht und die Dinge zum Schlechten stehen. Caine macht der Erdregierung ein Angebot, das sie leider ohne mit der Wimper zu zucken ablehnt, und ab diesem Zeitpunkt reißen die Merkwürdigkeiten nicht mehr ab …
“Two things I do,” she repeated. She touched her cheek below the brown eye. “Forgiveness.” She moved the hand to the ice-milk side. “Permission.”
The horse-witch: Feral
Drei Bände lang hat Caine gewütet und gemetzelt, hat skrupellose Gegner bekämpft, indem er noch weniger Skrupel hatte als sie, und nun, in Caine’s Law, dem zweiten Teil der mit Act of Atonement untertitelten Sub-Serie, soll er schließlich doch die Konsequenzen zu spüren bekommen und sühnen. Der nur vordergründig einfach gestrickte Haudrauf wird auf den Boden geholt, nicht nur durch die Ereignisse und seine Ermattung, was Kämpfe und Konflikte angeht, sondern vor allem durch die vielen Rückblicke, die wie schon in den vorausgegangenen Bänden erklären, wer er ist, und einen Mann mit vielen Schichten offenbaren. Ein häufig erwähnter Schlüsselsatz fasst sowohl die Figur als auch den ganzen Roman famos zusammen: »It’s complicated.«
Caine’s Law ist eine strukturell herausfordernde Lektüre – sie bietet keine lineare Erzählung, sondern springt zwischen Zeit- und Möglichkeitsebenen hin und her, stellt einen netten Warnhinweis voraus, dass es sich dabei teilweise nur um bald wieder ungeschehen gemachte Varianten der Ereignisse handelt, und man darf sich selbst zusammenpuzzeln, wie die einzelnen Kapitel zu ordnen sind, häufig nur von kleinen Hinweisen unterstützt. Aber erfahrene Caine-LeserInnen kann ohnehin nichts mehr schocken, und mit etwas Zutrauen in die Fähigkeit von Matthew Stover, einen am Ende nicht im Regen stehen zu lassen, stellt sich bald trotzdem eine Art Linearität ein, denn die Kapitel sind, auch wenn es anfangs anders scheinen mag, mitnichten zufällig angeordnet. Kausalitäten lassen sich herstellen, und letztlich gibt es tatsächlich einen sehr befriedigenden und überraschenden Blick auf das ganze Mosaikbild, das man sich beim Lesen erarbeitet hat, auch wenn es unterwegs ein ausgesprochen wilder Ritt mit wohlplatzierten Stolpersteinen aus dem Zeitreiseparadoxon-Baukasten war. Das Spiel mit der Fiktionalität, das stets ein hintergründiger Bestandteil der Caine-Reihe war, wird dadurch auf eine andere Ebene gehievt, auch wenn Caine nun schon lange nicht mehr »Entertainer Michaelson« ist.
Manch ein Kapitel wird man in diesem raffinierten Puzzle vielleicht zweimal lesen wollen, denn fast in jedem Abschnitt kommt es zu einer bahnbrechenden Erkenntnis, die das Vorausgegangene infrage stellt, und man erlebt einige erschütternde Überraschungen, in denen aus Grandiosität und Glanz plötzlich das Elend dahinter auf erschreckende Weise hervorbricht.
Mit überraschenden Erzählerfiguren, Bezugnahme auf alle drei Vorgänger, auf die menschliche Geistesgeschichte und die Mythen führt Stover Konzepte und Figuren aus 15 Jahren Caine zu einem kohärenten Ganzen zusammen, und das in einem ranken und schlanken Stil, der im Verlauf dieser Jahre noch um einiges präziser und fokussierter geworden ist: So schillernd und wild flatternd Caine’s Law auf den ersten Blick auch wirkt, hier gibt es keine Schlenker, jeder Satz sitzt und leistet seinen Beitrag zu einer Geschichte, die Figur und Mythos verwebt und es tatsächlich schafft, ein Sühne-Epos zu erzählen, das sich von den meist christlich konnotierten Begriffen lösen kann.
Caines Suche nach Erlösung ist eng verwoben mit einer faszinierenden Frauenfigur, die die Vorzüge, die bereits Stovers frühere weibliche Charaktere auszeichneten, zur vollen Entfaltung bringen kann und Stärke, leisen Humor, Tragik und einen wunderbaren Ruhepol in die Geschichte einbringt. Stover kann sein Talent für die realistische Beschreibung von Beziehungen vorführen und stellt einem der ambivalentesten Protagonisten der Science Fiction und Fantasy damit eine der coolsten Frauenfiguren zur Seite, an der alle Klischees auf eine Art und Weise abperlen, dass es eine wahre Freude ist.
Die Schuld-und-Sühne-Frage wird in Caine’s Law auf vielen Ebenen gestellt, es werden mannigfaltige Verhältnisse beleuchtet, in denen sie aufkommt – gesellschaftliche, familiäre, religiöse und ganz persönliche – doch der Fokus bewegt sich trotz wechselnder Perspektiven nie weit weg von Caine, dem Über- und Unmenschen, der menschlicher wird, je mehr er sich in die Angelegenheiten der Götter verstrickt. Die Figur, die in Caine Black Knife noch filetiert wurde, wird hier zu einem neuen Ganzen zusammengesetzt, und am Ende hat Caine das getan, was Antihelden seit jeher besser können als ihre strahlenden Gegenparts: uns etwas über das Menschsein beigebracht.
Auch wenn Caine’s Law die ausufernde Breite von Blade of Tyshalle fehlt, ist es doch ein mindestens ebenso philosophischer Roman, der sich mit der Ordnung der Welt, Macht, Göttlichkeit und Menschlichkeit, letzten Dingen und dem guten Leben (und den Gründen, weshalb es meist ein frommer Wunsch bleiben muss) befasst. Dass das Ganze nicht ohne Blutvergießen geliefert wird, weiß vermutlich jeder, der bis hierher durchgehalten hat. Der neue Caine ist vielleicht etwas zurückgenommener, dafür sind die Gewaltspitzen nur umso verstörender, und es entspricht der Philosophie hinter Caine’s Law (und eigentlich allen Caine-Geschichten), dass es keine Option ist, wegzuschauen, auszublenden oder trotzdem gut zu finden, sondern man die Gewalt im Kern der Handlung mit offenen Augen wahrnehmen und akzeptieren muss.
Nach diesem Entwurf, der größer ist als alles, was auf Overworld und der Erde bisher da war, ist das Ende – wieder einmal – ziemlich definitiv, bringt alles (aufgrund der besonderen Struktur des Romans sogar augenzwinkernd) zusammen und liefert Erklärungen für die wilderen Konzepte der Handlung, auch wenn die Schlüsse, die man daraus ziehen kann, immer den LeserInnen überlassen bleiben.
Da bisher jeder Roman außer Caine Black Knife der letzte Caine-Roman war, muss das nicht viel heißen. Allerdings war die Reihe nie ein großer Erfolg, und Caine’s Law ist bestimmt nicht dazu angetan, diesen Erfolg herbeizuführen, daher kann man sich im Augenblick nur schwer vorstellen, dass der vom Autor angedachte darauffolgende Act of Faith je das Licht einer Buchhandlung erblickt. Andererseits: Ist es nicht genauso schwer, sich vorzustellen, dass Caine nach allem, was wir erlebt haben, wirklich erlöst sein soll?
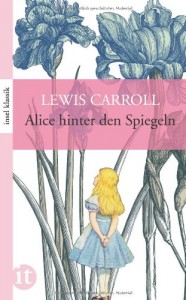 Im Spiel mit ihrem kleinen schwarzen Kätzchen vertieft, überlegt das Mädchen Alice sich, wie lustig es auf der anderen Seite des Spiegels wohl sein mag, und so geht sie durch diesen ins Spiegelhaus. Sich dort umschauend sieht sie, wie die Figuren des Schachspiels lebendig werden. Auch sonst ist einiges sonderbar, und Alice beschließt sich den Garten anzusehen, was ihr zunächst sehr schwer fällt, da die Wege vom Haus weg zum Haus hinführen. Erst nach einigen Anstrengungen kann sie dem Haus entkommen. Im Garten trifft sie auf die Schwarze Königin, die dem Mädchen erklärt, wie es vom Bauern zur Königin werden kann. Alice nimmt die Herausforderung an und beginnt eine höchst bizarre Reise…
Im Spiel mit ihrem kleinen schwarzen Kätzchen vertieft, überlegt das Mädchen Alice sich, wie lustig es auf der anderen Seite des Spiegels wohl sein mag, und so geht sie durch diesen ins Spiegelhaus. Sich dort umschauend sieht sie, wie die Figuren des Schachspiels lebendig werden. Auch sonst ist einiges sonderbar, und Alice beschließt sich den Garten anzusehen, was ihr zunächst sehr schwer fällt, da die Wege vom Haus weg zum Haus hinführen. Erst nach einigen Anstrengungen kann sie dem Haus entkommen. Im Garten trifft sie auf die Schwarze Königin, die dem Mädchen erklärt, wie es vom Bauern zur Königin werden kann. Alice nimmt die Herausforderung an und beginnt eine höchst bizarre Reise…