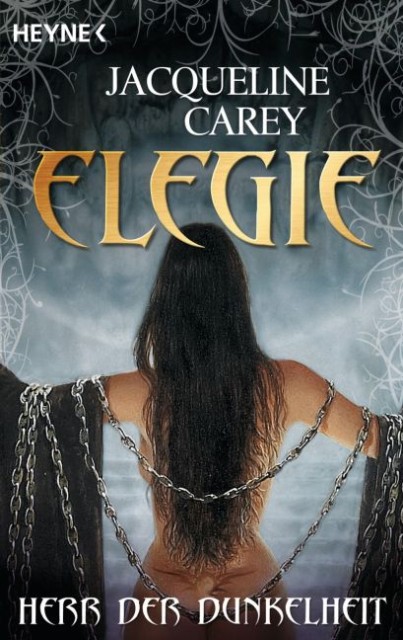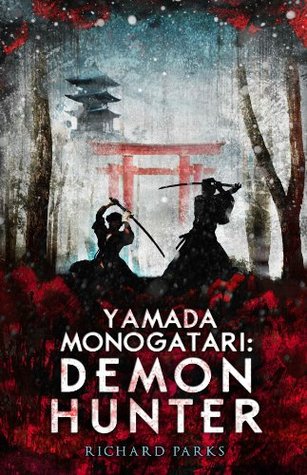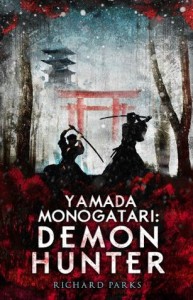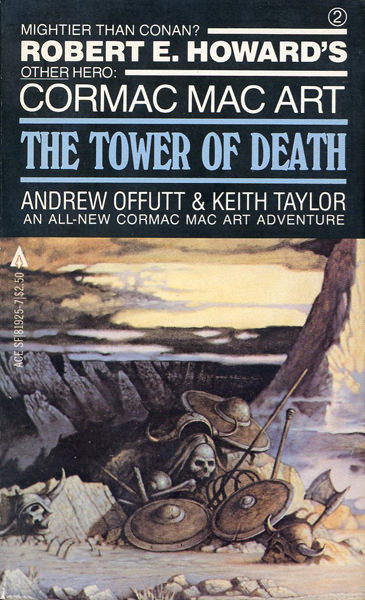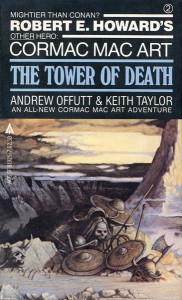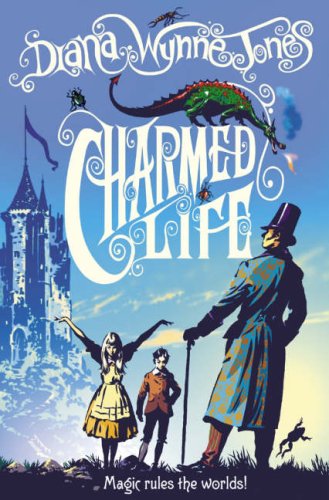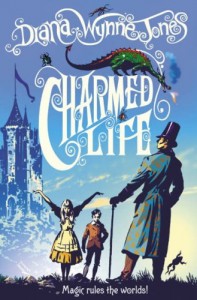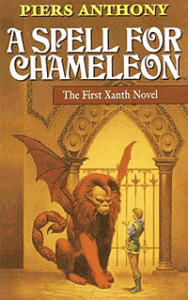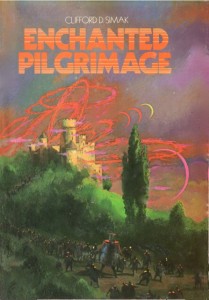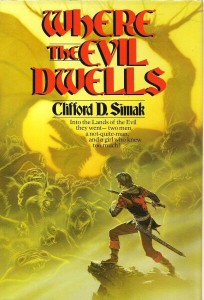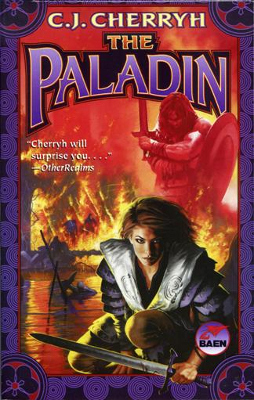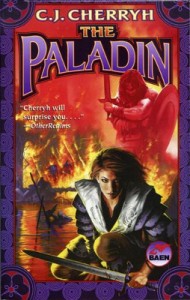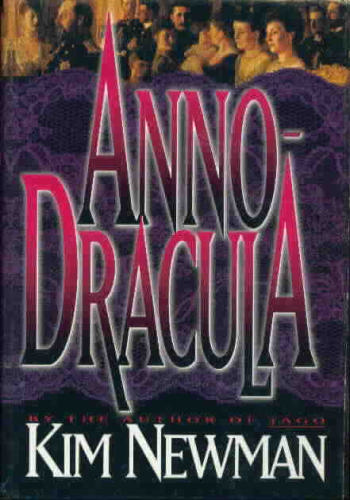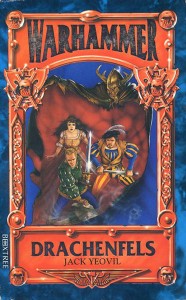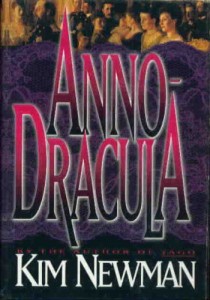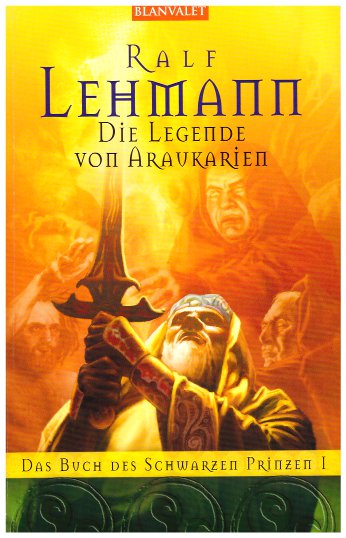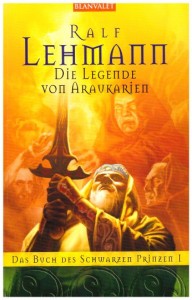Bibliotheka Phantastika erinnert an Clifford D. Simak, dessen Geburtstag sich heute zum 110. mal jährt. Man darf den am 03. August 1904 in Milville, Wisconsin, geborenen Clifford Donald Simak gewiss zu den Großen der amerikanischen SF zählen, dessen Werke viele Jahre lang mit schöner Regelmäßigkeit ins Deutsche übersetzt wurden, auch wenn sie heute – gut 26 Jahre nach seinem Tod am 25. April 1988 – mit einer Ausnahme nur noch antiquarisch erhältlich sind. Die Romane und Geschichten, die Simak im Laufe seiner mehr als 50 Jahre dauernden Karriere geschaffen hat, bieten eine etwas andere SF als man sie – nicht zuletzt in Anbetracht der Zeit, in der sie entstanden sind – vielleicht erwarten könnte, denn in ihnen geht es kaum einmal um galaktische Imperien, Raumschlachten oder riesige Raumschiffe; statt dessen stehen in ihnen häufig ländliche Gebiete im Mittelpunkt (für die sein heimatliches Wisconsin Pate stand – wenn sie nicht gleich dort spielten), in die der technische Fortschritt noch nicht vorgedrungen oder über die er bereits hinweggegangen ist. Das lässt seine Werke – vor allem, von heute aus betrachtet – ein bisschen altmodisch wirken, und man muss sich auf sie bzw. ihren oft leicht elegischen Ton einlassen, wenn man City, das fix-up aus in den 40er Jahren entstandenen Geschichten (1952, erw. 1981; dt. Als es noch Menschen gab (zuletzt 2010)) oder Romane wie Time and Again (1951; dt. Tod aus der Zukunft (1961, NÜ 1974)), den Hugo-Gewinner Way Station (1963; dt. Raumstation auf der Erde (1964)), A Choice of Gods (1972; dt. Die letzte Idylle (1973)) oder A Heritage of Stars (1977; dt. Ein Erbe der Sterne (1980)) – um nur einige wenige zu nennen – genießen will.
Simak hat in seiner SF nie auf technische Gimmicks gesetzt; in den späten 60er Jahren hat er dann angefangen, ein bisschen mit Fantasy bzw. Phantastik zu flirten und phantastische Elemente in seine SF einzubetten, z.B. in The Werewolf Principle (1967; dt. Mann aus der Retorte (1968)), wo die Fähigkeit des Gestaltwandelns als PSI-Talent erklärt wird, oder in The Goblin Reservation (1968; dt. Die Kolonie der Kobolde (1969)), wo in einer fernen Zukunft die Existenz von Geistern, Trollen und Kobolden wissenschaftlich anerkannt ist, oder in Out of Their Minds (1970; dt. Verteufelte Welt (1971)), wo durch den Glauben der Menschen eine Fantasywelt geschaffen wird, deren – ebenso ausgedachter – Teufel mit der Entwicklung der Menschheit bzw. deren Interessen nicht so ganz einverstanden ist. In Anbetracht dieser Werke und angesichts der Tatsache, dass Simaks Protagonisten sich bereits in einigen SF-Romanen auf eine Suche begeben mussten – häufig in interessanter, nicht nur menschlicher Gesellschaft –, ist es nicht weiter verwunderlich, dass er sich im Herbst seiner Karriere auch der Fantasy zugewandt hat und drei – nun gut, zweieinhalb – “richtige” Fantasyromane geschaffen hat, die alle eine klassische Queste behandeln.
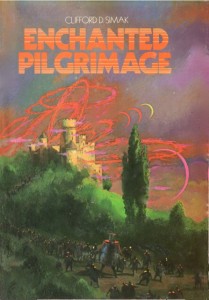 Den Anfang machte Enchanted Pilgrimage (1975; dt. Marc Cornwalls Pilgerfahrt (1977)), die Geschichte des Scholaren Marc Cornwall, der in einer mittelalterlichen Parallelwelt lebt, die sich irgendwann von unserer Welt abgespalten hat, und in der nicht nur all die Wesen leben, die man bei uns aus Sagen und Legenden kennt, sondern auch Magie und Zauberei den Platz einnehmen, den bei uns Naturwissenschaft und Technik haben. Besagter Marc Cornwall entdeckt in einem alten Folianten den Reisebericht eines Mannes, der die Wastelands erkundet hat, in denen schreckliche Bestien und böse Mächte hausen – aber das wirklich Interessante ist die Bibliothek, die jenseits der Wastelands liegen soll. Marc ist durch und durch ein Scholar, und so ist es kein Wunder, dass er sich – begleitet von seinem Dachkobold – aufmacht, die Bibliothek zu finden. Schon bald schließen sich ihnen weitere Gefährten auf ihrer Queste an, die sie tief in die Wastelands führt, und an deren Ende sie etwas ganz anderes finden als erwartet … Man muss Clifford D. Simak vielleicht zugute halten, dass Enchanted Pilgrimage sein erster richtiger Fantasyroman und das Genre für ihn noch Neuland war, denn so lässt sich am ehesten erklären, warum sich allmählich Hinweise auf einen SF-Hintergrund in die ansonsten auf typische Fantasyelemente wie Riesen, magische Schwerter und heilende Einhorn-Hörner etc.pp. zurückgreifende Queste mischen, bis schließlich Dinge auftauchen, die eindeutig dem Instrumentarium der SF zuzurechen sind. Ob diese Mischung funktioniert, sollte jeder Leser für sich entscheiden.
Den Anfang machte Enchanted Pilgrimage (1975; dt. Marc Cornwalls Pilgerfahrt (1977)), die Geschichte des Scholaren Marc Cornwall, der in einer mittelalterlichen Parallelwelt lebt, die sich irgendwann von unserer Welt abgespalten hat, und in der nicht nur all die Wesen leben, die man bei uns aus Sagen und Legenden kennt, sondern auch Magie und Zauberei den Platz einnehmen, den bei uns Naturwissenschaft und Technik haben. Besagter Marc Cornwall entdeckt in einem alten Folianten den Reisebericht eines Mannes, der die Wastelands erkundet hat, in denen schreckliche Bestien und böse Mächte hausen – aber das wirklich Interessante ist die Bibliothek, die jenseits der Wastelands liegen soll. Marc ist durch und durch ein Scholar, und so ist es kein Wunder, dass er sich – begleitet von seinem Dachkobold – aufmacht, die Bibliothek zu finden. Schon bald schließen sich ihnen weitere Gefährten auf ihrer Queste an, die sie tief in die Wastelands führt, und an deren Ende sie etwas ganz anderes finden als erwartet … Man muss Clifford D. Simak vielleicht zugute halten, dass Enchanted Pilgrimage sein erster richtiger Fantasyroman und das Genre für ihn noch Neuland war, denn so lässt sich am ehesten erklären, warum sich allmählich Hinweise auf einen SF-Hintergrund in die ansonsten auf typische Fantasyelemente wie Riesen, magische Schwerter und heilende Einhorn-Hörner etc.pp. zurückgreifende Queste mischen, bis schließlich Dinge auftauchen, die eindeutig dem Instrumentarium der SF zuzurechen sind. Ob diese Mischung funktioniert, sollte jeder Leser für sich entscheiden.
In The Fellowship of the Talisman (1978) dt. Die Brüderschaft vom Talisman (1979) bzw. Die Bruderschaft des Talisman (überarb. NA, 1987)) lassen sich zwar ebenfalls (allerdings nur schwache) SF-Einflüsse finden, aber vor allem schildert der Roman eine ziemlich traditionelle – um nicht zu sagen generische – Fantasyqueste (die natürlich zum Zeitpunkt seiner Entstehung noch nicht annähernd so traditionell oder generisch war). Auch dieses Mal geht es um ein Manuskript, das auf einer Welt, die durch die ständigen Überfälle und Invasionen der abgrundtief bösen Harriers gesellschaftlich und technologisch auf einem mittelalterlichen Level verharrt, aus dem Norden Englands nach Oxenford gebracht werden muss – eine Aufgabe, die dem jungen Adligen Duncan Standish zufällt. Und natürlich muss er diese Aufgabe nicht allein erfüllen, sondern mit einer bunt gemischten Gruppe (keineswegs nur menschlicher) Gefährten an seiner Seite, deren Unterstützung der etwas naive Duncan auch dringend braucht, denn es gilt, die Forlorn Lands zu durchqueren, in denen die Harriers ihr Unwesen treiben … Während die Queste an sich wenig Neues bietet, macht es durchaus Spaß, den unterschiedlichen Wesen in Duncans Gruppe dabei zuzusehen, wie sie sich mehr und mehr kennen- und dabei schätzen lernen, nicht zuletzt, weil auch die merkwürdigsten von ihnen von Simak auf überaus warmherzige und humorvolle Weise geschildert werden.
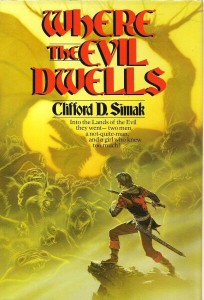 Auch Where the Evil Dwells (1982; dt. Im Land der Drachen (1984)) weist ein paar Gemeinsamkeiten mit den beiden vorangegangenen Fantasyromanen Simaks auf, etwa eine Welt, die nicht ganz die unsere ist, oder ein dieses Mal Empty Lands genannter Landstrich, in dem – wie es der Titel schon sagt – das Böse haust, doch auffälliger sind die Unterschiede. Da wäre zum einen die wesentlich düsterere Atmosphäre, die den ganzen Roman durchzieht, oder die Tatsache, dass sich eine nur aus Menschen (wenn man den Begriff ein bisschen streckt) bestehende kleine Gruppe in die Länder des Bösen aufmacht, oder auch das Böse selbst, das sich aus allen nichtmenschlichen Wesen aus unseren Sagen und Legenden bis hin zu Feen und Einhörnern zusammensetzt. In dieser Welt ist das Römische Reich (letztlich ironischerweise dank des Bösen) nie untergegangen, wird aber weiterhin vom Bösen bedroht und wankt unter dem Ansturm. Deswegen zögert der junge Adlige Charles Harcourt keinen Augenblick, in die Empty Lands aufzubrechen, als er von seinem Onkel erfährt, dass sich dort nicht nur seine seit langem verschollene große Liebe sondern auch Lasandras Prisma befinden soll, das der Legende nach die Seele eines Heiligen enthält. Letzteres ist für den Abt Guy Grund genug, sich Charles anzuschließen, dessen alter Freund, der geheimnisvolle Knurly Man, natürlich ebenfalls mitkommt (und mit seinen theologischen Streitgesprächen mit dem Abt einen wesentlichen Anteil an der Unterhaltsamkeit der Queste hat). Die Vierte im Bunde ist die Waise Yolanda, die über einige merkwürdige Fähigkeiten verfügt. Die Queste selbst verläuft nach dem üblichen Muster – die Gefährten müssen sich zusammenraufen, um die Gefahren, denen sie sich gegenübersehen, zu überstehen (wobei die Schrecknisse in den Empty Lands deutlich größer als die in den verheerten Gebieten der beiden anderen Romane sind) – und auch das Ende bietet letztlich das erwartet Unerwartete.
Auch Where the Evil Dwells (1982; dt. Im Land der Drachen (1984)) weist ein paar Gemeinsamkeiten mit den beiden vorangegangenen Fantasyromanen Simaks auf, etwa eine Welt, die nicht ganz die unsere ist, oder ein dieses Mal Empty Lands genannter Landstrich, in dem – wie es der Titel schon sagt – das Böse haust, doch auffälliger sind die Unterschiede. Da wäre zum einen die wesentlich düsterere Atmosphäre, die den ganzen Roman durchzieht, oder die Tatsache, dass sich eine nur aus Menschen (wenn man den Begriff ein bisschen streckt) bestehende kleine Gruppe in die Länder des Bösen aufmacht, oder auch das Böse selbst, das sich aus allen nichtmenschlichen Wesen aus unseren Sagen und Legenden bis hin zu Feen und Einhörnern zusammensetzt. In dieser Welt ist das Römische Reich (letztlich ironischerweise dank des Bösen) nie untergegangen, wird aber weiterhin vom Bösen bedroht und wankt unter dem Ansturm. Deswegen zögert der junge Adlige Charles Harcourt keinen Augenblick, in die Empty Lands aufzubrechen, als er von seinem Onkel erfährt, dass sich dort nicht nur seine seit langem verschollene große Liebe sondern auch Lasandras Prisma befinden soll, das der Legende nach die Seele eines Heiligen enthält. Letzteres ist für den Abt Guy Grund genug, sich Charles anzuschließen, dessen alter Freund, der geheimnisvolle Knurly Man, natürlich ebenfalls mitkommt (und mit seinen theologischen Streitgesprächen mit dem Abt einen wesentlichen Anteil an der Unterhaltsamkeit der Queste hat). Die Vierte im Bunde ist die Waise Yolanda, die über einige merkwürdige Fähigkeiten verfügt. Die Queste selbst verläuft nach dem üblichen Muster – die Gefährten müssen sich zusammenraufen, um die Gefahren, denen sie sich gegenübersehen, zu überstehen (wobei die Schrecknisse in den Empty Lands deutlich größer als die in den verheerten Gebieten der beiden anderen Romane sind) – und auch das Ende bietet letztlich das erwartet Unerwartete.
Clifford D. Simaks drei Fantasyromane sind jeweils gradlinig erzählte Abenteuerromane, die einige Gemeinsamkeiten aufweisen, an denen sich aber auch eine Entwicklung ablesen lässt. Während Enchanted Pilgrimage noch ein wenig unentschlossen zwischen SF und Fantasy hin und her pendelt, bietet The Fellowship of the Talisman eine traditionelle Queste, die vor allem mit der Interaktion der Figuren (und dem warmherzigen Blick, den uns der Autor auf sie gewährt) punkten kann, während Where the Evil Dwells die in den anderen beiden Romanen bereits angeklungenen moralischen und theologischen Fragen – sprich: die Frage nach der Natur des Menschen und der Natur Gottes – stärker in den Mittelpunkt rückt und eine fast schon pessimistische Grundstimmung aufweist (und nebenbei noch ein bisschen Cthulhu-Mythos-Feeling bietet). Interessant ist, dass in allen drei Romanen verwüstete, öde oder von bösartigen Kreaturen heimgesuchte Landstriche eine wichtige Rolle spielen, deren Verwüstungsgrad von Roman zu Roman zunimmt.
Grundsätzlich kann man sagen, dass Clifford D. Simak gewiss bessere Romane als diese drei Fantasyromane geschrieben hat, dass man aber auch ihn ihnen so manches von dem findet, was seine SF interessant und einzigartig macht.
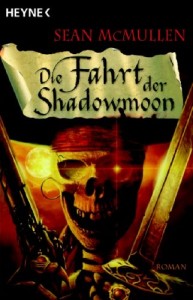 Sean McMullens skurrile Moonworlds-Saga ist in der deutschen Ausgabe einer sehr gewollten und wenig gekonnten Me-Too-Strategie zum Opfer gefallen: Cover, Titelgebung und sogar Klappentext legen nahe, dass jeden Augenblick Captain Jack Sparrow einen Urheberrechtsverstoß anmahnen könnte. Dummerweise gibt es im ganzen Roman keinen einzigen richtigen Piraten, sondern lediglich ein Boot voller Geheimagenten. Und der einzige Untote der Welt Verral ist ein Jahrhunderte alter Vampir, der an seinem Teenagerkörper verzweifelt und sich nur da vollsaugt, wo es Karmapunkte zu verdienen gibt. Von Schätzen, Seeschlachten und Flüchen weit und breit keine Spur – aber wer High-Magic-Settings mit viel Humor mag, sollte reinschauen und nicht auf schwarze Flaggen warten.
Sean McMullens skurrile Moonworlds-Saga ist in der deutschen Ausgabe einer sehr gewollten und wenig gekonnten Me-Too-Strategie zum Opfer gefallen: Cover, Titelgebung und sogar Klappentext legen nahe, dass jeden Augenblick Captain Jack Sparrow einen Urheberrechtsverstoß anmahnen könnte. Dummerweise gibt es im ganzen Roman keinen einzigen richtigen Piraten, sondern lediglich ein Boot voller Geheimagenten. Und der einzige Untote der Welt Verral ist ein Jahrhunderte alter Vampir, der an seinem Teenagerkörper verzweifelt und sich nur da vollsaugt, wo es Karmapunkte zu verdienen gibt. Von Schätzen, Seeschlachten und Flüchen weit und breit keine Spur – aber wer High-Magic-Settings mit viel Humor mag, sollte reinschauen und nicht auf schwarze Flaggen warten.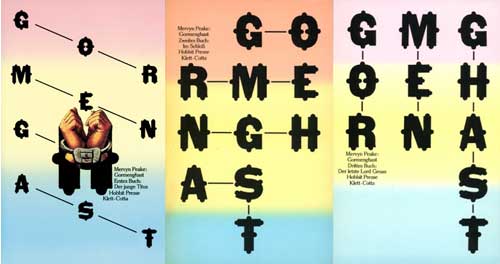
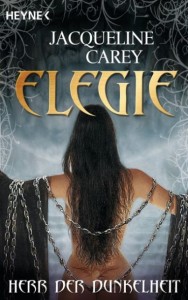 Jacqueline Carey hat für die zwei Bände von The Sundering, wie das Ganze im Original heißt, durchaus eine Kehrtwendung hingelegt und sich von der romantisch-erotischen Ecke ins epische Abenteuer begeben und ein bisschen Tolkien gechannelt, dabei allerdings den Blickwinkel vertauscht. Das hat aber niemanden so recht interessiert, wie der zart-duftige Reihentitel und die mehr oder weniger romantischen Cover nahelegen, die ganz bestimmt weder einen orkartigen Fjell noch einen der Herolde der Dunkelheit zeigen, aus deren Sicht die Geschichte meist erzählt wird. Ein gefallener Gott, eine Prophezeiung und eine Allianz des Guten, der man eigentlich nicht so recht den Sieg wünscht, stehen im Zentrum der auch stilistisch anspruchsvollen Geschichte. Ganz großes Erzählgarn für Fans der epischen Fantasy!
Jacqueline Carey hat für die zwei Bände von The Sundering, wie das Ganze im Original heißt, durchaus eine Kehrtwendung hingelegt und sich von der romantisch-erotischen Ecke ins epische Abenteuer begeben und ein bisschen Tolkien gechannelt, dabei allerdings den Blickwinkel vertauscht. Das hat aber niemanden so recht interessiert, wie der zart-duftige Reihentitel und die mehr oder weniger romantischen Cover nahelegen, die ganz bestimmt weder einen orkartigen Fjell noch einen der Herolde der Dunkelheit zeigen, aus deren Sicht die Geschichte meist erzählt wird. Ein gefallener Gott, eine Prophezeiung und eine Allianz des Guten, der man eigentlich nicht so recht den Sieg wünscht, stehen im Zentrum der auch stilistisch anspruchsvollen Geschichte. Ganz großes Erzählgarn für Fans der epischen Fantasy!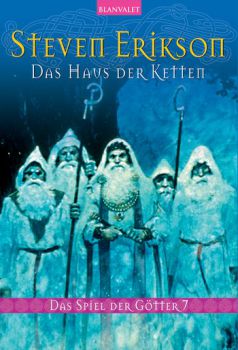 warum sich fünf der sieben Zwerge auf diesem Eriksoncover tummeln, ob Miraculix seine Brüder aus Ziergründen eingeladen hat oder warum der Weihnachtsmann so bläulich daherkommt (ist es die Kälte?). Statt epischer, bildgewaltiger Fantasy gibt es also Mistelernt-Romantik auf dem Cover, und das verstehe, wer will. Mit Erikson hat das nicht viel zu tun, und die herausragende Qualität der Reihe verschwindet hinter Bärten und Kapuzen.
warum sich fünf der sieben Zwerge auf diesem Eriksoncover tummeln, ob Miraculix seine Brüder aus Ziergründen eingeladen hat oder warum der Weihnachtsmann so bläulich daherkommt (ist es die Kälte?). Statt epischer, bildgewaltiger Fantasy gibt es also Mistelernt-Romantik auf dem Cover, und das verstehe, wer will. Mit Erikson hat das nicht viel zu tun, und die herausragende Qualität der Reihe verschwindet hinter Bärten und Kapuzen.