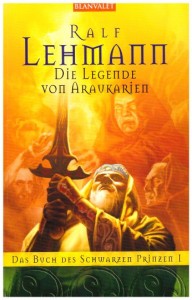 Im Hochhügelland häufen sich bedrohliche Geschehnisse, und so wird der junge Bolgan ausgesandt, um den Alten Niemand, einen jahrhundertealten Einsiedler, aufzusuchen und seinen Rat einzuholen. Was er erfährt, übertrifft seine schlimmsten Befürchtungen: Alles deutet darauf hin, dass der Schwarze Prinz, der schon in ferner Vergangenheit sein Unwesen trieb, zurückgekehrt ist und sich anschickt, die Lande zu verwüsten und ihre Bewohner zu versklaven. Die Reise in die Hauptstadt, um den Herrscher über das Reich Araukarien vor der drohenden Gefahr zu warnen, gerät zum Wettlauf gegen die Zeit, und bei ihrem Eintreffen müssen Bolgan und der Alte Niemand erkennen, dass ihre Nachricht allein nicht ausreicht, um die Katastrophe aufzuhalten …
Im Hochhügelland häufen sich bedrohliche Geschehnisse, und so wird der junge Bolgan ausgesandt, um den Alten Niemand, einen jahrhundertealten Einsiedler, aufzusuchen und seinen Rat einzuholen. Was er erfährt, übertrifft seine schlimmsten Befürchtungen: Alles deutet darauf hin, dass der Schwarze Prinz, der schon in ferner Vergangenheit sein Unwesen trieb, zurückgekehrt ist und sich anschickt, die Lande zu verwüsten und ihre Bewohner zu versklaven. Die Reise in die Hauptstadt, um den Herrscher über das Reich Araukarien vor der drohenden Gefahr zu warnen, gerät zum Wettlauf gegen die Zeit, und bei ihrem Eintreffen müssen Bolgan und der Alte Niemand erkennen, dass ihre Nachricht allein nicht ausreicht, um die Katastrophe aufzuhalten …
Das Land der Tanzenden Berge! Es ist eine merkwürdige Gegend, in der diese Geschichte ihren Anfang nimmt, eine weit von Araukaria, der Hauptstadt des Alten Reiches, entfernte Provinz. Die Landschaft ist schön und anmutig, mit grünen, baumbestandenen Kuppen und tief eingeschnittenen Tälern, in deren Niederungen knorrige alte Trauerweiden in einem niemals endenden Zwiegespräch mit kristallklaren Bächen stehen.
(1. Die Erzählung des Alten Niemand)
Mit der Legende von Araukarien, dem ersten Band der Trilogie um den Kampf gegen den Schwarzen Prinzen (anscheinend nicht verwandt oder verschwägert mit diesem Herrn), bietet Ralf Lehmann inhaltlich sehr klassische Fantasy: Eine dunkle Bedrohung aus grauer Vorzeit sucht jäh die Welt heim und die traditionellen Eliten versagen, so dass eine kleine Runde von Gefährten aus dem Volk unter Führung eines alten Mentors für kurze Zeit zusammenfinden muss, nur um sich bald wieder zu trennen und auf unterschiedliche Questen auszuziehen. Nichts weiter Bemerkenswertes, so möchte man meinen, zumal die jugendlichen Helden Bolgan, Hatib und Fernd gerade im Vergleich zu den oft liebevoller gezeichneten Nebenfiguren ein wenig blass bleiben. Dass Lehmann es eigentlich besser kann, beweisen die Passagen, in denen er sich daran wagt, menschliche Beziehungen in ihrer ganzen Kompliziertheit auszuloten: So nähern sich etwa einige Sklavenjäger und ihre Opfer einander ungewollt an, als ein schneller Weiterverkauf scheitert, und der mühsame Versuch, den auch langfristig günstigsten sozialen Umgang miteinander auszuhandeln, lässt viele Zwischentöne zu. Solch feine Beobachtungen würde man sich häufiger wünschen, zumal auch noch andere Schwächen auffallen: Manch innerer Widerspruch wird nicht aufgelöst, und die Dichte an Frauengestalten ist wesentlich geringer als in jedem durchschnittlichen Karl-May-Roman. Apropos Karl May: Dessen Bücher dürften Lehmann tatsächlich in gewissem Maße als Inspirationsquelle gedient haben, denn genau dort ist man einem dicken Boschak oder einer Beschreibung, die der des Schurken Morgreal verdächtig ähnelt, schon einmal begegnet.
Die Tatsache, dass Handlung und Charaktere Die Legende von Araukarien nicht unbedingt über den Durchschnitt hinausheben, sollte einen jedoch nicht von der Lektüre abschrecken, denn auf zwei anderen für die Fantasy ungemein wichtigen Gebieten stellt der Roman unbestreitbar seine Qualität unter Beweis: Weltenbau und Erzählweise überzeugen. Wie schon das oben gewählte Zitat verrät, kommt Araukarien hinsichtlich der phantastischen Elemente, die das Land selbst durchdringen, um einiges magischer und verspielter daher, als man es im Zeitalter “realistischer” Fantasyromane gewohnt ist: Berge, die über Nacht den Standort wechseln, ein verwunschener Hügel, den der finstere Feind nicht betreten kann, eine Ruinenstadt, in der Geisterspuk eine ferne Vergangenheit wiederauferstehen lässt, und eine geheimnisvolle Orakelhöhle wollen erkundet werden und erinnern einen daran, dass der größte Reiz von Questenfantasy oft nicht im Ziel der Reise, sondern in einem abwechslungsreichen Weg besteht. Auch die Wesen, von denen diese bunte Welt bevölkert ist, sind originell und von einer märchenhaften Unheimlichkeit, die sich nicht zuletzt aus der schieren Selbstverständlichkeit speist, mit der sie etwa auf Gedanken und Träume der Menschen zugreifen können. Wenn beispielsweise ein dämonischer Gifalk – eine Kreatur, die sich von Träumen nährt – den jungen Sohn eines Wirts zu sich aufs Zimmer bestellt und nur in Andeutungen eine geistige Vergewaltigung impliziert wird, erzeugt der Text mit subtilen Mitteln ein unterschwelliges Grauen, das weit länger nachhallt als jedes Entsetzen über eine plakative Gewaltdarstellung.
Ohnehin kann man sich nach einer Weile des Gedankens nicht mehr erwehren, dass es eigentlich gar keine so große Rolle spielt, was Ralf Lehmann erzählt, da einen vor allem gefangen nimmt, wie er es tut. Das liegt nicht allein an der teilweise poetischen Sprache (obwohl natürlich ein Waldbühl oder ein Silbergreis gekonnt bildreiche Assoziationen heraufbeschwören), sondern ist auch dem Eindruck geschuldet, es hier mit einer ganz anderen Erzählweise zu tun zu haben als der, die vor allem in der angloamerikanischen Fantasy mittlerweile fast alternativlos vorherrscht. Lehmann verlässt sich nicht allein auf ein szenisches Vermitteln seiner Geschichte, sondern beherrscht auch das raffende Schildern größerer Zeitabschnitte und vor allem das Beschreiben topographischer Besonderheiten virtuos. Die Erzähltradition, in der sein Buch steht, ist nicht die der Fantasy allein; Abenteuerromane des 19. und frühen 20. Jahrhunderts spielen ebenso mit hinein wie einige Aspekte klassischer Kinder- und Jugendliteratur zu phantastischen Themen. Beim Lesen stellt sich daher rasch das sympathische Gefühl ein, dass nicht auf vordergründige Effekte hingearbeitet, sondern vor allem eine Geschichte erzählt werden soll. Die mag nicht perfekt sein, gewiss – aber nach diesem Auftaktband ist man doch sehr gespannt auf den Fortgang, und sei es nur, weil es einfach so großen Spaß macht, sie sich erzählen zu lassen.
