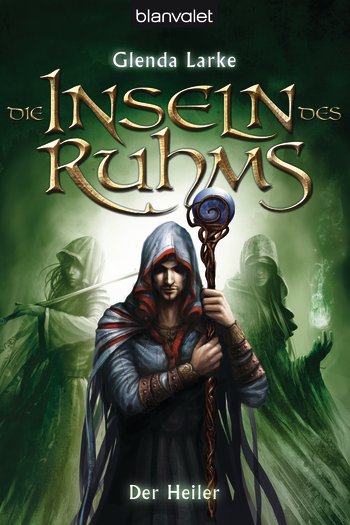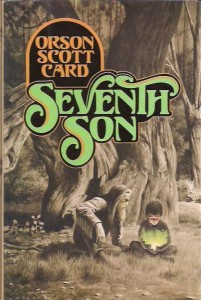 Bibliotheka Phantastika gratuliert Orson Scott Card, der heute 60 Jahre alt wird. Der am 24. August 1951 in Richmond, Washington, geborene Card hat zwar hauptsächlich als SF-Autor Furore gemacht (so gelang ihm beispielsweise das bisher einmalige Kunststück, mit Ender’s Game (1985) und der Fortsetzung Speaker for the Dead (1986) in zwei aufeinanderfolgenden Jahren die beiden wichtigsten SF-Preise – den Hugo und den Nebula Award – zu gewinnen), doch auch die Fantasy nimmt in seinem Oeuvre einen nicht unbedeutenden Stellenwert ein. Bereits der 1980 erschienene Roman Songmaster (dt. Meistersänger (1981)) fühlt sich stellenweise wie Fantasy an und verwendet Motive wie etwa das mit einer außerordentlichen Begabung (in diesem Fall für Musik) gesegnete Kind, die Card auch später wieder häufig aufgriff. 1983 folgte dann mit Hart’s Hope (dt. Die Hirschbraut (1985)) ein richtiger Fantasyroman, der vor allem aufgrund seines vordergründig naiven, ein bisschen an – allerdings grausame – Märchen erinnenden Erzählduktus und seiner Hauptfigur (bzw. deren sehr spezieller besonderer Fähigkeit) interessant ist.
Bibliotheka Phantastika gratuliert Orson Scott Card, der heute 60 Jahre alt wird. Der am 24. August 1951 in Richmond, Washington, geborene Card hat zwar hauptsächlich als SF-Autor Furore gemacht (so gelang ihm beispielsweise das bisher einmalige Kunststück, mit Ender’s Game (1985) und der Fortsetzung Speaker for the Dead (1986) in zwei aufeinanderfolgenden Jahren die beiden wichtigsten SF-Preise – den Hugo und den Nebula Award – zu gewinnen), doch auch die Fantasy nimmt in seinem Oeuvre einen nicht unbedeutenden Stellenwert ein. Bereits der 1980 erschienene Roman Songmaster (dt. Meistersänger (1981)) fühlt sich stellenweise wie Fantasy an und verwendet Motive wie etwa das mit einer außerordentlichen Begabung (in diesem Fall für Musik) gesegnete Kind, die Card auch später wieder häufig aufgriff. 1983 folgte dann mit Hart’s Hope (dt. Die Hirschbraut (1985)) ein richtiger Fantasyroman, der vor allem aufgrund seines vordergründig naiven, ein bisschen an – allerdings grausame – Märchen erinnenden Erzählduktus und seiner Hauptfigur (bzw. deren sehr spezieller besonderer Fähigkeit) interessant ist.
Vier Jahre später sollte sich herausstellen, dass das nur eine Fingerübung war, denn 1987 erschien mit Seventh Son der erste Band der Alvin Maker Saga (fortgesetzt mit Red Prophet (1988), Prentice Alvin (1989), Alvin Journeyman (1995), Heartfire (1998) und The Crystal City (2003)), die – wenn Card es denn schaffen sollte, sie eines Tages auf dem Niveau zu beenden, auf dem er sie begonnen hat – zu den faszinierendsten und originellsten Fantasyzyklen gezählt werden müsste. Denn die Geschichte Alvins, des siebten Sohns eines siebten Sohns, der in einem Parallelwelt-Amerika zum großen Gegenspieler des Unmaker werden muss, wenn er sein Land (und letztlich die ganze Welt) retten will, bedient sich zwar einerseits altbekannter Motive (wie eben des bereits erwähnten, besonders begabten, auserwählten Kindes), trumpft jedoch darüber hinaus mit einem Setting auf, das beweist, dass Fantasy keinen europäisch-pseudomittelalterlichen Hintergrund braucht, um zu funktionieren. Besagtes Setting (eine Alternativwelt, in der es nie eine amerikanische Revolution gegeben hat und somit auch die USA nie gegründet wurden, und in der die Indianer – nicht zuletzt dank ihrer Magie – eine ganz andere Rolle spielen als in unserer Realität) und Cards unbestreitbare Fähigkeiten in der Charakterzeichnung von kindlichen Hauptfiguren machen es leichter, darüber hinwegzusehen, dass auch in diesem Zyklus (wie eigentlich in fast allen Werken Cards) bestimmte Aspekte seiner religiösen Überzeugungen durchschimmern bzw. sich als Analogien dazu lesen lassen.
Die ersten drei Bände der Alvin Maker Saga erschienen noch im Jahresabstand, doch dann änderte sich der Erscheinungsrhythmus, die Lücken wurden größer – und auf Master Alvin, den Band, der den Zyklus vermutlich abschließen wird, warten die Leser und Leserinnen bis heute. Es bleibt die große Frage, ob – und wann – Card die Saga tatsächlich zu einem runden Ende bringen wird. In den letzten Jahren hat sein Renommée in der angloamerikanischen SF- und Fantasyszene aufgrund seiner allzu drastisch vorgetragenen politischen und religiös-moralischen Überzeugungen spürbar gelitten, und neuere Fantasyromane wie Enchantment (1999; im Prinzip die Nacherzählung einer russischen Dornröschen-Version) oder Magic Street (2005; Cards erster Ausflug in die Urban Fantasy) kommen an die Klasse der ersten Alvin-Maker-Bände nicht heran.
Cards Frühwerk liegt – sowohl was die SF wie auch die Fantasy angeht – praktisch komplett auf Deutsch vor; das gilt auch für seine Kurzgeschichten und Erzählungen, von denen sich einige ebenfalls der Fantasy zuordnen lassen. Was die Saga um Alvin Maker angeht, sind bisher allerdings nur die ersten vier Bände veröffentlicht worden (Der siebente Sohn (1988), Der rote Prophet (1989), Der magische Pflug (1990) und Der Reisende (1997)), und solange der Zyklus im Original nicht beendet ist, dürfte sich daran auch kaum etwas ändern.
Bibliotheka Phantastika Posts
neue Rezension:
Entropia (Christian Lorenz Scheurer) rezensiert von mistkaeferl
Unschöne Dinge (Mark Del Franco) rezensiert von moyashi
neues Portrait:
Guy Gavriel Kay portraitiert von elora
aus der alten BP umgezogene Rezensionen:
The Charwoman’s Shadow (Lord Dunsany) rezensiert von Arha
Die Intrige der Kaiserin (Sarah Zettel) rezensiert von mistkaeferl
The Briar King (Greg Keyes) rezensiert von Calavera
Zum 60. Geburtstag von Greg Bear
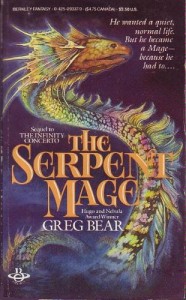 Bibliotheka Phantastika gratuliert Greg Bear, der heute 60 Jahre alt wird. Es mag manche Leser und Leserinnen überraschen, doch der am 20. August 1951 in San Diego, Kalifornien, geborene, in erster Linie mit Hard-SF-Romanen wie Blood Music, Eon oder The Forge of God bekannt gewordene Gregory Dale Bear hat seine Karriere nicht nur mit einem Roman begonnen, der thematisch und strukturell etliche Fantasy-Elemente aufweist und sich erst allmählich als SF entpuppt, sondern außerdem auch zwei waschechte Fantasyromane verfasst. Bears Erstling Hegira (1979, rev. 1987, dt. Die Obelisken von Hegira (1981)) schildert nämlich die Quest einer Gruppe von Figuren, die durchaus einem typischen Fantasysetting entstammen könnten, auf der Suche nach Erkenntnis. Dass die Rätsel um die 1000 Kilometer hohen, mit dem Wissen der Menschheit beschrifteten Obelisken und die Mauer am Ende der Welt letztlich in einem SF-Szenario aufgelöst werden, ändert kaum etwas daran, dass Hegira über weite Strecken auch als Fantasy-Abenteuerroman funktioniert.
Bibliotheka Phantastika gratuliert Greg Bear, der heute 60 Jahre alt wird. Es mag manche Leser und Leserinnen überraschen, doch der am 20. August 1951 in San Diego, Kalifornien, geborene, in erster Linie mit Hard-SF-Romanen wie Blood Music, Eon oder The Forge of God bekannt gewordene Gregory Dale Bear hat seine Karriere nicht nur mit einem Roman begonnen, der thematisch und strukturell etliche Fantasy-Elemente aufweist und sich erst allmählich als SF entpuppt, sondern außerdem auch zwei waschechte Fantasyromane verfasst. Bears Erstling Hegira (1979, rev. 1987, dt. Die Obelisken von Hegira (1981)) schildert nämlich die Quest einer Gruppe von Figuren, die durchaus einem typischen Fantasysetting entstammen könnten, auf der Suche nach Erkenntnis. Dass die Rätsel um die 1000 Kilometer hohen, mit dem Wissen der Menschheit beschrifteten Obelisken und die Mauer am Ende der Welt letztlich in einem SF-Szenario aufgelöst werden, ändert kaum etwas daran, dass Hegira über weite Strecken auch als Fantasy-Abenteuerroman funktioniert.
Richtige Fantasy – mit einem so nicht oft gesehenen Konzept der keltischen Feenwelt – bietet dann der aus den Bänden The Infinity Concerto (1984, dt. Das Lied der Macht (1987)) und The Serpent Mage (1986, dt. Der Schlangenmagier (1989)) bestehende Zweiteiler Songs of Earth and Power (1992 unter eben diesem Titel auch als revidierte Omnibus-Ausgabe erschienen), in dem ein junger Mann namens Michael Perrin aufgrund gewisser Umstände über eine magische Grenze stolpert – und sich unversehens im Reich der Sidhe wiederfindet. Diese Sidhe sind allerdings keine freundlichen, baumliebenden Elfen, sondern ein sich seit langem im Niedergang befindendes Volk mächtiger und grausamer Wesen, das seit ewigen Zeiten Krieg gegen die Menschheit führt. Wie Michael sich in dieser feindseligen Umwelt behauptet, wie er sich entscheidet, wenn es darum geht, die Menschheit oder die Sidhe vor dem Untergang zu retten – davon (und natürlich vom Lied der Macht und ein paar anderen Dingen) erzählen diese Bücher, nach deren Lektüre man die Feen- und Geisterwelt der keltischen Mythologie möglicherweise mit anderen Augen sehen wird. Und ein wissendes Lächeln aufsetzen kann, wenn es mal wieder um das Monster von Loch Ness geht. So betrachtet, kann man es durchaus bedauerlich finden, dass Greg Bear sich seither nie mehr der Fantasy zugewandt hat.
Zum 50. Geburtstag von James Clemens
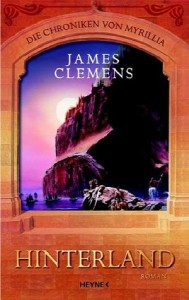 Bibliotheka Phantastika gratuliert James Clemens, der heute 50 Jahre alt wird. Clemens, eigentlich James Paul Czajkowski, geboren am 20.08.1961 in Chicago, feierte seinen größten Erfolg als Fantasy-Autor mit der Reihe The Banned and the Banished, einem High-Fantasy-Zyklus, in dem die junge Hexe Elena mit den blutroten Händen gegen den dunklen Herrscher antritt, der das Land Alasea zu unterwerfen trachtet. In den fünf Bänden Wit’ch Fire (1998), Wit’ch Storm (1999), Wit’ch War (2000), Wit’ch Gate (2001) und Wit’ch Star (2002) bereist Elena zusammen mit ihren Gefährten aus verschiedensten Völkern das ganze Land und stößt auf Monstren, Magie, Abenteuer und unzählige Apostrophen. Die Reihe wurde ohne Serientitel als Das Buch des Feuers/des Sturms/der Rache/der Prophezeiung/der Entscheidung von 1998-2003 auch auf Deutsch veröffentlicht.
Bibliotheka Phantastika gratuliert James Clemens, der heute 50 Jahre alt wird. Clemens, eigentlich James Paul Czajkowski, geboren am 20.08.1961 in Chicago, feierte seinen größten Erfolg als Fantasy-Autor mit der Reihe The Banned and the Banished, einem High-Fantasy-Zyklus, in dem die junge Hexe Elena mit den blutroten Händen gegen den dunklen Herrscher antritt, der das Land Alasea zu unterwerfen trachtet. In den fünf Bänden Wit’ch Fire (1998), Wit’ch Storm (1999), Wit’ch War (2000), Wit’ch Gate (2001) und Wit’ch Star (2002) bereist Elena zusammen mit ihren Gefährten aus verschiedensten Völkern das ganze Land und stößt auf Monstren, Magie, Abenteuer und unzählige Apostrophen. Die Reihe wurde ohne Serientitel als Das Buch des Feuers/des Sturms/der Rache/der Prophezeiung/der Entscheidung von 1998-2003 auch auf Deutsch veröffentlicht.
Clemens’ zweiter Fantasy-Zyklus, Godslayer (dt. Die Chroniken von Myrillia), der eine ähnlich epische und magiebetonte Geschichte beinhaltet, aber im Weltenbau auch innovativere Elemente wie magiebetriebene U-Boote oder ein auf Körpersäften basierendes Magiesystem zeigt, wurde bis jetzt nach den zwei Bänden Shadowfall (2005) und Hinterland (2006) nicht mehr fortgesetzt. Unter seinem zweiten Pseudonym James Rollins geht Clemens augenblicklich intensiver seiner Reihe erfolgreicher Mystery-Thriller (SIGMA Force) und Abenteuerromane nach.
Sollte Clemens wieder zur Fantasy zurückkehren, erwarten die Leser dieses umtriebigen Autors sicher weitere bunte Welten voller Abenteuer, Magie und Dramatik – der Hang zu Apostrophen ist inzwischen überwunden …
 Der ein oder andere wird es schon mitbekommen haben: Der in unserem SYLD gelistete British Bookshop in Wien hat seine Tore im Juli 2011 leider endgültig schließen müssen. Wir bedauern den Verlust einer so schönen und gut sortierten Buchhandlung und hoffen, dass die ehemaligen Mitarbeiter schnell eine neue Anstellung finden.
Der ein oder andere wird es schon mitbekommen haben: Der in unserem SYLD gelistete British Bookshop in Wien hat seine Tore im Juli 2011 leider endgültig schließen müssen. Wir bedauern den Verlust einer so schönen und gut sortierten Buchhandlung und hoffen, dass die ehemaligen Mitarbeiter schnell eine neue Anstellung finden.
Wer die Zukunft der freien Buchhandlungen mit unterstützen möchte, macht dies am Einfachsten, indem er seinen Lesestoff in solch kleinen Buchläden einkauft. Auch Buchbestellungen stehen in der Regel schon am nächsten Tag bereit, bei Auslandsbestellungen kann es natürlich auch einmal etwas länger dauern.
Wir freuen uns, heute den ersten Gastbeitrag in unserem Blog präsentieren zu können: Eine Lese-Empfehlung von Timpimpiri für einen von ihr übersetzten Roman. Timpimpiri ist ansonsten in unserem Forum anzutreffen.
______________
Es gab in der letzten Zeit nicht viele Bücher, die 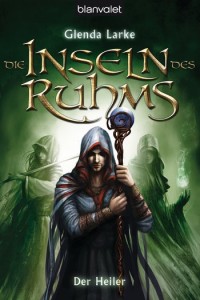 mich so richtig fasziniert haben, und am Anfang war ich auch bei Glenda Larkes Die Inseln des Ruhms etwas skeptisch. Die Grundidee, einen Archipel aus Inselreichen zum Schauplatz einer sich in ihrer ganzen Dimension erst allmählich entfaltenden Geschichte zu machen, hat mir zwar gefallen, aber im ersten Band (Die Wissende) war der Handlungsort auf eines dieser Reiche verengt, und zusammen mit der Anzahl der Akteure erinnerte das alles insgesamt sehr an ein Kammerspiel – wenn auch an ein durchaus interessantes und eines, das mit einer sehr ungewöhnlichen Hauptdarstellerin aufwarten konnte.
mich so richtig fasziniert haben, und am Anfang war ich auch bei Glenda Larkes Die Inseln des Ruhms etwas skeptisch. Die Grundidee, einen Archipel aus Inselreichen zum Schauplatz einer sich in ihrer ganzen Dimension erst allmählich entfaltenden Geschichte zu machen, hat mir zwar gefallen, aber im ersten Band (Die Wissende) war der Handlungsort auf eines dieser Reiche verengt, und zusammen mit der Anzahl der Akteure erinnerte das alles insgesamt sehr an ein Kammerspiel – wenn auch an ein durchaus interessantes und eines, das mit einer sehr ungewöhnlichen Hauptdarstellerin aufwarten konnte.
Im zweiten Band mit dem Titel Der Heiler weitet sich der Schauplatz, und jetzt zeigt die australische Autorin, die seit einiger Zeit in Malaysia lebt, dass sie das, was sie im ersten Band versprochen hat, auch tatsächlich hält. Denn nachdem Flamme und Glut von Gorthen-Nehrung nach Mekaté gelangt sind – sozusagen im Off zwischen Band 1 und Band 2 –, bringt sie die beiden Heldinnen mit Kelwyn Gilfeder zusammen, dem Neffen von Garwin Gilfeder, der schon in Band 1 seinen Auftritt hatte.
Das zufällige Zusammentreffen der drei bildet den fulminanten Auftakt des zweiten Bandes – mit einer Szene und einem Anfang, der seinesgleichen sucht: “Ich bin Glut und Flamme das erste Mal begegnet, als ich meine Frau umgebracht habe. Genauer gesagt, am Abend davor.” Das machte neugierig, und meine Neugier wurde nicht enttäuscht. Sowohl die Umstände der Ermordung wie auch die weitere Entwicklung der Geschichte zeugen von einem hohen Maß an Originalität und Intensität. Sicher, richtig groß im epischen Sinne ist auch dieser Band nicht – das wäre auch ein eigenartiger Bruch zum ersten gewesen –, aber er hat ungewöhnliche Ideen, wunderschöne neue Charaktere, einen hintergründigen, humorvollen Ton, und er wartet mit einem Showdown auf, der noch überraschender und frappierender ist als der Anfang. Keine Frage, die Autorin hat die Prämissen ihrer Geschichte wirklich durchdacht und folgt ihnen konsequent bis zum – teilweise bitteren, augenöffnenden – Ende; das gilt sowohl für die Haupthandlung (die abwechselnd von Kelwyn und Glut erzählt wird), wie auch für die Rahmenhandlung um Feldforscher Shor iso Fabold.
Glenda Larke, das ist für mich nach diesem zweiten Band klar, ist eine mutige Autorin, die zwar bemessen an Handlungssträngen, Verflechtungen etc.pp. eine eher kleine Geschichte geschrieben hat, die aber dafür umso mehr in die Tiefe geht und Aspekte des Menschseins und des Lebens so inszeniert, dass ich beim Übersetzen tatsächlich das ein oder andere Mal innehalten musste. Dass sie darüber hinaus vollkommen glaubwürdige und interessante Frauenfiguren erschaffen hat – sodass Die Inseln des Ruhms jeden Bechdel-Test mit Auszeichnung bestehen würden –, ohne eine vorwiegend “weibliche” Geschichte geschrieben zu haben, machte das Lesen und Übersetzen des Bandes zu einem wahren Genuss. Was, wie ich schon mal verraten möchte, auch beim dritten Band der Fall war.
zur Leseprobe bei Random House
neue Rezension:
Der magische Wald (Paul Kearney) rezensiert von mistkaeferl
neues Portrait:
Monika Felten portraitiert von moyashi
aus der alten BP umgezogene Rezensionen:
Gifts (Ursula K. Le Guin) rezensiert von boosterpacks
Hüterin der Drachen (Carole Wilkinson) rezensiert von Nungu
Timeline (Michael Crichton) rezensiert von Arha
Bibliotheka Phantastika erinnert an Clark Ashton Smith, dessen Todestag sich heute zum 50. Mal jährt. Der am 13. Januar 1893 in Long Valley, Kalifornien, geborene Smith – ein Dichter, Schriftsteller, Maler und Bildhauer – war nicht nur ein Zeitgenosse von H.P. Lovecraft und Robert E. Howard, sondern mit beiden auch befreundet und mit ihnen zusammen in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ein Garant für die goldene Zeit des Pulpmagazins Weird Tales, in dem ein Großteil seines Oeuvres erschienen ist. Dieses praktisch ausschließlich aus kürzeren und längeren Erzählungen sowie Gedichten bestehende Oeuvre weist inhaltlich, vor allem aber stilistisch etliche Besonderheiten auf, die Smith zu so etwas wie einem Solitär der Literaturgeschichte machen – zu einem Autor, der kaum Vorbilder hatte und seinerseits kaum Epigonen fand. Und sie dürften mit dafür gesorgt haben, dass er nie so bekannt und berühmt wurde wie seine Freunde Lovecraft und Howard.
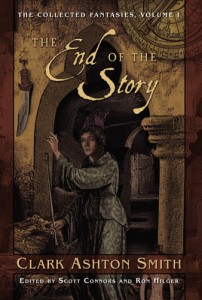 Im Laufe seiner schriftstellerischen Karriere schrieb Smith mehr als hundert Geschichten; das Spektrum reicht dabei von konventionellen Horror- oder SF-Stories bis hin zu bizarren, kaum noch so etwas wie einen Plot aufweisenden Wortmalereien, doch mit den besten von ihnen schuf er kleine, häufig stilistisch barock-schwülstige und von einem morbiden Grundton oder sarkastischem Humor durchzogene Meisterwerke. Im Gegensatz zu vielen seiner Pulp-Kollegen verwendete Smith keine durchgängig auftretenden Helden, doch knapp die Hälfte seiner Geschichten lassen sich in sechs Zyklen (genauer: in drei Zyklen und drei Mini-Zyklen) gruppieren, die ihr jeweiliges Setting eint – und vier davon für Fantasyleser und -leserinnen besonders interessant macht.
Im Laufe seiner schriftstellerischen Karriere schrieb Smith mehr als hundert Geschichten; das Spektrum reicht dabei von konventionellen Horror- oder SF-Stories bis hin zu bizarren, kaum noch so etwas wie einen Plot aufweisenden Wortmalereien, doch mit den besten von ihnen schuf er kleine, häufig stilistisch barock-schwülstige und von einem morbiden Grundton oder sarkastischem Humor durchzogene Meisterwerke. Im Gegensatz zu vielen seiner Pulp-Kollegen verwendete Smith keine durchgängig auftretenden Helden, doch knapp die Hälfte seiner Geschichten lassen sich in sechs Zyklen (genauer: in drei Zyklen und drei Mini-Zyklen) gruppieren, die ihr jeweiliges Setting eint – und vier davon für Fantasyleser und -leserinnen besonders interessant macht.
Die elf in Averoigne (der Provinz eines mittelalterlichen Parallelwelt-Frankreich) spielenden Erzählungen kommen dabei aufgrund ihres Instrumentariums aus verwunschenen Wäldern, Hexen, Vampiren und Werwölfen traditionellen Horror- und Fantasygeschichten am nächsten, weisen aber auch bereits die morbiden erotischen Elemente auf, die beinahe Smiths gesamtes Werk durchziehen.
Die zehn Geschichten aus Hyperborea (einem in grauer Vorzeit noch nicht vom ewigen Eis bedeckten Grönland) hingegen sind keine leichte Kost, denn in ihnen lässt Smith seinem Hang zum Malen mit Worten, zu barockem Schwulst freien Lauf. Andererseits sind sie mit Lovecrafts Cthulhu-Mythos verwoben, tauchen das in den Mythos eingegangene Book of Eibon und der krötengesichtige Gott Tsathoggua hier zum ersten Mal auf.
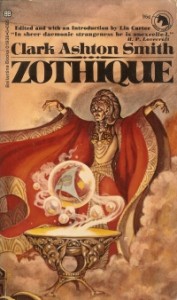 Mit dem in ferner Zukunft im Licht einer allmählich erlöschenden Sonne dahindämmernden Superkontinent Zothique fand Smith schließlich das Setting, das sich als bestens geeignet für seine immer wieder um Themen wie Verlust, Niedergang und Verfall kreisenden Geschichten erwies; mehrere der sechzehn hier angesiedelten Erzählungen zählen zum Besten, was er je geschrieben hat. Darüber hinaus haben die Zothique-Geschichten einen anderen Autor wesentlich beeinflusst, der seinerseits zu den interessantesten des Genres gezählt werden muss: Jack Vance, dessen Dying-Earth-Zyklus ihnen thematisch und stilistisch eine Menge verdankt.
Mit dem in ferner Zukunft im Licht einer allmählich erlöschenden Sonne dahindämmernden Superkontinent Zothique fand Smith schließlich das Setting, das sich als bestens geeignet für seine immer wieder um Themen wie Verlust, Niedergang und Verfall kreisenden Geschichten erwies; mehrere der sechzehn hier angesiedelten Erzählungen zählen zum Besten, was er je geschrieben hat. Darüber hinaus haben die Zothique-Geschichten einen anderen Autor wesentlich beeinflusst, der seinerseits zu den interessantesten des Genres gezählt werden muss: Jack Vance, dessen Dying-Earth-Zyklus ihnen thematisch und stilistisch eine Menge verdankt.
Auch bei den Geschichten aus den drei Mini-Zyklen Poseidonis (bei Smith die letzten Bruchstücke eines bereits größtenteils versunkenen Atlantis), Xiccarph (ein ferner, von bizarren Lebewesen bewohnter Planet, über den Smith eigentlich noch viel mehr schreiben wollte) und Mars (der bei Smith von einem alten Volk namens Aihai bewohnt wird) finden sich noch etliche Juewelen, etwa die Mars-Geschichte “The Vaults of Yoh-Vombis” (dt. als “Die Grabgewölbe von Yoh-Vombis” in Saat aus dem Grabe), die zwar nicht die typischste Smith-Geschichte sein mag, aber viele seiner Stärken und kaum eine seiner Schwächen aufweist.
Nachdem Smith in der zweiten Hälfte der 30er Jahre mehrere Schicksalsschläge hinnehmen musste (1935 starb seine Mutter, 1936 beging Robert E. Howard Selbstmord, 1937 starb erst sein Vater und dann H.P. Lovecraft, mit dem er jahrelang unzählige, zig Seiten lange Briefe gewechselt hatte), schrieb er nur noch wenig, sondern widmete sich bis zu seinem Tod am 14. August 1961 vor allem der Bildhauerei und der Malerei. In den USA hatte er zwar nie den Stellenwert seiner beiden Freunde, doch sind seine Geschichten immer wieder in diversen Sammelbänden erschienen, zuletzt als fünfbändige Collected Fantasies (The End of the Story, The Door to Saturn, A Vintage from Atlantis, The Maze of the Enchanter und The Last Hieroglyph (2007-2011)).
In Deutschland hingegen sieht es ein bisschen schlechter aus, denn die bisher veröffentlichten Sammelbände (Saat aus dem Grabe (1970), Planet der Toten (1971), Poseidonis (1985), Das Haupt der Medusa (1988) und Necropolis (2001)) decken allenfalls die Hälfte seines Oeuvres ab. Hier naht allerdings Abhilfe, denn der erste Band einer Werkausgabe seiner gesammelten Erzählungen soll unter dem Titel Die Stadt der Singenden Flamme noch in diesem Jahr erscheinen.
Bei meinem zweiten nostalgischen Ausflug hatte ich größere Sorgen als bei Das letzte Einhorn: Ein früheres Lieblingsbuch von einem Autor, der nach wie vor (seit mehr als 30 Jahren!) an seiner Shannara-Saga werkelt und ziemlich an Ruf eingebüßt hat. Mit seinem verstorbenen Kollegen Robert Jordan – zusammen ergeben sie so etwas wie das Dreamteam der generischen epischen Fantasy – kann Terry Brooks längst nicht mehr an Beliebtheit mithalten. Und ich war sicher, dass die Shannara-Bücher mir heute nicht mehr viel bieten würden. Unter dieser pessimistischen Prämisse hieß es also: Ran an den Schinken!
Die Elfensteine von Shannara (Terry Brooks, 1982)
Wann gelesen?
Zum ersten Mal vor ca. 20 Jahren. Und bald drauf nochmal – damals war die Zeit unendlich und das Geld knapp, da konnte man alles mehrmals lesen …
Besonderheiten?
Die Elfensteine von Shannara (Original: The Elfstones of Shannara) ist der zweite Band der ursprünglichen Shannara-Trilogie. In der Übersetzung wurden 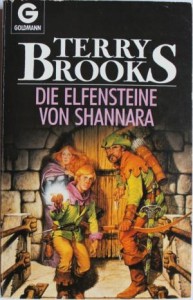 daraus drei Trilogien; es ist einer der kuriosen Fälle, in denen Bücher gedrittelt wurden (in Die Dämonen/Der Druide/Die Elfensteine … von Shannara). Allerdings gibt es auch schon seit 1986, drei Jahre nach der Veröffentlichung des ersten Einzelbandes, eine Sammelausgabe, die alle drei Bände vereint (und dafür von einem mittlerweile etwas speckigen Aufkleber mit dem Text „Sonderleistung“ geadelt wird). Neue Seitenzahlen waren bei der Sonderleistung allerdings nicht mehr drin, wir haben es mit dreimal etwas über 200 Seiten zu tun.
daraus drei Trilogien; es ist einer der kuriosen Fälle, in denen Bücher gedrittelt wurden (in Die Dämonen/Der Druide/Die Elfensteine … von Shannara). Allerdings gibt es auch schon seit 1986, drei Jahre nach der Veröffentlichung des ersten Einzelbandes, eine Sammelausgabe, die alle drei Bände vereint (und dafür von einem mittlerweile etwas speckigen Aufkleber mit dem Text „Sonderleistung“ geadelt wird). Neue Seitenzahlen waren bei der Sonderleistung allerdings nicht mehr drin, wir haben es mit dreimal etwas über 200 Seiten zu tun.
Es reichen nur wenige, zum Verständnis nicht nötige Fäden zurück in den Vorgänger Das Schwert von Shannara (den ultimativen Tolkien-Ripoff). Und in die Zukunft reicht gar nichts, man kann Die Elfensteine also bedenkenlos als Standalone lesen.
Was hat mir damals gefallen?
Spannung und Abenteuer: Terry Brooks war vielleicht der erste Autor, der mir begegnet ist, der mit abwechselnd erzählten Handlungssträngen arbeitet. Man begleitet einerseits Wil Ohmsford, den unerfahrenen Hüter der Elfensteine, der das Mädchen Amberle, die letzte Hoffnung auf Rettung vor den einfallenden Dämonenhorden, auf ihrer Queste beschützt, andererseits verfolgt man den verheerenden Rückzugskrieg des Elfenkönigs und seiner Verbündeten. Die finsteren Verfolger, dramatischen Kämpfe und riesigen Schlachten waren eine wahre Freude.
Die Geschichte: Man mag es kaum glauben, aber Die Elfensteine haben eine sehr schöne Grundhandlung. Die Mär vom sterbenden Lebensbaum der Elfen, dessen Samenkorn zu neuem Leben erweckt werden muss, war das Richtige für eine kleine Baumfreundin. Und dann gab es da noch die Überraschung, die mich damals mit offenem Mund vor dem Buch sitzen hat lassen, wahrscheinlich mit dem ganzen Reaktionsspektrum von „Frechheit!“ bis hin zu einem zufriedenen Seufzen.
starke Einzelszenen: Neben besagter Überraschung gibt es noch einige sehr einprägsame Szenen, die mir auch heute noch eine Gänsehaut verursachen, wenn ich daran denke. Der Kampf auf der Brücke, die erste Begegnung mit dem Raffer (dem fiesesten aller Dämonen), der letzte Kampf des Elfenkönigs …
Figuren und Welt: Die Figuren haben mich beeindruckt, besonders angetan war ich von Terry Brooks’ Gandalf-Ersatz, dem Druiden Allanon. Überhaupt sind die Vier Länder ein sehr farbenprächtiges Spektakel, in dem Platz für alle möglichen Kuriositäten ist. Für mich hieß das damals, dass einem alles begegnen konnte: Gestaltwandelnde Dämonen, eiskalte Hexen, Elfen, die auf Rocs fliegen …
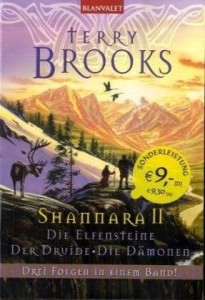
Und heute?
Überraschung! Die Elfensteine von Shannara geben noch immer ein feines Abenteuer ab. Für gewisse Verwunderung sorgt der gemächliche Aufbau: die erste Action kommt nach 50 Seiten (und zwar off-screen), vorher wurden die Protagonisten vorgestellt und in die Situation eingeführt. Terry Brooks bedient sich in Plot und Figuren freilich Stereotypen (die damals für die Fantasy auch noch nicht so verfestigt waren), doch er weiß, wie man damit Effekte erzielt. Originell ist daran heute fast nichts mehr, aber die klug gesetzten Details machen wett, dass keinerlei Brüche und nicht viel Subtiles auftauchen. Mein spezieller Freund Allanon ist hauptsächlich dafür zuständig, blaues Feuer aus den Fingern zu schießen und hochgeheimnisvoll zu tun, macht aber trotzdem etwas her, denn die groben Striche, die Brooks verwendet, die immer gleichen Attribute, mit denen er beschreibt, sitzen und zeichnen schnell ein deutliches Bild.
Happig wird es, wenn es an die Figurenpsychologie geht und Brooks in diesem Bereich der ebenso weitverbreiteten wie häufig grundfalschen Forderung „Show, don’t tell“ folgt: Dann kommen mitunter seitenlange, sehr bemühte Blicke ins Innenleben, die das Prädikat „nicht hilfreich“ verdient haben.
Trotz des langsamen Aufbaus (der auch erstaunlich atmosphärische Landschaftsbeschreibungen bietet) ist die Geschichte nach wie vor äußerst dynamisch: Brooks hat für Die Elfensteine die richtigen Elemente richtig zusammengesetzt; die Bilder, die die Höhepunkte markieren, funktionieren.
Spannungsszenen sind auch heute noch äußerst mitreißend, in den hochgelobten Brooks’schen Schlachtszenen dagegen: massenhaftes Dämonenschnetzeln, wenn man einen erschlägt, kommen drei neue nach, Ausfall, Rückfall, Todesfall – Beifall dafür eher nicht …
Fazit: Alte Liebe rostet (fast) nicht
Erinnerung und neuerliche Leseerfahrung klaffen gar nicht so weit auseinander. Man ist abgeklärter, aber die Kenntnis der Klischees nimmt dem Roman nicht viel von seiner Wirkung – die natürlich auch damals schon rein vordergründig war. Die Shannara-Reihe hat definitiv einige Gurken zu bieten, Die Elfensteine gehören nicht dazu. Wenn man bei der sorgsam aufbauenden Erzählweise nicht ungeduldig wird, wartet ein klassisches Abenteuer, das man am Ende nach einer schönen, runden und letztendlich doch nicht ganz unoriginellen Geschichte zuklappt.
Bibliotheka Phantastika erinnert an Hugh Cook, der heute 55 Jahre alt geworden wäre. Wenn man dem am 09.08.1956 in Essex, England, geborenen Hugh Walter Gilbert Cook eines nicht vorwerfen kann, sind das mangelnde Ambitionen. Schließlich war The Wizards and the Warriors (1986) nur der Auftakt zu den auf 20 Bände angelegten Chronicles of an Age of Darkness, auf die die ebenfalls 20-bändigen Chronicles of an Age of Wrath folgen sollten – an die sich wiederum die (Überraschung!) 20-bändigen Chronicles of an Age of Heroes anschließen sollten. Ein in jeder Hinsicht ebenso gigantisches wie ambitioniertes Konzept (vor allem, wenn man bedenkt, dass es Mitte der 80er Jahre entwickelt wurde – also zu einem Zeitpunkt, da vielbändige Epen noch kein Fantasy-Standard waren), das allerdings nach zehn Bänden (mit den Titeln The Wordsmiths and the Warguild (1987), The Women and the Warlords (1987), The Walrus and the Warwolf (1988), The Wicked and the Witless (1989), The Wishstone and the Wonderworkers (1990), The Wazir and the Witch (1990), The Werewolf and the Wormlord (1991), The Worshippers and the Way (1992) und The Witchlord and the Weaponmaster (1992) – faszinierend, oder?) aufgrund sinkender Verkaufszahlen ein rasches und so betrachtet unrühmliches Ende fand.
Was vermutlich damit zu tun hat, dass Cook in den Chronicles sowohl erzählerisch wie konzeptionell neue Wege ging. Denn die einzelnen Bände erzählen keine chronologisch fortlaufende Geschichte, und es 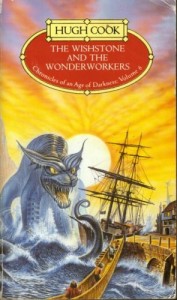 gibt auch keine durchgängig auftretenden Hauptfiguren. Statt dessen ist jeder Band für sich allein lesbar, Handlungszeiträume und -orte überlappen sich, Hauptfiguren werden zu Nebenfiguren und umgekehrt. Noch ungewöhnlicher ist allerdings, dass die einzelnen Romane sich auch stilistisch deutlich voneinander unterscheiden. So folgt auf den noch recht tolkienesken Band I ein ziemlich derb erzählter Entwicklungsroman mit einem alles andere als kompetenten “Helden”, auf diesen wiederum ein düsterer Roman aus der Sicht einer Erzählerin in einer zutiefst frauenfeindlichen Gesellschaft, Band IV ist dann ein umfangreicher, abenteuerlicher Schelmenroman und in Band V werden schließlich erstmals Handlungsfäden enger verknüpft und gewisse Hintergründe deutlicher.
gibt auch keine durchgängig auftretenden Hauptfiguren. Statt dessen ist jeder Band für sich allein lesbar, Handlungszeiträume und -orte überlappen sich, Hauptfiguren werden zu Nebenfiguren und umgekehrt. Noch ungewöhnlicher ist allerdings, dass die einzelnen Romane sich auch stilistisch deutlich voneinander unterscheiden. So folgt auf den noch recht tolkienesken Band I ein ziemlich derb erzählter Entwicklungsroman mit einem alles andere als kompetenten “Helden”, auf diesen wiederum ein düsterer Roman aus der Sicht einer Erzählerin in einer zutiefst frauenfeindlichen Gesellschaft, Band IV ist dann ein umfangreicher, abenteuerlicher Schelmenroman und in Band V werden schließlich erstmals Handlungsfäden enger verknüpft und gewisse Hintergründe deutlicher.
Man kann mit einer gewissen Berechtigung sagen, dass Cook in seinen Chronicles viele Entwicklungen der modernen Fantasy vorweggenommen hat und vielleicht einfach nur ein bisschen zu früh dran war, um mit seinem Konzept Erfolg zu haben: die nicht rein chronologische Erzählweise verwendet beispielsweise Steven Erikson in seinem Malazan Book of the Fallen, während der Effekt, dass die Handlungen bestimmter Figuren durch die Verwendung eines anderen personalen Erzählers in einem gänzlich anderen Licht erscheinen, von George R.R. Martin in seinem Epos A Song of Ice and Fire gerne und ausgiebig genutzt wird – und das unangenehme Gefühl, das sich bei manchen Lesern und Leserinnen bei der Lektüre von The Women and the Warlords einstellen könnte, dürfte sich nicht allzu sehr von dem unterscheiden, das R. Scott Bakkers The Prince of Nothing bei ihnen hervorrufen mag. Zumindest ist diese Betrachtungsweise angenehmer als die, dass die Chronicles einfach zu experimentell waren und die Fantasy schlicht keinen geeigneten Rahmen für Experimente aller Art bildet.
Auch nach dem (kommerziellen) Scheitern seiner ambitionierten Chronicles hat Cook noch etliche Romane verfasst (die allerdings größtenteils nur noch via lulu.com oder online veröffentlicht wurden), was beweist, dass sein 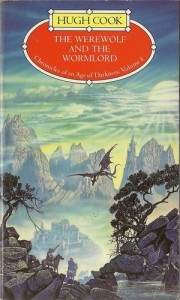 kreativer Wille ungebrochen war. Von daher wäre es zweifellos interessant gewesen, die weitere Entwicklung dieses Autors zu verfolgen – und vielleicht hätten aufgrund der inzwischen deutlich veränderten Marktsituation auch die Chronicles noch einmal eine Chance bekommen. Doch das Schicksal hatte anscheinend andere Pläne mit ihm, denn am 08. November 2008 ist er nach langer Gegenwehr einer im Jahre 2005 ausgebrochenen Krebs-Erkrankung erlegen. Was bleibt, ist ein nur theoretisch unvollendeter Fantasyzyklus, der trotz unbestrittener Qualitätsschwankungen in mehrfacher Hinsicht zu den interessanteren Werken des Genres gezählt werden muss. Oder, um es mit China Miéville zu sagen: “Hugh Cook was one of the most inventive, witty, unflinching, serious, humane and criminally underrated writers in imaginative fiction. Or anywhere.”
kreativer Wille ungebrochen war. Von daher wäre es zweifellos interessant gewesen, die weitere Entwicklung dieses Autors zu verfolgen – und vielleicht hätten aufgrund der inzwischen deutlich veränderten Marktsituation auch die Chronicles noch einmal eine Chance bekommen. Doch das Schicksal hatte anscheinend andere Pläne mit ihm, denn am 08. November 2008 ist er nach langer Gegenwehr einer im Jahre 2005 ausgebrochenen Krebs-Erkrankung erlegen. Was bleibt, ist ein nur theoretisch unvollendeter Fantasyzyklus, der trotz unbestrittener Qualitätsschwankungen in mehrfacher Hinsicht zu den interessanteren Werken des Genres gezählt werden muss. Oder, um es mit China Miéville zu sagen: “Hugh Cook was one of the most inventive, witty, unflinching, serious, humane and criminally underrated writers in imaginative fiction. Or anywhere.”
Die ersten drei Bände der Chronicles wurden – unter dem Reihentitel Chronik des Dunklen Zeitalters – auch ins Deutsche übersetzt, wobei The Wordsmiths and the Warguild gesplittet wurde (was merkwürdig ist, da ausgerechnet dieser Band der dünnste der drei Originalbände ist). Allerdings wirken die deutschen Titel (Der Todesstein, Held wider Willen, Toguras Rückkehr und Die Traumdeuterin (alle 1998)) verglichen mit denen der Originale reichlich generisch, fad und einfallslos.
neue Rezensionen:
Blameless (Gail Carriger) rezensiert von moyashi
Der widerspenstige Planet (Robert Sheckley) rezensiert von Colophonius
On a Pale Horse (Piers Anthony) rezensiert von moyashi
Vom wundersamen Einhorn (Alison Lurie) rezensiert von mistkaeferl