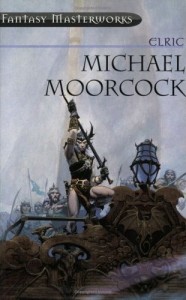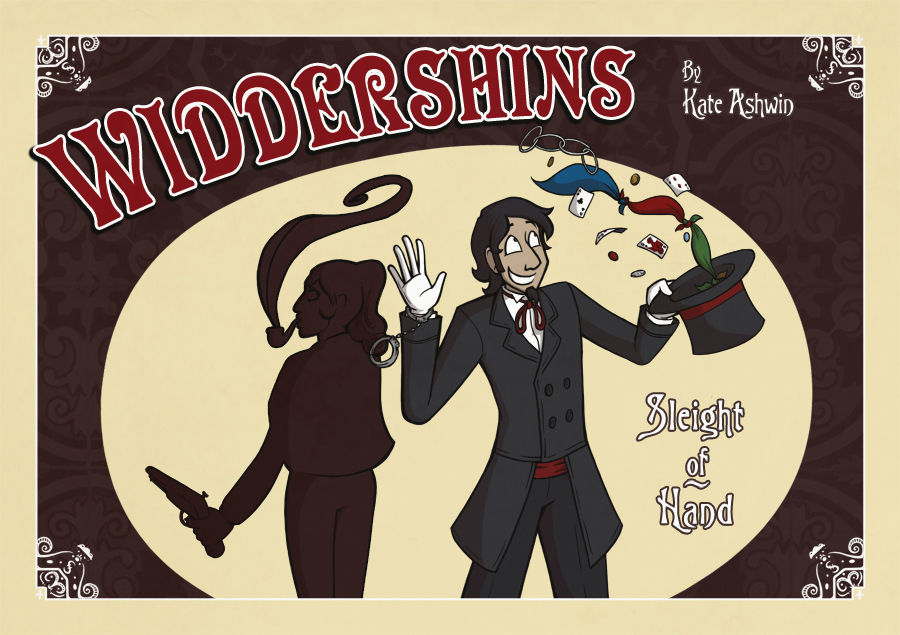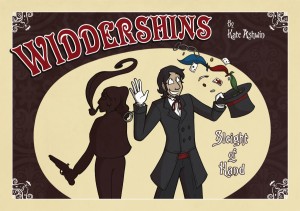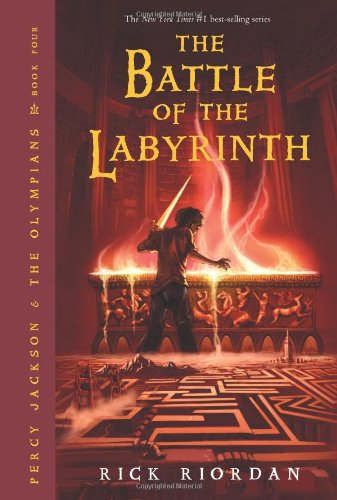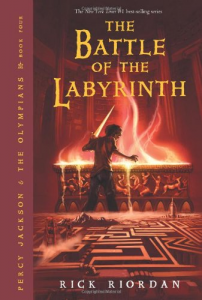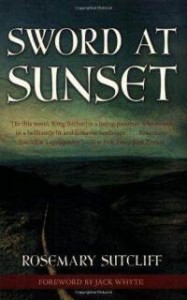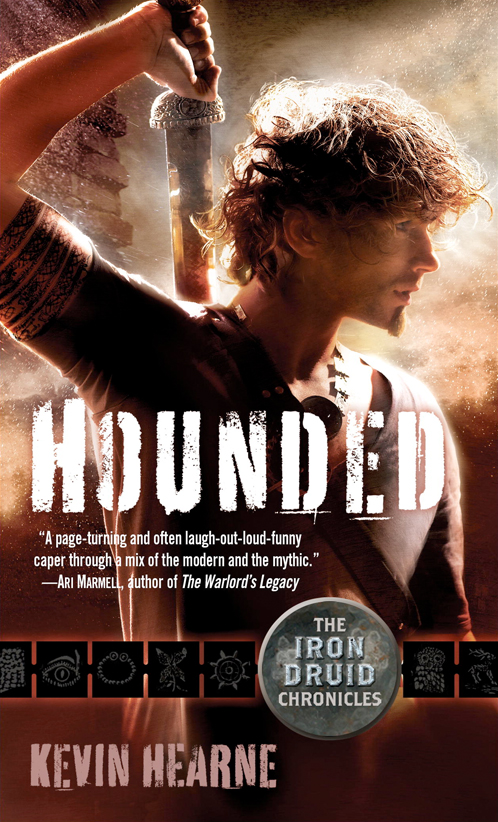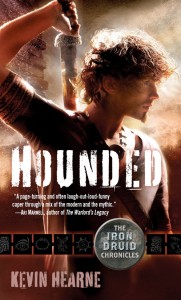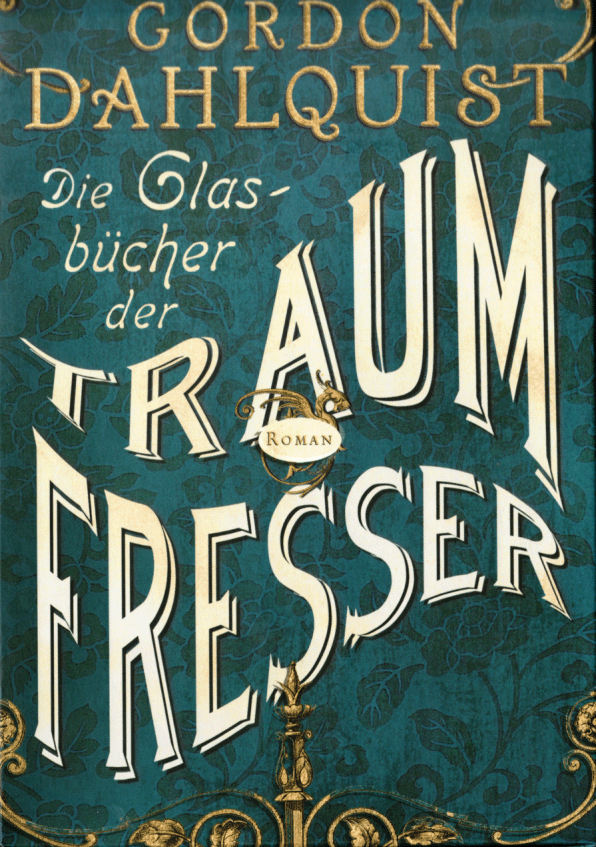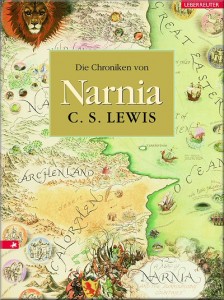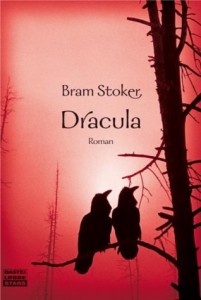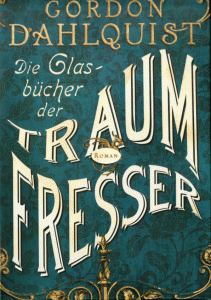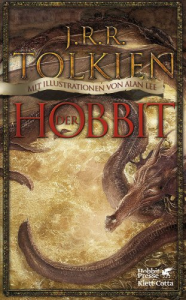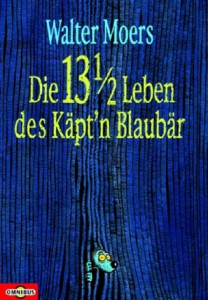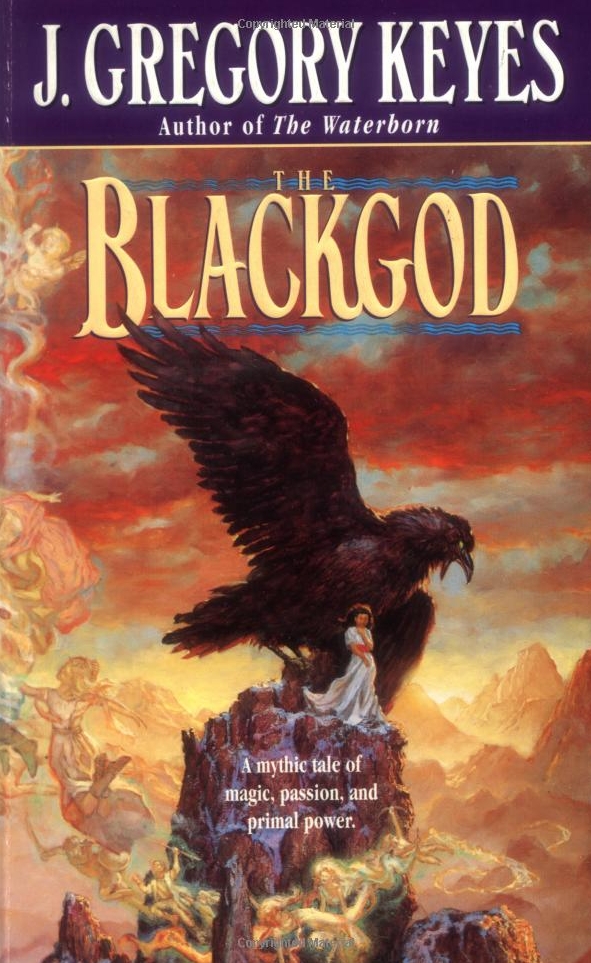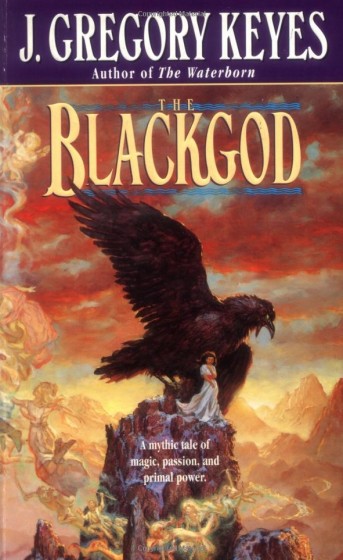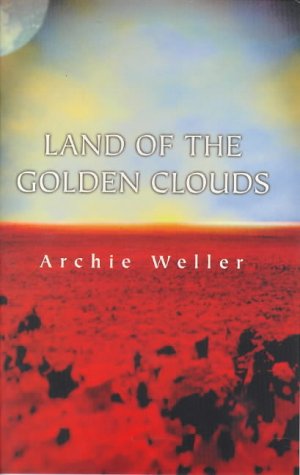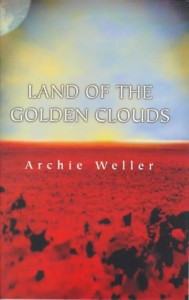Unser Buch des Monats im August entführt über die Genregrenzen zu Science Fiction und Horror. 1995 erschien der auch als Techno-Thriller bezeichnete Roman Wie ein Hauch von Eis (Original: Host; 1993) von Autor Peter James.
Unser Buch des Monats im August entführt über die Genregrenzen zu Science Fiction und Horror. 1995 erschien der auch als Techno-Thriller bezeichnete Roman Wie ein Hauch von Eis (Original: Host; 1993) von Autor Peter James.
Der erfolgreiche Wissenschaftler Joe Messenger ist überzeugt davon, Menschen unsterblich machen zu können. Die kryogene Konservierung des Menschen ist schon lange bekannt, doch Joe will einen Schritt weitergehen und forscht nach einer Methode, den Verstand eines Menschen in einen Computer mit biologischen Nerven-/Gehirnzellen herunterzuladen. Seine Forschung befindet sich an einem toten Punkt, als eine neue Studentin zu seiner Assistentin wird. Mit ihrer Hilfe gelingt Joe der lang ersehnte Durchbruch, doch was er damit erschafft, entpuppt sich als sein persönlicher Alptraum, der nicht nur ihn, sondern auch seine Familie in Lebensgefahr bringt und den Wahnsinn und Schrecken des menschlichen Verstandes offenlegt.
Man muss darauf gefasst sein, sich hier und da mit Unbehagen umzublicken und sich während der Lektüre zu fragen: würde ich mich in diesem Szenario für Leben oder Tod entscheiden? Denn trotz der beinahe phantastischen Vorstellung des Ganzen scheint Peter James’ Vision nicht völlig undenkbar, und es ist wohl eher eine Frage der Zeit, bis die Realität einen Joe Messenger hervorbringen wird.
Wie ein Hauch von Eis ist ein spannend geschriebener Roman, der sich im Verlauf der Handlung immer weiter steigert. Der Leser durchlebt mit Joe Messenger eine in der Gegenwart spielende Reise, die in der Normalität beginnt und in futuristischem Horror endet; von der Suche nach einem Segen für die Menschheit, über die Entdeckung der Lösung, bis hin zum Erkennen, welche Gefahr diese neue Entdeckung in sich birgt, wird Joe zum Gejagten seiner eigenen Erfindung. Deren scheinbar unaufhaltsame Allmacht lauert bald hinter jedem Bit und Byte, hinter jeder Ampel und jeder Telefonverbindung.
Obwohl der Roman aufgrund seines Alters inzwischen natürlich überholt ist, was manch technisches Detail angeht, ist es doch vor allem die Folge von Joes Entdeckung und nicht die Technik selber, die einem von Anfang bis Ende eine Gänsehaut beschert und daher, wenn man das ein oder andere Auge zukneift, auch 20 Jahre später noch genauso gut funktioniert wie 1993.
Für Liebhaber von Romanen, in denen es auch einmal eher technisch als magisch zugehen darf, ist Wie ein Hauch von Eis vor allem wegen der unheimlichen und realitätsnahen Atmosphäre zu empfehlen. Die inhaltliche Richtung dieses Buchs erinnert an Serien wie The Outer Limits oder Tales from the Darkside und dürfte dem bekennenden Geek/Nerd Herzklopfen bereiten. Leider scheinen solche Erzählungen ein wenig aus der Mode geraten zu sein oder zumindest keinen Anreiz mehr für Autoren und Fernsehsender zu bieten.
__________________
Wie ein Hauch von Eis (ISBN: 978-3442081257; Goldmann, 1995) ist leider nur noch antiquarisch zu bekommen. Wer es sich zutraut, kann das englische Original Host (ISBN: 978-0752837451; zuletzt neu aufgelegt bei Orion im Dez. 2000) dagegen noch problemlos im Neuzustand erhalten.