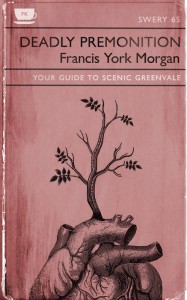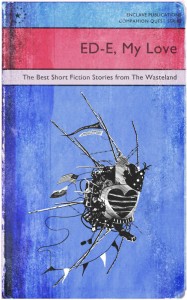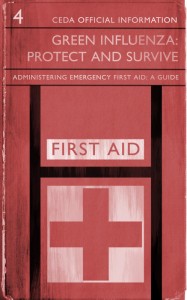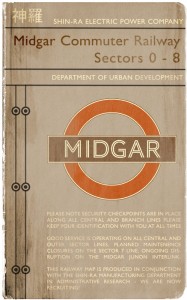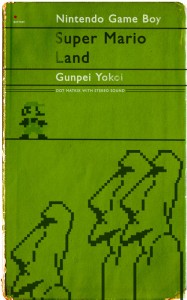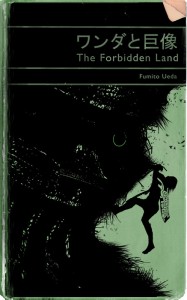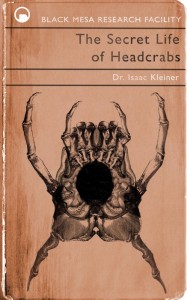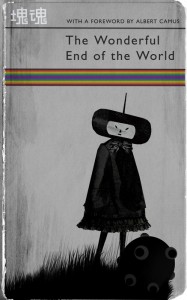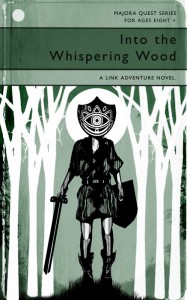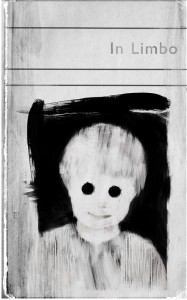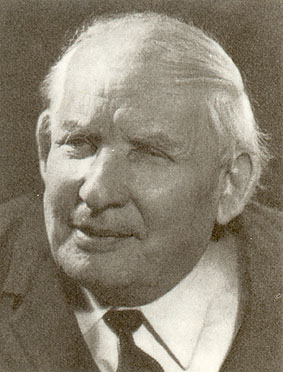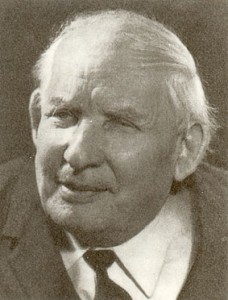Inspiriert von den Listen Patrick Rothfuss‘ und dem Buch Wie man über Bücher spricht, die man nicht gelesen hat von Pierre Bayard möchte ich hier ein paar Überlegungen anstellen. Zuerst mal zur Ausgangssituation: Patrick Rothfuss hat in seinem Blog drei Listen veröffentlicht:
Liste 1: Bücher, die er gelesen hat und die er weiterempfiehlt.
Liste 2: Bücher, die aus Platzgründen aus Liste 1 rausgenommen wurden.
Liste 3: Bücher, die womöglich in Liste 1 wären, hätte er sie denn (komplett) gelesen.
Solche Checklisten sind ja immer ein herrlicher Anlass, um vor dem eigenen (gedanklichen oder realen) Buchregal auf und ab zu marschieren und abzuhaken, was man schon gelesen hat, und alles übrige auf eine to-read-Liste zu setzen – man werfe nur mal einen Blick in unser Forum. (Diese Listen enden dann zwar meist so wie die Neujahrsvorsätze, aber manche Bücher kauft man doch, wenn sie auf der x-ten to-read-Liste aufgetaucht sind.)
Auf Bayards Buch, das ich nur empfehlen kann, sei hier nur in Kürze eingegangen: Er spricht sich für eine Anerkennung des Nicht-Lesens aus. Lesen und Nicht-Lesen seien komplementäre Teile desselben Vorgangs, schließlich muss man für jedes Buch, das man liest, ein anderes auslassen.
Nun gleicht nichts, zumindest für ein ungeübtes Auge, dem Ausbleiben des Lesens mehr als das Nichtlesen, und niemand scheint jemandem, der nicht liest, näher als jemand, der nicht liest. […] Im ersten Fall interessiert sich die nicht lesende Person nicht für das Buch, wobei hier »Buch« gleichzeitig als Inhalt und als Stellung [d.h. die Verortung des Buches in einem (literarischen) Kontext] zu verstehen ist. […] Im zweiten Fall verzichtet die nicht lesende Person nur deshalb auf die Lektüre, um wie Musils Bibliothekar das Wesentliche des Buches zu erfassen, nämlich seine Stellung in Bezug zu anderen. Damit bekundet sie nicht etwa mangelndes Interesse am Buch, ganz im Gegenteil. (Bayard, Pierre: Wie man über Bücher spricht, die man nicht gelesen hat. München 2009, 32)
Ein Buch nicht gelesen zu haben, hat also nichts mit einer Missachtung des Buches zu tun, sondern ist vielmehr Resultat einer Beschäftigung mit dem Buch, indem man sich sowohl über dessen Inhalt, als auch dessen Position etwa innerhalb eines Genres informiert.
Was hat das jetzt mit Pats Listen zu tun?
Diese finde ich unter zweierlei Aspekten interessant. Auf der einen Seite ist Liste 1 (Empfehlungen aufgrund des eigenen Urteils) eine recht kanonische Liste, die großteils Bücher umfasst, die ohnehin schon als Klassiker gelten (Herr der Ringe, Narnia, Erdsee-Trilogie, 1984) und deren erneute Empfehlung durch Rothfuss eigentlich nicht notwendig wäre. Damit wird – wieder einmal – festgeschrieben, dass man diese Bücher gelesen haben sollte, will man zum Genre Phantastik etwas Sinnvolles beitragen.
Auf der anderen Seite empfiehlt Pat – indirekt – mit Liste 3 auch Bücher, die er nicht (komplett) gelesen hat, denn die Listenform und die Verbindung mit Liste 1 (wo sie eventuell gelandet wären) legen eine Auswahl nahe, die auch Empfehlungscharakter hat. Auch hier finden sich wieder einige Klassiker und Anwärter auf diesen Titel (Conan, Malazan Books of the Fallen, Gormenghast, Watership Down), bei denen naheliegt, dass sie auf der Liste gelandet sind, weil sie als Klassiker gelten und weil Rothfuss um ihre Stellung weiß, ohne sie gelesen zu haben.
Um Bücher zu kennen, um ihre Bedeutung für das Genre einschätzen und schließlich um über sie sprechen zu können, muss man diese also nicht unbedingt gelesen haben. Pierre Bayard meint, dass der Blick auf das einzelne Buch den Blick auf die Gesamtheit, auf die Zusammenhänge verstellen kann. Bei der Menge an Büchern, die veröffentlicht wurden und veröffentlicht werden, ist es wichtig sich zurechtzufinden und Prioritäten setzen zu können. Das Festhalten und Abarbeiten einer kanonischen Liste kann insofern auch dazu führen, dass lohnende Neuerscheinungen weniger Beachtung finden.
Dem Nicht-Lesen so viel Raum auf einer Rezensionsseite zu bieten, erscheint wahrscheinlich etwas seltsam und in der Tat kommt ein Punkt bei Bayard etwas zu kurz: Um sich über Bücher zu informieren, braucht es Leute, die diese Bücher gelesen haben und Informationen darüber zusammentragen, Meinungen darüber äußern, denn erst im kommunikativen Austausch mit sich selbst und mit anderen (vgl. Bayard, Bücher, 68) über diese Bücher wird deren Bedeutung festgelegt. Rezensionen erfüllen also eine doppelte Funktion: Sie helfen beim Lesen und beim Nicht-Lesen von Büchern.
Insofern erfüllen Pats Listen noch einen dritten Zweck, sie regen dazu an, zu reflektieren, was man alles nicht gelesen hat. Welche drei (nicht-kanonischen) Bücher stehen bei euch ganz oben auf der to-read-Liste?