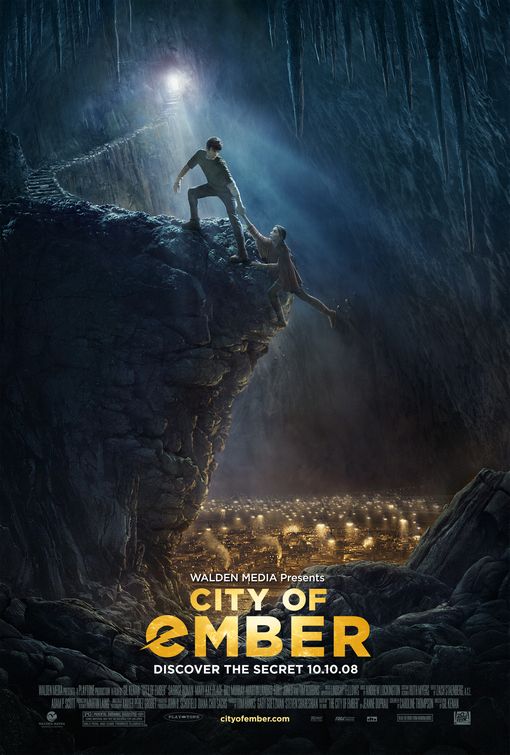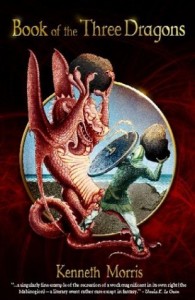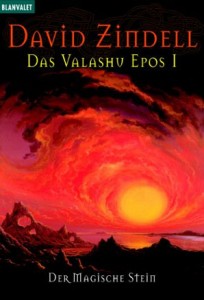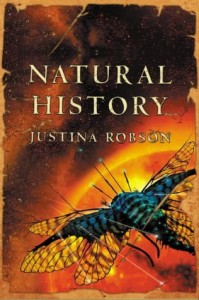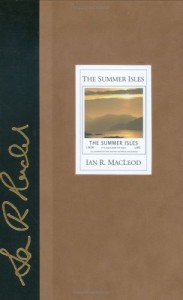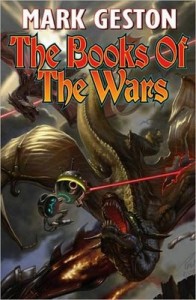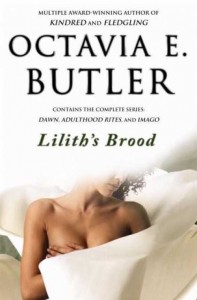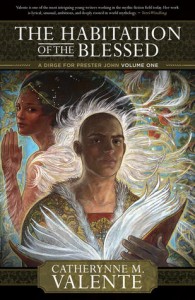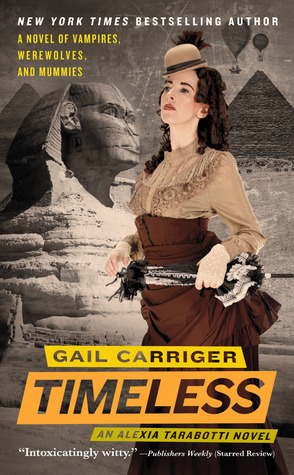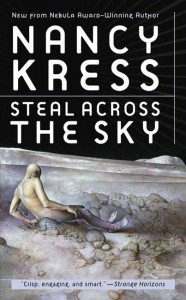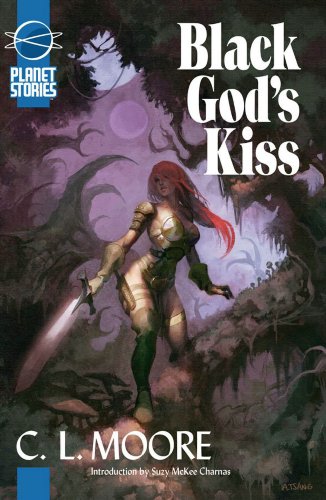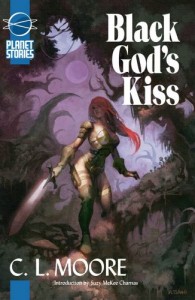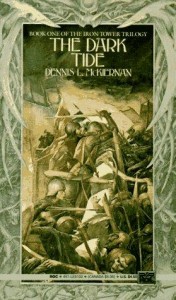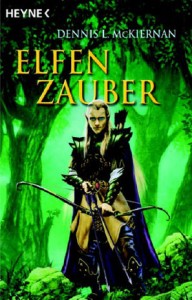Für viele von uns sind Namen mehr als nur interessante Buchstabenfolgen – weit über simple Allegorien hinaus verorten sie uns LeserInnen in einer fremden Welt, sagen uns, welchen Klang sie hat, wie vertraut oder fremd sie ist, welchen Bezugsrahmen sie schafft, wie erfindungsreich oder gewöhnlich sie sich präsentiert.
LeserInnen phantastischer Literatur wünschen sich zurecht, dass bei der Übersetzung von Eigennamen sorgfältig und sensibel vorgegangen wird.
Viele wünschen sich allerdings auch, dass Eigennamen generell unübersetzt bleiben sollen.
Doch während wir in der „realistischen“ Literatur schon lange mehr keinen Herrn Schmidt aus einem Mr Smith machen, ist dieser Wunsch in der phantastischen Literatur zu kurz gesprungen. Wann immer es um eine eigenständige Sekundärschöpfung geht – also eine Welt, auf der kein Großbritannien, kein Deutschland, keine USA existieren – gibt es auf die Frage, ob (sprechende) Eigennamen einer Übersetzung bedürfen, nur eine Antwort: Ja!
Die Gründe hierfür lassen sich unter drei Punkten zusammenfassen:
1, Verständlichkeit
Nicht alle LeserInnen beherrschen die Originalsprache. Wer einwenden will, die heutigen DurchschnittsleserInnen seien mit ausreichend vielen Anglizismen und der englischen Sprache an sich vertraut, muss sich der Frage stellen, wer dabei auf der Strecke bleibt: Was Qhorin Halfhand auszeichnet, mag sich fast jedem erschließen. Aber was, wenn AutorInnen sich mit Etymologie und Onomastik ihrer Muttersprache beschäftigt haben – was bei der Weltschöpfung und der Auseinandersetzung mit Sprache durchaus zum Handwerk gehören kann –, wenn also die sprechenden Elemente der Wörter einzelne Morpheme sind, vielleicht sogar veraltete? Versteht auch jeder, der Herrn Halbhand zuordnen konnte, was es mit der achtbeinigen Shelob auf sich hat?[1] Dabei sind uns manche Namensbausteine mit Bedeutung nicht einmal in der eigenen Sprache ganz klar bewusst: die zahllosen Müllers stellen uns vor kein Problem, und wir wissen, was Neustadt bedeutet, bei Stuttgart oder Schubert wird der ein oder andere nachdenken oder -schlagen müssen. Anderes wissen wir intuitiv, können es i.d.R. aber nicht aktiv abrufen. Was bedeutet die Endung „schaft“? Und wissen wir um diese Dinge tatsächlich auch in einer Fremdsprache?
Spätestens, wenn die Fremdsprache nicht mehr Englisch heißt, offenbart sich das Ausmaß der Problematik: Was ist mit spanischen Namen? Russischen? Wer hätte sich beim Geralt-Zyklus des polnischen Autors Andrzej Sapkowski eine Sängerin namens Oczko gewünscht statt Äuglein? Oder hätte Geralt auch gleich der Wiedźmin Geralt z Rivii bleiben sollen?
Für LeserInnen, die der Originalsprache nicht oder nicht ausreichend mächtig sind, geht bei einer unterlassenen Übersetzung von Namen eine Bedeutungsebene ganz oder teilweise verloren, dafür wird eine nicht intendierte Ebene hinzugefügt, was uns zum nächsten Punkt bringt.
2, Wirkung
Unsere Muttersprache haben wir verinnerlicht, mitsamt ihrer Wortbildung und der groben Bedeutung einzelner Bausteine, so dass wir Erklärungen sofort, meist sogar passiv abrufen können – was bei guten sprechenden Namen (v.a. Ortsnamen) ein äußerst nützlicher Umstand ist: Sie fügen sich relativ natürlich in den Kontext ein, ihr Bedeutungsinhalt ist etwas, über das man im Zweifelsfall nicht zweimal nachdenken muss. Ein unübersetzter Eigenname bleibt dagegen ein Fremdkörper im Text, der zwar vielleicht verstanden wird, jedoch eine „Exotik“ ausstrahlt, die so nicht intendiert war. Denn etwas, das vorher mit dem Kontext verschmolzen ist, ragt nun in der Fremdsprache daraus hervor und wird anders wahrgenommen. Und das Herausragende sind dann genau jene Elemente, die vom Autor/der Autorin ursprünglich so angelegt wurden, dass sie ohne Hürde verstanden werden können.
Folgende Sätze illustrieren das Problem vielleicht:
Die Zeit Damelon Giantfriends neigte sich im Land ihrem Ende zu, noch bevor meinesgleichen den Bau von Coercri oder Grieve vollendeten, der Siedlung der Riesen bei Seareach.[2]
Als Herr Bilbo Baggins von Bag-End ankündigte, daß er demnächst zur Feier seines einundelfzigsten Geburtstages ein besonders prächtiges Fest geben wolle, war des Geredes und der Aufregung in Hobbiton kein Ende.[3]
Für einige LeserInnen ist vermutlich die Verfremdung, die unvertraute Assoziation, die das Englische mit sich bringt, durchaus reizvoll – sie finden Stormhaven, Hayholt oder Wormtail in einem deutschen Text klangvoller als Sturmhafen, Hochhorst oder Wurmschwanz. Zumal aufgrund der angloamerikanischen Provenienz eines Großteils der Fantasy und der langen Tradition, Eigennamen mitunter unübersetzt zu lassen, englische Begriffe womöglich auch mit „Fantasyflair“ assoziiert werden und schon immer eine Prise Exotik beigesteuert haben, die gern angenommen wurde.[4] Der Effekt ist dennoch gegenläufig zu dem, was AutorInnen mit sprechenden Namen bezwecken – etwas Vertrautes oder auch Ungewohnt-Nachvollziehbares mit dem Material zu schaffen, das ihnen und ihren LeserInnen zur Verfügung steht.
Besonders deutlich wird die verfremdete Wirkung nicht eingedeutschter Namen, wenn man auf den Klang achtet, obige Sätze z.B. laut liest, denn dann stehen mitten im Satz Wörter, die anderen Ausspracheregeln folgen. Dadurch kommt es zu einem Bruch im Lesefluss, der sogar noch weiter geht, wie im nächsten Punkt ausgeführt.
3, Immersion
Wenn eine Fantasywelt als Sekundärschöpfung vorliegt, wird die innertextuelle Fiktion häufig durch eine eigene Historie und deren Verschriftlichung und durch eigene Sprachen verstärkt. Nicht selten gibt es Referenzen auf Bücher, Chroniken, Annalen dieser Welten. Wenn diese Fiktion zu Ende gedacht wird, ist die Muttersprache des Autors oder der Autorin lediglich ein Substitut für die Sprache der Welt der Geschichte, und AutorInnen sind “ÜbersetzerInnen” aus dieser Sprache.
Den Archetypus für diese Idee hat Tolkien (bei dem auch die Sprachschöpfung vor der Weltschöpfung stand) mit seinem Roten Buch geschaffen, der fiktionalen Quelle seiner Mittelerde-Geschichten: Anhang F von Der Herr der Ringe erklärt:
Bei der Sprache, die in dieser Geschichte durch Englisch ausgedrückt wird, handelt es sich um das Westron oder die “Gemeinsprache” der westlichen Lande von Mittelerde im Dritten Zeitalter.
Tolkien treibt die Fiktion soweit, dass er Eigennamen, die auf Westron Bedeutung tragen, in ihre Entsprechungen im Englischen (oder verwandten Sprachen) “übersetzt” hat, und auch phonetische Anpassungen vornahm: So ist z.B. auch das Wort Westron selbst eine Übersetzung von Adûni, und die Hobbit(was natürlich auch eine Übersetzung ist)-Familie Boffin ist eine phonetische Angleichung von Bophîn ans Englische.[5]
Kompliziert und weit hergeholt? Es geht auch einfacher: Gibt es einen Grund, weshalb man auf Mittelerde, in Osten Ard oder in Bas-Lag Englisch sprechen sollte? Nein, denn all diese Welten sind so aufgebaut, dass sie eigene Sprachen und Kulturen besitzen und losgelöst von unserer Welt stehen. Auf Fantasywelten spricht man Hardisch, Khuzdul oder Galach.
Englische Einsprengsel führen dazu, dass die Illusion zerstört wird, sich in einer anderen Welt zu befinden, denn Englisch ist für viele LeserInnen konkret verortet, wohingegen Deutsch als unsere Default- und Denksprache in den Hintergrund tritt – es ist für Muttersprachler ein Neutrum (Bayrisch oder Platt verorten wir allerdings sehr wohl, weshalb Dialekte für Fantasy meist gänzlich ungeeignet sind). Das Eintauchen in eine Fantasywelt wird durch eine Verortung der Sprache in unserer Welt erschwert, und allein die Tatsache, dass man bei unübersetzten Namen plötzlich wieder Englisch und Deutsch vor der Nase hat, macht die Übersetzungarbeit und die Sprachunterschiede unserer Welt sichtbar.
Übersetzung: unerlässlich
Leider kann die Fantasy-Literatur auf eine lange Reihe schlampig oder nur teils übersetzter Namen zurückblicken. Auch heute wird das Thema unterschiedlich gehandhabt, und die sonstige Verwendung von Anglizismen sorgt dafür, dass englische Begriffe als jugendlich-spritzig gelten und daher z.T. gezielt im Text belassen werden.
Betrachtet man übrigens den umgekehrten Weg, die Übersetzung vom Deutschen ins Englische, werden sprechende Namen natürlich auch übertragen, so hat etwa Ralph Manheim, der neben Grass und Brecht auch Michael Ende übersetzte, nicht nur die “Desert of Colors” und die “Swamps of Sadness” in den Text von The Neverending Story eingebracht, sondern auch aus Phantásien Fantastica gemacht und sogar phonetische Anpassungen vorgenommen, etwa von Fuchur zu Falkor.
Solche phonetischen Anpassungen kommen auch vom Englischen ins Deutsche vor (z.B. Winnie-the-Pooh zu Pu der Bär) und sind zumindest in Fällen, in denen die Aussprache der Originalnamen nach deutschen Regeln völlig in die Irre führen würde, sinnvoll – aber mit Sicherheit strittiger als reine Namensübersetzungen.
Trotz der eindeutigen Gründe für eine Übersetzung von Eigennamen[6] ist nachvollziehbar, dass es Probleme mit der Eindeutschung gibt. Nicht nur, weil es häufig schwierig, wenn nicht gar unmöglich ist, Namen eins zu eins zu übertragen, sondern vor allem, weil die Namen gerade in der Fantasy die Realität der benannten Figur, des Ortes oder der Sache konstituieren, ihre Identität maßgeblich mitbestimmen. Bei einem Gegenstand von solcher Bedeutung spielt die Gewohnheit zwangsläufig eine große Rolle, und ganz gleich, wo man dem Original-Namen zuerst begegnet ist – im englischen Roman, in einem Internetforum oder in einer alten Übersetzung –, ist es verständlich, wenn man eine Eindeutschung auf den ersten Blick ablehnt. Meine Bitte wäre daher: Riskiert auch einen zweiten Blick. Gerade die ÜbersetzerInnen, die sich um die Übersetzung von Namen bemühen, machen sich häufig Gedanken, gehen nicht unbegründet vor, sprechen sich mit dem Autor oder der Autorin ab.
Umgekehrt ist für eine Akzeptanz von übersetzten Eigennamen eine hohe Qualität dieser Übersetzungen und nicht zuletzt konsequentes Vorgehen nötig – dann können sprechende Namen die ihnen eigene Poesie entfalten und wir müssen nicht auf den Grauen Mausling, Simon Mondkalb, das Auenland oder Schwelgenstein verzichten.
_____
- 1 Margaret Carroux hat es in ihrer Übersetzung von Der Herr der Ringe bei näherer Betrachtung ziemlich gelungen mit Kankra ausgedrückt – mehr darüber kann man hier nachlesen.
2 aus: Lord Fouls Fluch (Stephen R. Donaldson); in der Übersetzung von Horst Pukallus heißt es tatsächlich: Die Zeit Damelon Riesenfreunds neigte sich im Lande ihrem Ende zu, noch bevor meinesgleichen den Bau von Coercri oder Herzeleid vollendeten, der Siedlung der Riesen an der Wasserkante. Der Effekt wird allerdings zunichte gemacht, wenn ein paar Seiten weiter Diamondraught getrunken wird.
3 aus: Der Herr der Ringe: Die Gefährten (J.R.R. Tolkien); in der Übersetzung von Margaret Carroux heißt es tatsächlich: Als Herr Bilbo Beutlin von Beutelsend ankündigte, daß er demnächst zur Feier seines einundelfzigsten Geburtstages ein besonders prächtiges Fest geben wolle, war des Geredes und der Aufregung in Hobbingen kein Ende.
4 Die Vehemenz, mit der Namensübersetzungen manchmal verteufelt werden, lässt den Schluss zu, dass muttersprachliche Eigennamen der Leserschaft vielleicht zu wenig phantastisch sind, zu gewöhnlich klingen.
5 Näheres hier: http://tolkiengateway.net/wiki/Westron#Translation
6 Bei Fantasy, die auf unserer Welt spielt oder bei der aus anderen Gründen die Sprache Englisch (oder andere Fremdsprachen) existieren, fällt das Argument der Immersion natürlich weg, und die anderen beiden sind abzuwägen gegen die Authentizität der sprachlichen Herkunft der Eigennamen.
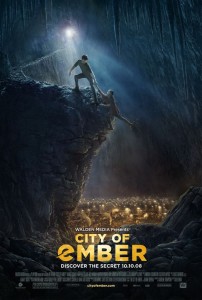 Selbst die immer wieder neu und grob zusammengehaltene Kleidung der Menschen zeugt von den Jahren einer reinen Nutzgesellschaft, die nie gelernt hat selbst etwas herzustellen und von den Hinterlassenschaften der Erbauer lebt. Wer das Computerspiel Bioshock zufällig kennt, wird die Optik des Films am ehesten mit diesem Spiel vergleichen können.
Selbst die immer wieder neu und grob zusammengehaltene Kleidung der Menschen zeugt von den Jahren einer reinen Nutzgesellschaft, die nie gelernt hat selbst etwas herzustellen und von den Hinterlassenschaften der Erbauer lebt. Wer das Computerspiel Bioshock zufällig kennt, wird die Optik des Films am ehesten mit diesem Spiel vergleichen können.