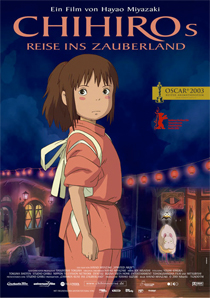 Chihiros Reise ins Zauberland (千と千尋の神隠し/Sen to Chihiro no kamikakushi) ist einer der bekanntesten japanischen Animationsfilme aus dem Studio Ghibli mit seinem Regisseur Hayao Miyazaki. 2001 feierte das Fantasy-Abenteuer seine Premiere und begeistert seither Kinder wie Ewachsene gleichermaßen. Nicht nur in Japan gilt er daher als der bisher erfolgreichste Film Japans überhaupt, auch international räumte Chihiros Reise ins Zauberland mehrere Auszeichnungen ab und schlug mit unerwartet großem Erfolg ein.
Chihiros Reise ins Zauberland (千と千尋の神隠し/Sen to Chihiro no kamikakushi) ist einer der bekanntesten japanischen Animationsfilme aus dem Studio Ghibli mit seinem Regisseur Hayao Miyazaki. 2001 feierte das Fantasy-Abenteuer seine Premiere und begeistert seither Kinder wie Ewachsene gleichermaßen. Nicht nur in Japan gilt er daher als der bisher erfolgreichste Film Japans überhaupt, auch international räumte Chihiros Reise ins Zauberland mehrere Auszeichnungen ab und schlug mit unerwartet großem Erfolg ein.
Der Film erzählt die Geschichte von Chihiro Ogino, einem zehnjährigen Mädchen, welches gerade mit ihren Eltern in eine neue Stadt zieht. Auf dem Weg in diese ländliche Gegend verfährt sich die Familie und stoppt vor den Toren eines verlassenen Freizeitparks. Chihiros Vater besteht darauf, den Ort zu erkunden, das Mädchen schließt sich ihren Eltern schließlich widerwillig an. Obwohl weit und breit keine lebende Seele zu sehen ist, dampfen leckere Köstlichkeiten in allen Restaurants, und die Eltern schlagen sich hemmungslos den Bauch damit voll. Chihiro, die nichts essen will, da sie die verlassene Stadt gruselt, wandert derweil umher, bis ein mysteriöser Junge sie entdeckt und ihr eindringlich klar macht, dass sie die Stadt unbedingt vor Einbruch der Nacht verlassen muss. Umgehend rennt Chihiro zurück zu ihren Eltern und stellt fest, dass es bereits zu spät ist. Die Sonne verschwindet hinter dem Horizont und das Mädchen muss mit ansehen, wie sich ihre Eltern aufgrund ihrer eigenen Gier buchstäblich in Schweine verwandeln, während um Chihiro herum die Geisterwelt zum Leben erwacht und sich der Park mit Monstern füllt. Um ihre Eltern zu retten und in die Welt der Menschen zurückkehren zu können, muss Chihiro im Badehaus der Hexe Yubaba arbeiten. Die jedoch hat alles andere als noble Absichten mit dem Mädchen.
Chihiros Reise ins Zauberland ist ein absolut zauberhafter Film mit einer ansprechenden, nicht zu kindischen Story, einer farbgewaltigen, magischen Bildsprache und einem unglaublichen Reichtum phantasievoller Ideen, die ihre Wurzeln größtenteils in der japanischen Mythologie haben. Auf ihrem Weg trifft Chihiro wundersame Gestalten wie das Ohngesicht (Kao Nashi), Kamaji mit seinen sechs spinnenartigen Armen, eine Schar Rußmännchen – die manchem Zuschauer schon aus Mein Nachbar Totoro bekannt sein dürften -, göttliche Kreaturen, Drachen, Riesenbabys, körperlos agierende Köpfe und etliches mehr. Auch die musikalische Untermalung (im Trailer unnötigerweise durch irgendeinen langweiligen Charts-Titel ersetzt) ist sehr stimmungsvoll und eindringlich. Obwohl es schon genug wäre, sich einfach nur an dieser faszinierenden und unwirklichen Bild- und Tonwelt von Chihiros Reise ins Zauberland zu erfreuen, ja sich darin zu verlieren, bedarf es zusätzlich keiner Vorkenntnisse der mythologischen Welt Japans, um den Film auch inhaltlich zu verstehen und genießen zu können. Sowohl der recht naturgetreue Zeichenstil der umgebenden Objekte und Architektur, als auch die erschaffenen Charaktere und ihr eindeutiges Verhalten verstehen es, den Zuschauer sofort zu verzaubern und ihre Funktion auf überraschend simple Weise deutlich zu machen. Die passend gewählte Musik trägt außerdem zum emotionalen Verständnis bei.
Typisch für die Filme aus den Ghibli-Studios ist ein nicht durchweg unterhaltender und ausschließlich positiver Erzählweg. Die Handlung wird auch in Chihiros Reise ins Zauberland von einer leichten Melancholie begleitet, behandelt auf subtile Art das Thema Umweltschutz und auch ein wenig japanische Wirtschaftsgeschichte (was vor allem durch den von Menschen verlassenen Freizeitpark verkörpert wird). Er liefert auch ein nicht eindeutiges Ende, welches Raum für die eigene Vorstellung von einem perfekten Ende lässt. Der moralische Zeigefinger lässt sich gewiss nicht leugnen, kommt aber auf die charmantest mögliche Weise zum Einsatz und selbst die vermeintlich bösen Geister und Monster sind nicht einfach nur schlecht. Vielmehr werden alle Charaktere von einer hin- und hergerissen Natur erfüllt, keiner ist vollkommen böse oder vollkommen gut. Selbst die Welt, in der sie leben, wirkt häufig obskur und die Regeln unbeständig, wechselhaft. Chihiros Aufgabe ist daher auch weniger das Bezwingen eines Antagonisten, sondern das Zurechtfinden in einer komplizierten, launischen Welt, die mitunter schwierige Aufgaben bereithält und verantwortungsvolle Entscheidungen verlangt. Trotzdem kommen auch Humor und Unterhaltungsfaktor nicht zu kurz, vielmehr handelt es sich um eine perfekte Mischung, die Groß und Klein in ihren Bann ziehen kann.
Wer sich Chihiros Reise ins Zauberland bisher entziehen konnte, sollte seinen Widerstand dringend aufgeben und dem Film eine Chance geben. Gerade auch für den erwachsenen Fantasyfan ist dieser Film ein Muss!
Meine persönliche Empfehlung: Schaut euch den Film im japanischen Original mit deutschen Untertiteln an. Denn, obwohl die Synchronisation hätte schlimmer ausfallen können, schaffen es die deutschen Sprecher nur bedingt, an die stimmliche Vielfalt der Originalsprecher heranzukommen.

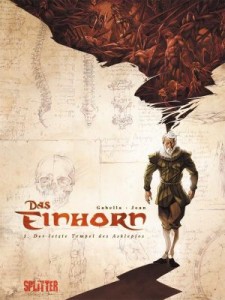
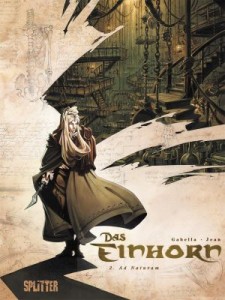
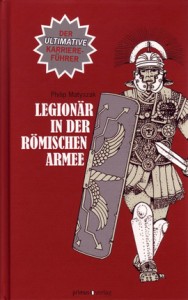
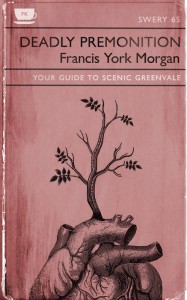

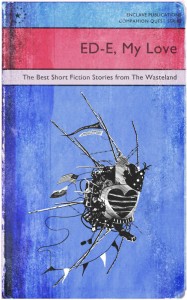


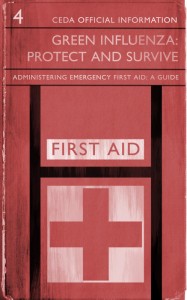

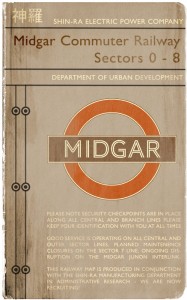

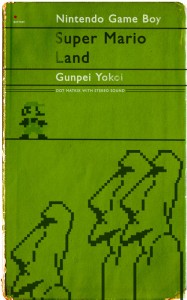
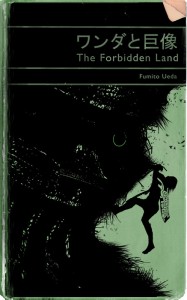

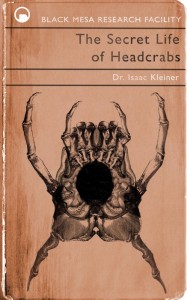
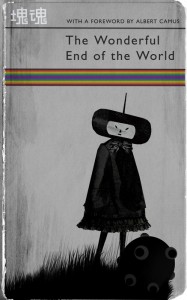
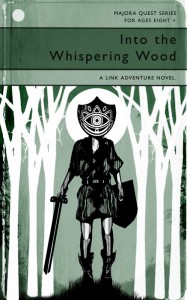
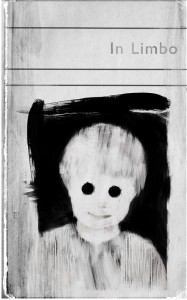
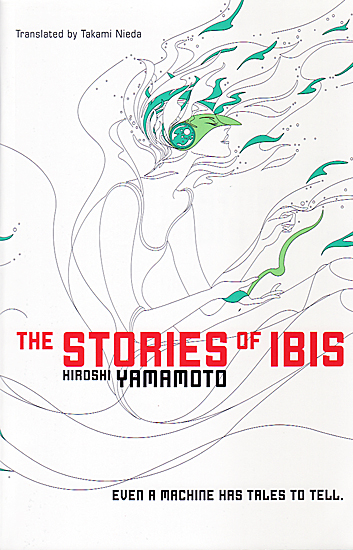
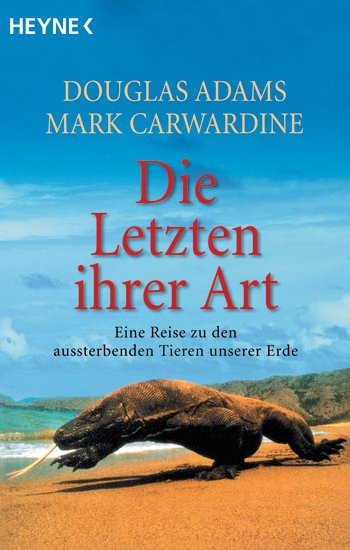
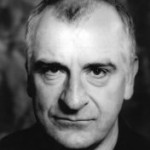
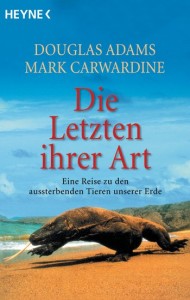

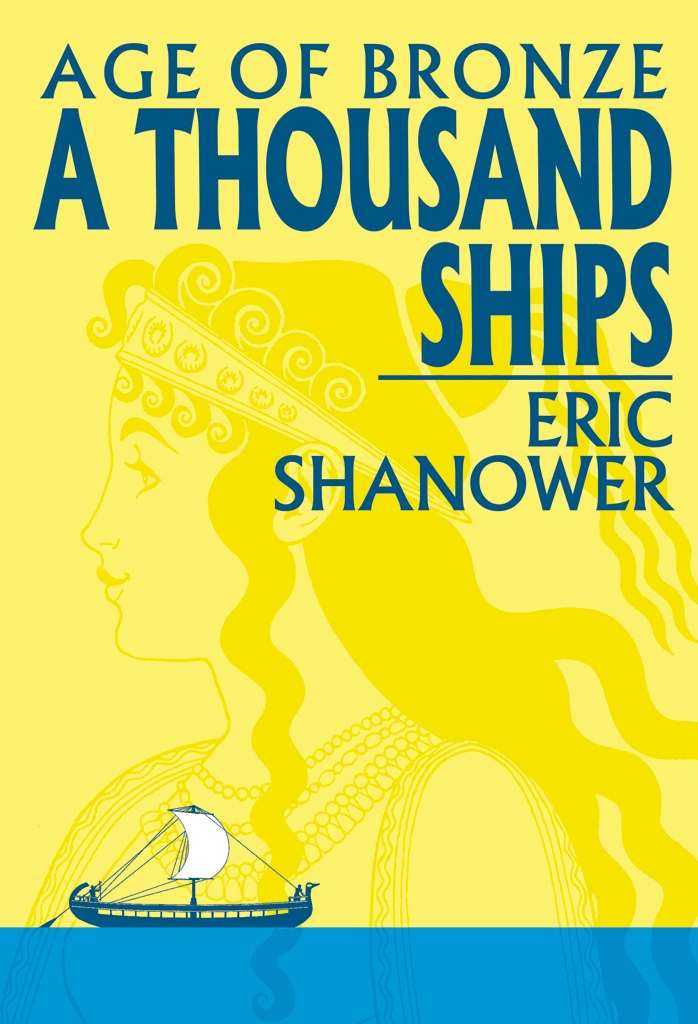

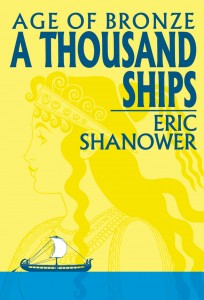
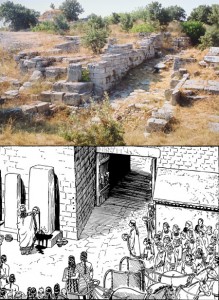
 Die Beantwortung dieser Frage ist schwierig, denn Videospiele sind an sich schon ein sehr eklektizistisches Medium, das sich etwa bei der Inszenierung sowohl an Filmen, als auch an Comics orientieren kann, wie etwa das jüngste Beispiel
Die Beantwortung dieser Frage ist schwierig, denn Videospiele sind an sich schon ein sehr eklektizistisches Medium, das sich etwa bei der Inszenierung sowohl an Filmen, als auch an Comics orientieren kann, wie etwa das jüngste Beispiel