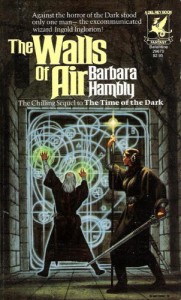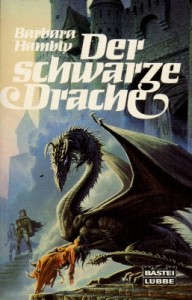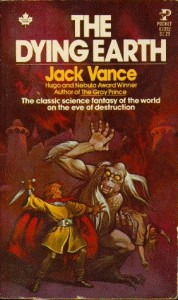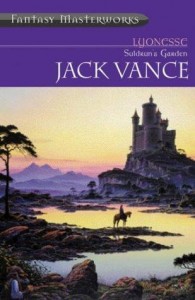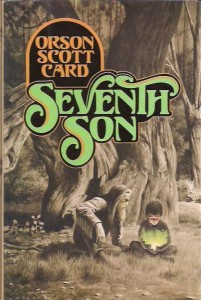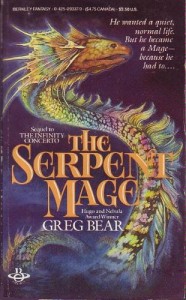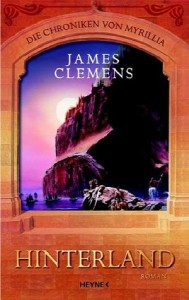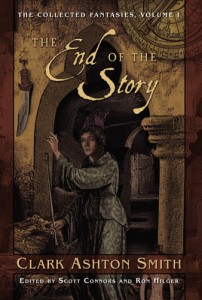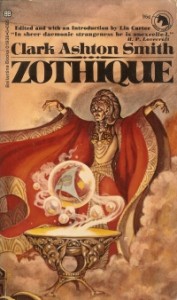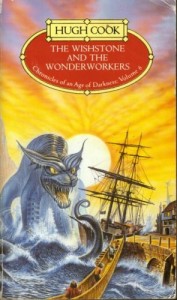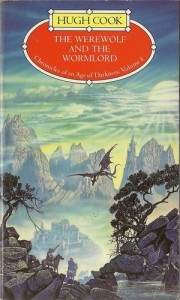Bloggerin Sady Doyle hat sich A Song of Ice and Fire vorgenommen und kommt unter Genderaspekten zu einer vernichtenden Kritik. Entschiedene Reaktionen darauf bleiben natürlich nicht aus, so etwa von E.D. Kain oder von Alyssa Rosenberg.
Doyles Kritik ist in der Tat in mancherlei Hinsicht überspitzt und büßt ihre Legitimation vor allem durch die Ausweitung auf ein ganzes Genre ein:
I could talk about how the impulse to revisit an airbrushed, dragon-infested Medieval Europe strikes me as fundamentally conservative — a yearning for a time when (white) men brandished swords for their King, (white) women stayed in the castle and made babies, marriage was a beautiful sacrament between a consenting adult and whichever fourteen-year-old girl he could manage to buy off her Dad, and poor people and people of color were mostly invisible — or how racism and sexism have been built into the genre ever since Tolkien.
Auf Tolkien wird noch unter einem anderen Gesichtspunkt zurückzukommen sein, aber zunächst bleibt festzuhalten, dass ein solcher Rundumschlag natürlich wenig zielführend ist.
Rosenbergs kritische Anmerkung zu Doyles Vorgehensweise ist somit mehr als nachvollziehbar:
It is much, much easier to dismiss an entire genre or way of engaging with culture than to sort through it, to learn about the way people read it and take meaning from it, to identify, for example, the reasons that fantasy literature can be both profoundly meaningful to women and a fulfillment of male fantasies. But declaring something unsalvageable just means that you’re lazy, not that you’re correct.
Problematisch wird ihre Argumentation hingegen dort, wo sie auf Doyles Kritik am nicht unbedingt progressiven Geschlechterrollenverständnis in Martins Welt und an der wiederkehrenden Schilderung von häufig sexuell konnotierter Gewalt gegen Frauengestalten eingeht:
A world where women are perfectly safe, perfectly competent, and society is perfectly engineered to produce those conditions strikes me as one where we can’t tell any very interesting stories about women’s struggles and women’s liberation. If we tell ourselves stories in order to live, it doesn’t strike me that we do ourselves any favors as active feminists by leaching depictions of sexual violence, women making bad decisions, and institutionalized sexism from our fiction, or by dismissing entire swaths of consumers or modes of consuming fiction.
In eine ähnliche Richtung argumentiert auch Kain:
Sady thinks that because there are dragons and zombies, Martin should be able to stretch the truth and make women equal to men, free from domestic abuse and rape and the other horrors women have always faced.
Would this be a service to women, a victory for feminism?
I don’t think so. Ignoring sexual abuse and pretending violence toward women doesn’t exist does not serve women at all. Quite the contrary. One of the greatest flaws in a lot of fantasy is that women are portrayed as basically sexy warriors. Feudal systems with men and women with equal rights, where all women are just as tough as men and never face any sort of sexism or unwanted sexual advances really is a fantasy, but not one that accurately reflects the world as it is. And that’s what fantasy, for all its dragons and werewolves, is meant to do. Good fantasy creates a world that reflects our own, warts and all.
Der alte Hinweis Damals war das halt so, der immer gern zur Erklärung herangezogen wird, wenn es um problematische Darstellungen von Geschlechterrollen in Fantasywelten geht, erhält damit quasi den argumentativen Ritterschlag: Eine Abweichung von in der realen Welt historisch verbürgten Verhältnissen erweise den Frauen und dem Feminismus einen Bärendienst. Aber trifft das zu?
Mitnichten.
So verdienstvoll die literarische Aufarbeitung eines Ankämpfens gegen restriktive Geschlechterrollen im Einzelfall sein mag, sie leistet immer auch eines: Eine implizite Anerkennung des Status quo als unvermeidlich oder vielleicht gar naturgegeben. Daran ändert auch der von Doyles Kritikern hervorgehobene Umstand nichts, dass George R. R. Martin die Unterdrückung und Misshandlung von Frauen ja nicht als etwas Gutes schildere (wie sehr er umgekehrt eine moralische Verurteilung vornimmt, bleibt offen). Ganz gleich, was die einzelne Gestalt im Endeffekt erreichen mag, ein überkommenes Geschlechterrollenverständnis mit all seinen negativen Begleiterscheinungen wird zunächst einmal bestätigt und normalisiert.
Dabei könnte es vielleicht hilfreich sein, sich eine andere Normalität zumindest einmal vorzustellen.
Die Erkenntnis, dass gerade auch einer auf den ersten Blick unrealistischen Schilderung durchaus Sprengkraft innewohnen kann, ist nicht neu. So beschreibt etwa J.R.R. Tolkien in seinem bekannten Essay On Fairy Stories ein interessantes Gedankenspiel, das wunderbar die Problematik des Realismusarguments unabhängig vom spezifischen Thema aufzeigt:
Als Beispiel nur eine Kleinigkeit: Wenn man die elektrischen Straßenlaternen, wie sie nach Massenschablonen gefertigt werden, bei gegebenem Anlaß in einer Erzählung nicht erwähnte (oder zumindest kein Aufhebens von ihnen machte), so wäre dies ein Stück “Wirklichkeitsflucht” (…). Vielleicht wurden die Laternen aus der Erzählung einfach deshalb ferngehalten, weil sie als Laternen nichts taugen, und möglicherweise ist ebendies eine der Lehren, die aus der Geschichte zu ziehen sind. Aber schon wird das schwere Geschütz aufgefahren: “Die elektrische Straßenbeleuchtung”, so sagt man, “ist aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken.” (…)
Der Eskapist ist den Launen der Mode nicht so ergeben wie seine Gegner. Er macht nicht Dinge (die man aus ganz vernünftigen Gründen geringschätzen kann) zu seinen Herren oder Göttern, indem er sie als unverzichtbar oder sogar als “unerbittlich” anbetet. Und seine Gegner, so leicht sie bereit sind, ihn zu verachten, haben doch keine Gewähr, daß er es beim Ignorieren bewenden läßt: Womöglich will er die Menschen aufhetzen, die Straßenlaternen niederzureißen.
Zugegeben, Tolkien weist im weiteren Verlauf seines Essays auch auf die möglichen Gefahren einer solchen Konstellation hin, doch seine zentrale Beobachtung bewahrt ihre Gültigkeit: Scheinbarer oder tatsächlicher Eskapismus kann durchaus eine Wirkung auf die Realität entfalten und mithin in manchen Fällen konstruktiv sein.
Gerade unter diesem Aspekt wäre es durchaus wünschenswert, wenn die Leserschaft nicht immer wieder ausgerechnet im heiklen Bereich der Genderproblematik einer ständigen Selbstbeschränkung der Fantasy auf einen vermeintlich löblichen „Realismus“ das Wort reden würde.