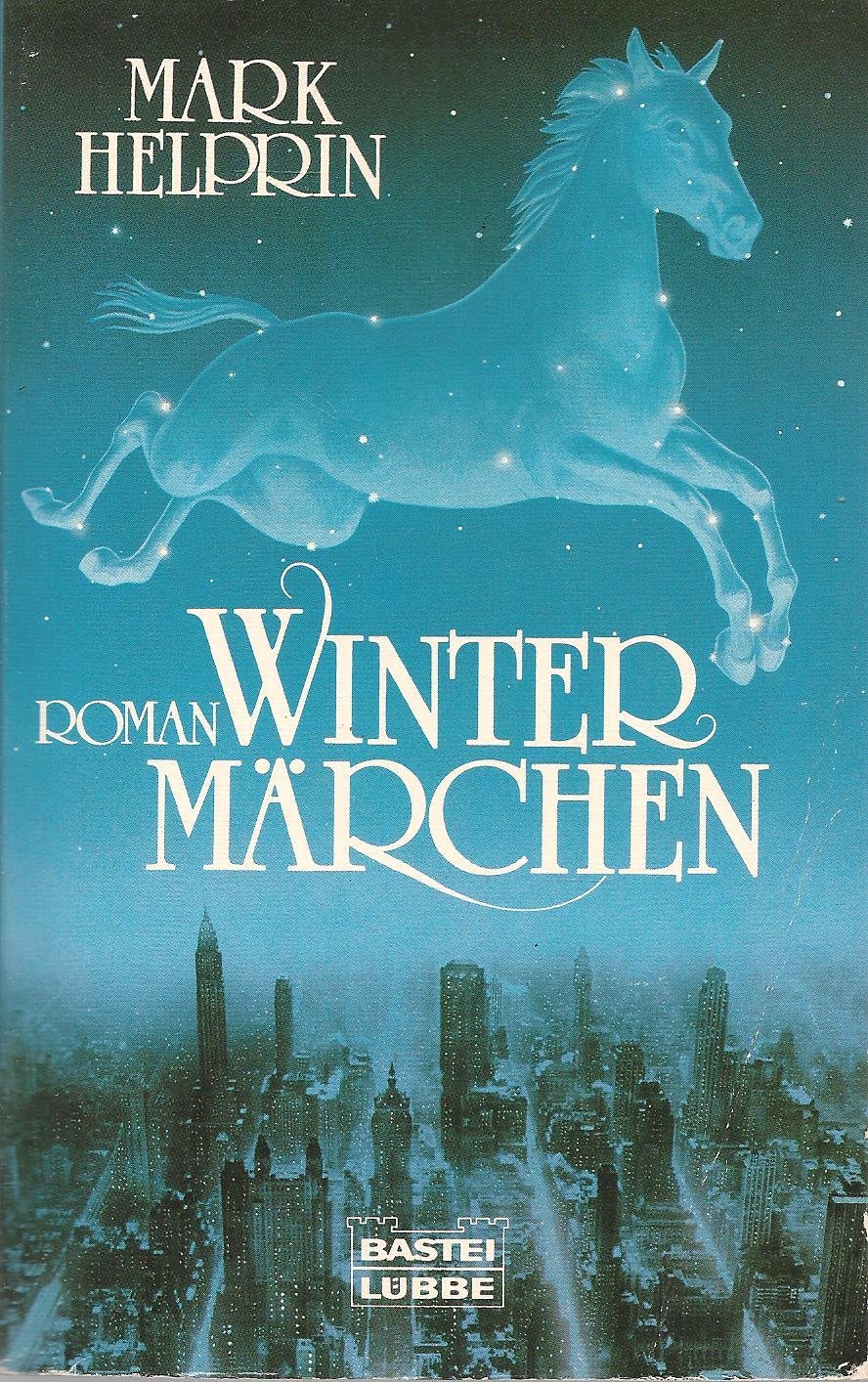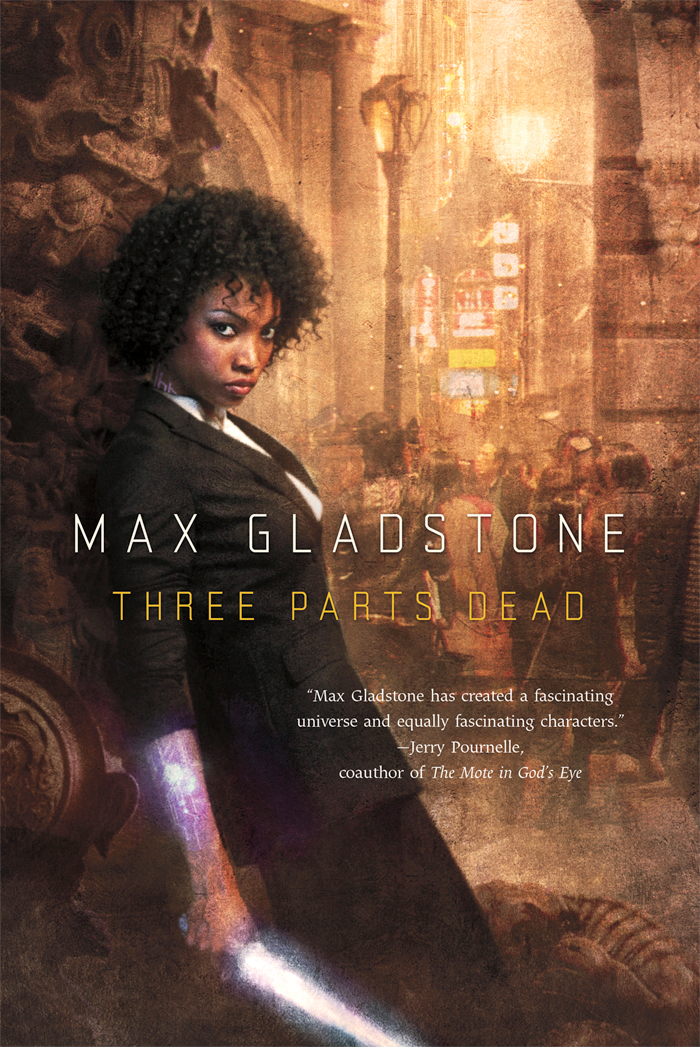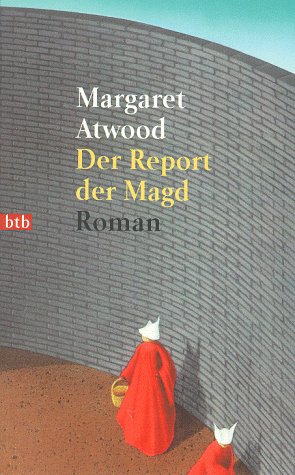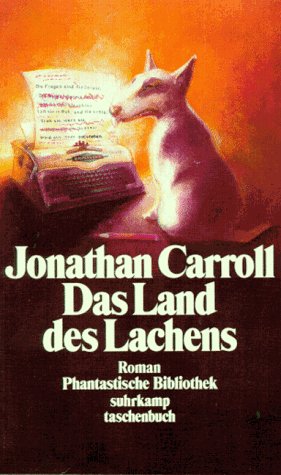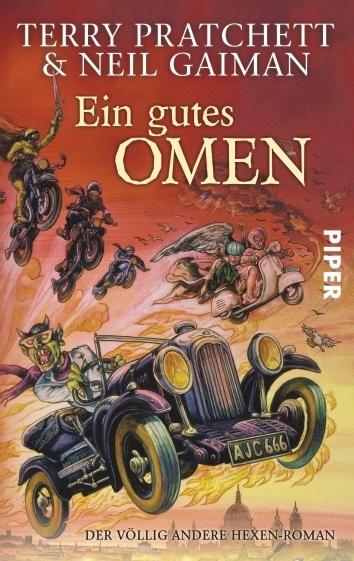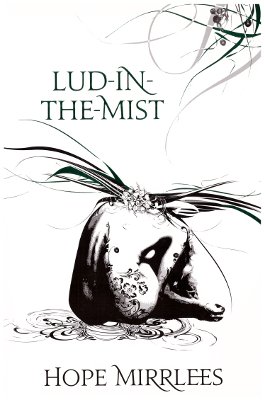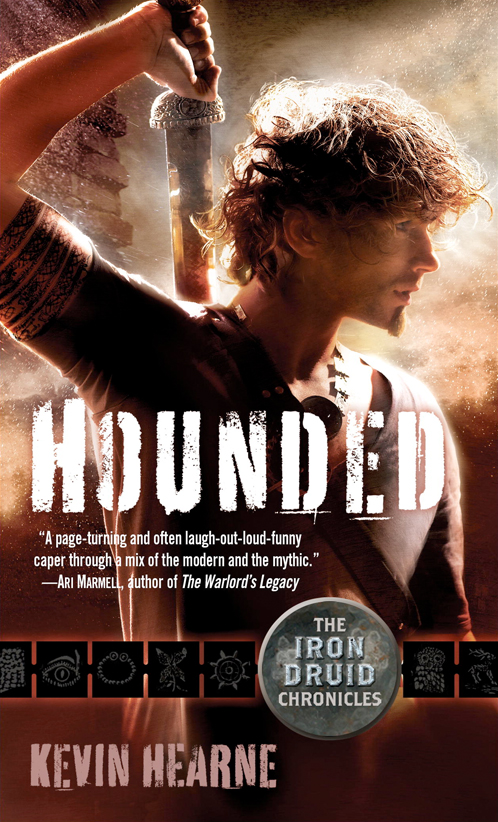Unser Buch des Monats Februar ist ein weiterer viel zu wenig beachteter Klassiker: Leslie Barringers Gerfalke (ISBN 3-596-22741-0; im Original: Gerfalcon), der erste Band seines in einem alternativen spätmittelalterlichen Frankreich angesiedelten Neustrischen Zyklus.
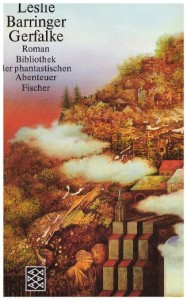 Auf den ersten Blick scheint das schon 1927 erschienene Buch ein Entwicklungsroman wie so viele zu sein: Früh verwaist wächst der junge Adlige Raoul von Marckmont unter der Vormundschaft eines missgünstigen Onkels heran und hat angesichts seiner musischen Interessen einiges an Spott und Zurücksetzungen auszustehen. Als der unerlaubte Besuch eines Turniers schlimmere Folgen denn je für ihn nach sich zieht, flieht er aus der Obhut seiner Verwandten. Doch statt, wie zunächst geplant, Schutz bei Freunden zu finden, bekommt er es mit Hexen und Raubrittern zu tun und muss bald befürchten, seine herbeigesehnte Volljährigkeit gar nicht mehr zu erleben.
Auf den ersten Blick scheint das schon 1927 erschienene Buch ein Entwicklungsroman wie so viele zu sein: Früh verwaist wächst der junge Adlige Raoul von Marckmont unter der Vormundschaft eines missgünstigen Onkels heran und hat angesichts seiner musischen Interessen einiges an Spott und Zurücksetzungen auszustehen. Als der unerlaubte Besuch eines Turniers schlimmere Folgen denn je für ihn nach sich zieht, flieht er aus der Obhut seiner Verwandten. Doch statt, wie zunächst geplant, Schutz bei Freunden zu finden, bekommt er es mit Hexen und Raubrittern zu tun und muss bald befürchten, seine herbeigesehnte Volljährigkeit gar nicht mehr zu erleben.
Dass man den Gerfalken trotz des recht klassischen Grundgerüsts der Handlung als frisch, abwechslungsreich und erstaunlich aktuell empfindet, ist zum einen der Tatsache geschuldet, dass Barringer einiges vorwegnimmt, was die moderne Fantasy gern als eigene Innovation beansprucht, so etwa die Darstellung eines unromantisierten Mittelalters oder eine differenzierte Auseinandersetzung mit Geschlechterrollen und sozialer Ungleichheit, zum anderen aber der Figur des Raoul, aus dessen Perspektive man das Geschehen überwiegend erlebt. Anders als bei manch einem Leidensgenossen in ähnlich gearteten Geschichten ist seine Charakterisierung als nachdenklicher Träumer nicht nur ein oberflächlicher Lack, sondern bestimmend für seinen reflektierten und beständig kommentierenden Umgang mit den Phänomenen seiner Umwelt, der trotz einiger entsetzlicher Erlebnisse ein Abgleiten in bloßen Zynismus verhindert.
Dieses Philosophieren bleibt dabei in seinen Grundlagen konsequent dem Mittelalter verhaftet (über das Barringer offensichtlich profunde Kenntnisse besaß), und so ist Raouls Weg durch das oft verstörende, ebenso häufig aber auch beglückende Neustrien zugleich eine Entdeckungsreise durch eine Epoche der europäischen Geistesgeschichte, von spezifischen Formen christlicher Religiosität über die Astrologie bis hin zur höfischen Dichtung, die dem Protagonisten mehr als einmal und mit wechselndem Erfolg zum Ausdrucksmittel wird.
Erzählt wird dies alles in einer poetischen Sprache, die auch in der deutschen Fassung zum Tragen kommt (wenn es auch einige für ältere Übersetzungen nicht untypische Merkwürdigkeiten gibt – so darf man z.B. getrost spekulieren, ob sich hinter dem mehrfach auftauchenden ominösen Wintergarten im Englischen wohl ein solar verbergen mag). Alles in allem glückt so ein Besuch in einer fernen Welt, die trotz ihrer ungeschönten Authentizität viel menschliche Wärme zulässt und einen in mehr als einer Hinsicht bezaubert.
Category: Buch des Monats
Unser Buch des Monats Januar stammt vom äußersten Rand des Genres: Rosemary Sutcliffs Sword at Sunset (1963, bisher keine deutsche Übersetzung; ISBN: 978-1556527593), eine Artussagenvariante, die den phantastischen Stoff in ein vorzüglich recherchiertes historisches Gewand kleidet. Wer Fantasy vor allem liest, um tief in 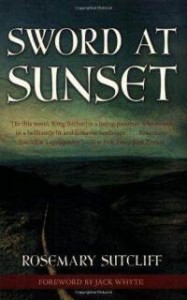 unvertraute Welten eintauchen zu können, ist hier gut bedient, denn die Spätantike in all ihrer Fremdheit und Vielfalt, vergänglichen Pracht und gelegentlichen Schrecklichkeit ist wohl selten so atmosphärisch eingefangen worden wie hier. Dennoch wäre es verfehlt, den Roman rein auf die Handlung um den Abwehrkampf der romanisierten Kelten und insbesondere des eindrucksvollen Ich-Erzählers Artos gegen die angelsächsischen Eroberer reduzieren zu wollen. Denn was all die Geschehnisse, die sich zumindest theoretisch so oder so ähnlich abgespielt haben könnten, im Hintergrund begleitet und mit zusätzlicher Bedeutung auflädt, ist die subtile Möglichkeit des Übernatürlichen.
unvertraute Welten eintauchen zu können, ist hier gut bedient, denn die Spätantike in all ihrer Fremdheit und Vielfalt, vergänglichen Pracht und gelegentlichen Schrecklichkeit ist wohl selten so atmosphärisch eingefangen worden wie hier. Dennoch wäre es verfehlt, den Roman rein auf die Handlung um den Abwehrkampf der romanisierten Kelten und insbesondere des eindrucksvollen Ich-Erzählers Artos gegen die angelsächsischen Eroberer reduzieren zu wollen. Denn was all die Geschehnisse, die sich zumindest theoretisch so oder so ähnlich abgespielt haben könnten, im Hintergrund begleitet und mit zusätzlicher Bedeutung auflädt, ist die subtile Möglichkeit des Übernatürlichen.
Sehen die Helden nur Polarlichter oder doch ein himmlisches Zeichen, das auf eine entscheidende Entwicklung vorausverweist? Ist Artos nach seiner ungewollten Verwicklung in eine inzestuöse Beziehung traumatisiert, oder hat ihn in Wahrheit ein düsterer Fluch getroffen? Löst ein symbolträchtiger Edelstein sich nur zufällig aus der Fassung, oder deutet sich hier auf wundersame Weise die Zukunft zweier Menschen an? Ist die weise Alte aus der marginalisierten Urbevölkerung nur eine gewiefte Menschenkennerin, oder verfügt sie tatsächlich über die hellseherischen Fähigkeiten, die sie sich zuschreibt?
All das steht nicht fest und muss aufgrund der Erzählperspektive auch ein ungelöstes Rätsel bleiben, doch es offenbart, wie dicht unter der Oberfläche des Realistischen Zauber und Poesie angesiedelt sein können. In gewissem Maße ist sich auch Artos selbst dessen bewusst und lässt es gezielt für seine eigene Legende arbeiten, nicht etwa aus Geltungsdrang, sondern aus der Sehnsucht heraus, in chaotischen Zeiten zumindest einen Teil der Ideale und der Schönheit einer dem Untergang geweihten Epoche in die Zukunft zu retten und den Menschen Hoffnung zu spenden. Das Dichterische und Phantastische ist – so könnte man die Botschaft des Romans vielleicht zusammenfassen – kein schierer Eskapismus, sondern vielmehr ein Werkzeug zur Bewältigung der Tücken des wirklichen Lebens.
In der Hoffnung, dass auch euch 2014 manch eine schöne Geschichte (vielleicht ja diese hier?) den Alltag versüßt, euch allen ein gutes neues Jahr!
Die Essenz unseres Buchs des Monats im Dezember sind Schnee und Kälte, wie sie eigentlich nur in Geschichten oder winternostalgischen Anfällen auftreten: Mark Helprins Wintermärchen zeichnet die Entwicklung einer Stadt und eines dieser Stadt verpflichteten Zeitungshauses nach, verbindet die Zeiten durch einen jungen Mann und ein weißes Pferd, und die bedeutenden Szenen oder vielmehr beinahe die ganze Handlung spielt sich im tiefsten Winter ab, wenn sich der Schnee auf dem Land bergehoch türmt und über den Straßenschluchten ein eiskalter Sternenhimmel steht.
Die Geschichte des Waisenjungen Peter Lake beginnt in einem magisch verfremdeten New York um die Jahrhundertwende – Gangs ziehen durch die Straßen, der technische Aufbruch ist an allen Ecken spürbar, und mitten darin begegnet man Lichtgestalten und irrwitzigen Questen, so dass man schnell begreift, dass sich aus der historischen Anmutung eine märchenhafte, entrückte Weltsicht entfaltet.
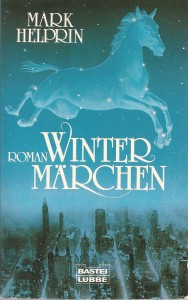 Peter hat ein außergewöhnliches Talent für den Umgang mit Maschinen, ist aber stattdessen gezwungen, einer kriminellen Karriere zu folgen, und noch dazu immer auf der Flucht vor seinem Todfeind, dem Anführer einer rivalisierenden Gang. Zum Glück hat er einen treuen Freund, auf den er sich in brenzligen Situationen verlassen kann: den weißen Hengst Athansor. Und dieser ist auch nicht ganz unbeteiligt daran, dass Peter sein Schicksal an das der Verlegerfamilie Penn (und vor allem der Tochter des Hauses) knüpft.
Peter hat ein außergewöhnliches Talent für den Umgang mit Maschinen, ist aber stattdessen gezwungen, einer kriminellen Karriere zu folgen, und noch dazu immer auf der Flucht vor seinem Todfeind, dem Anführer einer rivalisierenden Gang. Zum Glück hat er einen treuen Freund, auf den er sich in brenzligen Situationen verlassen kann: den weißen Hengst Athansor. Und dieser ist auch nicht ganz unbeteiligt daran, dass Peter sein Schicksal an das der Verlegerfamilie Penn (und vor allem der Tochter des Hauses) knüpft.
Der nostalgische Grundton, der durch die schwelgerische, poetische Sprache getragen wird, bleibt auch erhalten, wenn die Handlung über einige Zeit- bzw. Pferdesprünge in der Moderne angelangt ist: Das Gefühl des Fortschritts wird eher über die wachsende Größe der Stadt, einer Maschinerie aus Menschen und Architektur, erreicht, während das eigentliche Technikbild altmodisch wirkt, aber durchaus abstruse Auswüchse hervorbringt.
Die Zusammenhänge und Querverbindungen innerhalb des ansehnlichen Ensembles aus teils überlebensgroßen Figuren klären sich mitunter erst am Ende, dann wird die Geschichte auch zunehmend phantastischer, ohne dabei auf bewährte oder gar ausgelutschte Elemente des Genres zurückzugreifen: Es gibt zwar märchenhafte Rettungen und ein relativ klares Bild von Gut und Böse, doch das eigentlich Magische ist die Art, wie Helprin den Winter heraufbeschwören kann, ob heimelig oder gnadenlos frostig, ob zart klirrend oder wuchtig. In keinem anderen Roman wird so stilvoll gebibbert, und wer bei grandiosen Bildern wie den Kutschfahrten durch verschneite Seenlandschaften oder der funkelnden Buden- und Marktlandschaft für Eisläufer auf dem zugefrorenen Hudson River keine leuchtenden Augen bekommt, der träumt sich vermutlich ohnehin schon längst in die Tropen.
Von Winter’s Tale (1984, dt. 1984, ISBN: 3404113144) steht übrigens im kommenden Jahr eine Verfilmung an, und im Zuge dessen wird auch die deutsche Übersetzung von Hartmut Zahn neu aufgelegt werden – bis dahin ist das Buch nur antiquarisch erhältlich.
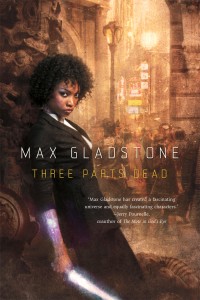 Mit unserem Buch des Monats im November tauchen wir ein in eine imposante und fantastische Welt, die so komplex gestaltet ist, dass wir uns nur mit Mühe und Not an einer kurzen Beschreibung versuchen können.
Mit unserem Buch des Monats im November tauchen wir ein in eine imposante und fantastische Welt, die so komplex gestaltet ist, dass wir uns nur mit Mühe und Not an einer kurzen Beschreibung versuchen können.
Three Parts Dead (Tor Books, ISBN: 9780765333100) verstrickt Aspekte der Fantasy mit technologischer Entwicklung. Manch einer würde nun an Steampunk denken, doch dieser Roman wäre damit falsch klassifiziert. Während die meisten Urban-Fantasy-Romane die Magie in die Gegenwart integrieren, kreiert dieser Roman eine magisch basierte Welt, die ihren eigenen Entwicklungsschub hin zum Konzerndenken hatte. Die Welt in Three Parts Dead fühlt sich älter und gewichtiger an und gleichzeitig greift sie dabei moderne Mechanismen auf; die von Gargoyles bewachten Wolkenkratzer sind ebenso ein Beispiel für die gelungene Mischung wie die Massenproduktion, die nicht zu Geld, sondern zu mehr Seelenanteilen führt.
In der übergeordneten Handlung gilt es den Tod der Gottheit Kos Everburn aufzuklären, weshalb Nekromantin Tara damit beauftragt wird, den Fall zu untersuchen. Um mehr über die Geschichte selbst zu erfahren, empfehlen wir auch einen Blick in die Rezension.
Max Gladstones Debütroman ist eine echte Überraschung und Bereicherung für das Genre, und die deutschen Verlage täten sicher gut daran, sich möglichst schnell die Rechte zu sichern. Das Buch ist ein Must-Read für alle LeserInnen die gerne in neue, intelligente Welten eintauchen und in denen selbst Dinge wie Nekromantie, Vampire und Gottheiten in einen völlig neuen Kontext gesetzt werden. Völlig zu Recht hat dieser noch junge Roman schon den ein oder anderen Preis abgeräumt und wurde noch öfter für einen nominiert.
Wer bereits in den Genuss von Three Parts Dead gekommen ist, wird sich sicher freuen, dass vor wenigen Tagen auch der zweite Roman von Gladstone Two Serpents Rise erschienen ist.
 Unser Buch des Monats im Oktober, dessen nicht ganz geschickt gewählten deutschen Titel man am besten gleich wieder vergisst und sich dafür den schönen Originaltitel Travel Light merkt, hat nicht nur schon mehr als 60 Jahre auf dem Buckel, sondern beginnt auch ganz klassisch – mit einem Waisenkind: Halla wird als Säugling aus Stiefmuttergründen ausgesetzt, hat aber zum Glück eine treue Amme mit einem guten Trick in der Tasche: Sie kann sich in eine Bärin verwandeln und zieht als solche fortan Halla im Wald auf.
Unser Buch des Monats im Oktober, dessen nicht ganz geschickt gewählten deutschen Titel man am besten gleich wieder vergisst und sich dafür den schönen Originaltitel Travel Light merkt, hat nicht nur schon mehr als 60 Jahre auf dem Buckel, sondern beginnt auch ganz klassisch – mit einem Waisenkind: Halla wird als Säugling aus Stiefmuttergründen ausgesetzt, hat aber zum Glück eine treue Amme mit einem guten Trick in der Tasche: Sie kann sich in eine Bärin verwandeln und zieht als solche fortan Halla im Wald auf.
Hallas Schicksal ist es aber nicht, selbst Bär zu werden, auch wenn sie eine ganze Weile davon überzeugt ist, und so nimmt ihre Wanderung durch verschiedene Gesellschaften und Länder ihren Lauf. Man kann Travel Light durchaus als Kinderbuch lesen, mit seinen starken märchenhaften Elementen, der jungen Heldin und dem geringen Umfang. Als Erwachsener hat man aber garantiert seine Freude an dem feinen Witz und den subtilen Brüchen, die sämtliche Klischees unterlaufen. Naomi Mitchison war eine äußerst belesene, politisch aktive Autorin, und so klingen auch in dieser vordergründig simplen Coming-of-Age-Erzählung nicht nur nordische Sagas und mehr durch, sondern man spürt die Auseinandersetzung mit Geschlechterrollen und gesellschaftlichen Strukturen. Halla ist dabei eine wunderbare Heldin, deren unschuldiges Kinderdenken alsbald von ihrer Drachenbekanntschaft gebrochen wird, von der sie vor allem zwei Dinge lernt: Goldgier und Heldenhass. Der etwas schräge Blickwinkel der Protagonistin bleibt auch bei ihren weiteren Abenteuern ein Vergnügen.
Halla lernt Tiersprachen, begegnet alten Göttern und baut auf ihrer kulturenüberspannenden Reise, die vom Norden nach Konstantinopel und in den Kaukasus führt, natürlich früher oder später auch feinfühlig beschriebene Beziehungen zu Menschen auf – an dieser Stelle schlägt Mitchison auch eine Brücke zu ihrem Roman Kornkönig und Frühlingsbraut. Die Welt, durch die Halla zieht, ist im Wandel, es findet ein Austausch der Kulturen statt, Religion verändert sich, Drachen und Helden sind bereits Raritäten, was sich auch in Hallas stets wechselnden Namen im Verlauf der Geschichte zeigt: Halla Bärenkind, Halla Heldentod, Halla Gottesgeschenk.
Mit diesem feinsinnig-zauberhaften Roman, den man in einer Sitzung weglesen kann, taucht man in eine durchaus aufrichtig geschilderte Märchenwelt ein, während er gleichzeitig nicht nur durch das Geschlecht der Hauptfigur Sagas und Heldenepen vergnügt auf die Schippe nimmt.
Travel Light (1952) wurde als Eine Reise durch die Zeit (1987) von Manfred Ohl und Hans Sartorius übersetzt und ist nur noch antiquarisch zu beziehen (ISBN: 3-608-95493-7).
Bei manchen Büchern besteht die Gefahr, dass sie die Augen für Dinge öffnen, die lieber ungesehen, ungelesen bleiben wollen. Unser Buch des Monats Der Report der Magd von Margaret Atwood ist kein Buch, das sich beim Leser einschmeichelt. Es erschüttert zutiefst, ist verstörend menschlich und beschreibt schonungslos die Entmenschlichung eines ganzen Geschlechts. Es ist eine Dystopie mit Macht. Es ist eine Warnung. Aber vor allem ist es: ein unbedingt lesenwertes Buch.
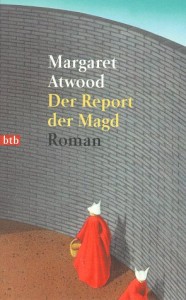 Der Report der Magd erzählt das Schicksal einer jungen Frau, die in die Mühlen der religiös-fundementalistischen Militärdiktatur des Staates Gilead geraten ist. Sie trägt keinen Namen mehr, sondern eine Bezeichnung: Desfred – sie ist die Zweitfrau des Kommandanten Fred, oder Frederick? Wir erfahren auch seinen vollen Namen nie, Vornamen sind in der Welt von Gilead eine unaussprechliche Intimität. Desfred ist Besitz und Körper. Ihre Aufgabe ist es, dem Kommandanten ein Kind zu gebären, denn in diesem Amerika der Zukunft verzeichnet die „europide Rasse“ einen drastischen Geburtenrückgang durch Unfruchtbarkeit, Sterilität und der Kindestötungen von „Unbabys“, entstellt zur Welt kommenden Kindern. Desfred ist eine Magd: eine der wenigen noch fruchtbaren Frauen.
Der Report der Magd erzählt das Schicksal einer jungen Frau, die in die Mühlen der religiös-fundementalistischen Militärdiktatur des Staates Gilead geraten ist. Sie trägt keinen Namen mehr, sondern eine Bezeichnung: Desfred – sie ist die Zweitfrau des Kommandanten Fred, oder Frederick? Wir erfahren auch seinen vollen Namen nie, Vornamen sind in der Welt von Gilead eine unaussprechliche Intimität. Desfred ist Besitz und Körper. Ihre Aufgabe ist es, dem Kommandanten ein Kind zu gebären, denn in diesem Amerika der Zukunft verzeichnet die „europide Rasse“ einen drastischen Geburtenrückgang durch Unfruchtbarkeit, Sterilität und der Kindestötungen von „Unbabys“, entstellt zur Welt kommenden Kindern. Desfred ist eine Magd: eine der wenigen noch fruchtbaren Frauen.
Die Instrumentalisierung des Geschlechts ist in Gilead absolut: Frauen sind unterteilt in unfruchtbare, aufrührerische „Unfrauen“, die in Arbeitskolonien auf den Tod warten, in „Marthas“, die als Hausdiener den Kommandanten dienen und in die „Mägde“, die der Reproduktion dienen. Angeleitet und -gelernt werden sie von „Tanten“: Frauen, die sich im Machtgefüge der Diktatur ein Stück Freiheit erkaufen, indem sie selbst zu Unterdrückern werden. Über allen stehen jedoch die Ehefrauen, die an der Seite ihrer einflussreichen Männer leben und dennoch gänzlich elend wirken, wenn sie am Geschlechtsakt zwischen Magd und Mann nur als Zuschauerin teilhaben.
Desfred besaß einst eine Familie: einen Ehemann namens Luke und eine namenlose Tochter. Sie selbst ist Tochter einer radikalen Feministin, die im Kampf für das Recht auf Abtreibung und sexuelle Selbstbestimmtheit Gilead nicht kommen sah. Als die Familie fliehen will, ist es zu spät – und der Leser durchlebt Desfreds Indoktrinierung, ihre Entfremdung von ihrem Körper, erlebt ihr Funktionieren, ihr Aufbegehren und ihr Scheitern. Doch auch wenn Desfred keine Kämpferin ist, eines erlebt der Leser nie: ihre Kapitulation. Es bleibt ihr die Flucht in Gedanken. Inmitten dieses Szenarios ist es das Erstaunlichste, dass uns Desfred vor allem eines lehren kann: Menschlichkeit.
Atwood zeichnet ihre Figuren trotz aller Radikalität wie graue Schatten: weder gut noch böse, undurchsichtig, facettenreich. Männer wie Frauen werden zu Marionetten, die ihre eigenen Fäden aus Angst vor der diktatorischen Gewalt nicht kappen. Das Machtgefüge Gileads scheint unumstößlich, und verführerisch erscheinen die Reden der „Tanten“: in der abgeschlossenen Welt von Gilead müssen sich Frauen nicht mehr fürchten, im Dunkeln auf die Straße zu gehen. Vergewaltiger werden gnadenlos verfolgt, Gewalt gegen (schwangere) Frauen mit dem Henkerstod bestraft. Es ist die diktatorische „Freiheit von“ – eine „Freiheit zu“ gibt es nur noch im Verborgenen, wo selbst die Kommandanten auf der Suche nach Jezebel sind. Die Instrumentalisierung ist absolut: denn wenn unfreiwilliger Sex der verordneten Arterhaltung dient, wird auch Liebe und sexuelle Erfüllung zum Regelbruch. Das Erschütternde des Buches ist nicht die Kühnheit des dystopischen Entwurfs, es ist seine Denkbarkeit.
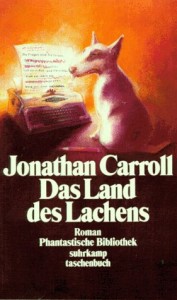 Das Buch des Monats im August hätte auch gut zu den Fünf Büchern über Bücher gepasst, denn darin geht es vor allem um eines: Eine an Obsession grenzende Büchersucht. Das Objekt der Begierde in Das Land des Lachens von Jonathan Carroll ist der (fiktive) Kinderbuch-Autor Marshall France. Thomas Abbey, ein etwas zielloser Mann mit einem ernsthaften Vaterkonflikt, durchforstet mit Vorliebe Antiquariate nach Frances Werken, die mit ihren eindringlichen phantastischen Figuren und ihrer filigranen, beinahe gespenstischen Welt in ihm wohlige Kindheitserinnerungen heraufbeschwören. In einer solchen Situation lernt er Saxony kennen, eine weitere France-Jüngerin, in der er zunächst eine Nebenbuhlerin sieht – kann ja gar nicht sein, dass es einen anderen Fan gibt, der den angebeteten Autor mit der gleichen Leidenschaft liebt! Trotzdem beschließen die beiden, sich zusammenzutun und eine ultimative Marshall-France-Biographie zu schreiben. Zu diesem Zweck reisen sie nach Galen, dem Ort, an den sich der Autor zurückzog und schließlich viel zu früh verstarb. Wenn man nun vermutet, dass es im Land des Lachens nicht viel zu lachen gibt, liegt man richtig – der Trip nach Galen führt nicht in eine Idylle, sondern in einen Abgrund.
Das Buch des Monats im August hätte auch gut zu den Fünf Büchern über Bücher gepasst, denn darin geht es vor allem um eines: Eine an Obsession grenzende Büchersucht. Das Objekt der Begierde in Das Land des Lachens von Jonathan Carroll ist der (fiktive) Kinderbuch-Autor Marshall France. Thomas Abbey, ein etwas zielloser Mann mit einem ernsthaften Vaterkonflikt, durchforstet mit Vorliebe Antiquariate nach Frances Werken, die mit ihren eindringlichen phantastischen Figuren und ihrer filigranen, beinahe gespenstischen Welt in ihm wohlige Kindheitserinnerungen heraufbeschwören. In einer solchen Situation lernt er Saxony kennen, eine weitere France-Jüngerin, in der er zunächst eine Nebenbuhlerin sieht – kann ja gar nicht sein, dass es einen anderen Fan gibt, der den angebeteten Autor mit der gleichen Leidenschaft liebt! Trotzdem beschließen die beiden, sich zusammenzutun und eine ultimative Marshall-France-Biographie zu schreiben. Zu diesem Zweck reisen sie nach Galen, dem Ort, an den sich der Autor zurückzog und schließlich viel zu früh verstarb. Wenn man nun vermutet, dass es im Land des Lachens nicht viel zu lachen gibt, liegt man richtig – der Trip nach Galen führt nicht in eine Idylle, sondern in einen Abgrund.
Dort beginnen deutlich phantastischere Elemente als lediglich ein erfundener Star-Autor in die Handlung einzubrechen: In dem beschaulichen Örtchen wimmelt es nicht nur von unheimlich intelligenten Bullterriern (Frances Lieblingshunden), auch die dem Biographen-Duo gegenüber höchst aufgeschlossenen Einwohner kommen Thomas und Saxony merkwürdig vertraut vor. Die einzige, die sich der Recherche anfangs entgegenstellt, ist ausgerechnet Frances geheimnisvolle Tochter Anna. Als die Biographie langsam Gestalt annimmt, werden auch die Zwischenfälle häufiger …
Mit Horrorelementen und einer symbolisch stark aufgeladenen und mit Frances Werk verwobenen Handlung spielt Das Land des Lachens mit Autorschaft und Autorenverehrung, Fiktion und Realität und steuert auf einen Clou zu, der wahrscheinlich niemanden mehr überrascht, aber selten auf so verstörende Weise umgesetzt wurde.
Kleiner Wermutstropfen: Als Bücherwurm würde man sich am liebsten sofort – vergeblich – im Antiquariat seines Vertrauens auf die Suche nach Marshall-France-Klassikern wie “Das Land des Lachens” oder “Der grüne Hund” begeben, die bestimmt zu den unvergesslichsten Büchern zählen, die niemals ein Mensch gelesen hat …
Die deutsche Übersetzung Das Land des Lachens von Rudolf Hermstein (1986, ISBN 3518384546) ist nur noch antiquarisch erhältlich, anders als die TB-Ausgabe des Originals Land of Laughs (1980, ISBN 0312873115).
Packt die Rettungswesten aus, denn die Apokalypse naht! Wir haben ein neues Buch des Monats ausgegraben: Ein gutes Omen (ISBN: 978-3492285056; im Original erschienen als Good Omens) von Terry Pratchett und Neil Gaiman – zwei Autoren, die einzeln schon für Begeisterung sorgen, in der Kombination aber zu einer herrlichen Symbiose verschmelzen.
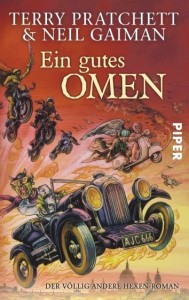 Der Termin für den bevorstehenden Weltuntergang rückt näher, doch irgendwie will der kleine Antichrist nicht so richtig Interesse dafür zeigen und bewundert lieber seinen Kaugummi mit Bananengeschmack. Kein Wunder, stellt sich doch bald heraus, dass der Junge im Krankenhaus vertauscht wurde und gar nicht der Antichrist ist. Zu allem Überfluss haben Engel Erziraphael und Dämon Crowley nicht wirklich Freude am Ende der Welt, schließlich lebt es sich auf Erden recht gemütlich und unterhaltsam, also beschließt man kurzerhand den Weltuntergang zu verhindern. Das Chaos ist vorprogrammiert, aber lässt sich so eine akkurate Prophezeiung wie die der Hexe Agnes Nutter wirklich ändern?
Der Termin für den bevorstehenden Weltuntergang rückt näher, doch irgendwie will der kleine Antichrist nicht so richtig Interesse dafür zeigen und bewundert lieber seinen Kaugummi mit Bananengeschmack. Kein Wunder, stellt sich doch bald heraus, dass der Junge im Krankenhaus vertauscht wurde und gar nicht der Antichrist ist. Zu allem Überfluss haben Engel Erziraphael und Dämon Crowley nicht wirklich Freude am Ende der Welt, schließlich lebt es sich auf Erden recht gemütlich und unterhaltsam, also beschließt man kurzerhand den Weltuntergang zu verhindern. Das Chaos ist vorprogrammiert, aber lässt sich so eine akkurate Prophezeiung wie die der Hexe Agnes Nutter wirklich ändern?
Ein gutes Omen ist genau das Buch, das man von den Autoren Terry Pratchett und Neil Gaiman erwarten würde. Eine schlüssig aufgebaute Handlung, Spannung und eine ordentliche Portion Spaß. Es ist ein Buch für heitere Stunden, gleichzeitig enthält es aber auch viele gesellschaftskritische und zum philosophischen Denken anregende Fragen. Da werden mal eben so die Idee von Gut und Böse, Glaubenssysteme, Technik, vor allem aber das Menschsein unter die Lupe genommen, und irgendwo zwischendrin huschen auch noch zwei Aliens durchs Bild, ebenso wie Hexen und Hexenjäger, Atlantis taucht auf undundund.
Den beiden Autoren ist es gelungen, eine Geschichte voller Witz, Weisheit und perfektem Chaos zu schreiben. Das ist Lachmuskeltraining vom Feinsten und gleichzeitig sitzt man nägelkauend da und bangt um das Schicksal der Helden. Jede Beschreibung dieses Romans kann die Oberfläche des Inhalts eigentlich nur zart streifen, ohne zuviel zu verraten, das den Lesespaß schmälern würde. Es ist in jedem Fall von Vorteil, wenn man mit der christlichen Mythologie einigermaßen vertraut ist und Scherze damit nicht zu persönlich nimmt.
Ein gutes Omen ist nicht nur ein Muss für Pratchett- und Gaiman-Fans, sondern für alle, die gerne herzhaft lachen und dabei gleichzeitig noch eine clever durchdachte Story mit tiefergehender Motivation suchen. Wer unser Buch des Monats im Juli also noch nicht kennt, sollte schleunigst die Hufe in die Hände nehmen und sich zum nächsten Buchladen begeben!
Ein heute leider nur noch wenig beachteter Klassiker aus dem Jahre 1926 ist unser Buch des Monats Juni: Hope Mirrlees’ Lud-in-the-Mist (ISBN: 978-1857987676; auf Deutsch als Flucht ins Feenland erschienen).
Im Kleinstaat Dorimare mit seiner Hauptst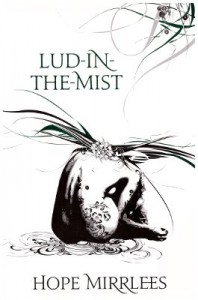 adt Lud-in-the-Mist herrscht biedere Wohlanständigkeit. Die durch Handel zu Reichtum gelangten Bewohner ignorieren geflissentlich die Existenz des angrenzenden Feenreichs, in dem nicht nur die Toten, sondern auch der sinnenfrohe abgesetzte Herzog von Dorimare und seine Entourage ihr Unwesen treiben. Schmuggel und Genuss der drogengleichen Feenfrüchte sind ein Tabuthema. Auch Bürgermeister Nathaniel Chanticleer wahrt nach außen hin eine propere Fassade, doch als sich sonderbare Vorfälle häufen und sogar seine eigenen Kinder in Kontakt mit der Feenwelt geraten, muss er sich auf Langverdrängtes besinnen und gegen die eingefahrenen Überzeugungen seiner Landsleute handeln …
adt Lud-in-the-Mist herrscht biedere Wohlanständigkeit. Die durch Handel zu Reichtum gelangten Bewohner ignorieren geflissentlich die Existenz des angrenzenden Feenreichs, in dem nicht nur die Toten, sondern auch der sinnenfrohe abgesetzte Herzog von Dorimare und seine Entourage ihr Unwesen treiben. Schmuggel und Genuss der drogengleichen Feenfrüchte sind ein Tabuthema. Auch Bürgermeister Nathaniel Chanticleer wahrt nach außen hin eine propere Fassade, doch als sich sonderbare Vorfälle häufen und sogar seine eigenen Kinder in Kontakt mit der Feenwelt geraten, muss er sich auf Langverdrängtes besinnen und gegen die eingefahrenen Überzeugungen seiner Landsleute handeln …
Die Inhaltsskizze allein verrät noch nicht, was diesen poetischen Roman ausmacht, der im Grunde jegliche Genregrenzen sprengt und neben dem ausgeprägten Fantasyelement zugleich ein halber Krimi und ein wenig auch Gesellschaftskomödie ist. Auf einem sprachlichen Niveau, das viele jüngere Fantasywerke leider nicht einmal ansatzweise erreichen, beschwört Mirrlees mit viel Humor und Leichtigkeit Wunderbares ebenso wie Unheimliches herauf (wobei sich beides nicht gegenseitig ausschließt). In ihren nostalgischen bis märchenhaften, aber niemals altbacken wirkenden Schauplätzen lässt es sich schwelgen, und die Wendungen, die der Plot einschlägt, wirken durchaus frisch und unerwartet.
Doch einen Gutteil seines Charmes verdankt Lud-in-the-Mist auch dem auf den ersten Blick gänzlich unheldenhaften Nathaniel Chanticleer, der einem im Laufe der Geschichte immer stärker ans Herz wächst und anders als etwa Tolkiens Bilbo Baggins nicht aus seinem beschaulichen Dasein in ein scharf abgegrenztes Abenteuer aufbricht, sondern beide Aspekte seines Lebens vereinen kann und muss.
So ist das wunderschöne Buch zugleich eine Auseinandersetzung mit der im frühen 20. Jahrhundert auch in der nichtphantastischen Literatur (man denke etwa an Thomas Mann!) populären, aber eigentlich zeitlosen Frage, ob und wie die wilden, dunkleren und nicht zuletzt auch künstlerischen Elemente des Menschseins in eine gebändigte Zivilisation zu integrieren sind. Die Antwort, die Mirrlees darauf findet, stimmt hoffnungsvoll.
Unsere Empfehlung im Mai ist kein einzelnes Buch, sondern gleich eine Buchreihe. The Iron Druid Chronicles (Die Chronik des Eisernen Druiden) ist noch relativ frisch auf dem Buchmarkt. 2011 erschien mit Hounded (Die Hetzjagd) das erste turbulente Abenteuer von Druide Atticus O’Sullivan und seinem Wolfshund Oberon.
Dass aber auch immer wieder kostbare Perlen unter der Flutwelle mittelprächtiger Neuerscheinungen sind, beweist Autor Kevin Hearne mit einem sehr humorvollen Grundkonzept, das weniger zynisch ausfällt als das der Harry Dresden-Reihe von Jim Butcher.

The Iron Druid Chronicles begleitet Atticus quer durch die verschiedensten Kulturkreise, die der modernen Leserschaft mehr oder weniger bekannt sind, von seinen keltischen Wurzeln ausgehend über Åsgard bis hin zu den trickreichen Göttern der Navajos. Jedes Buch erzählt eine in sich abgeschlossene Geschichte voller Witz, halsbrecherischen Aufgaben, Hexen, Vampiren, Werwölfen und vermischten Gottheiten und Dämonen sämtlicher Glaubensrichtungen und Mythologien, die Atticus mal mehr, mal weniger freundlich gesonnen sind. Unbemerkt von der normalen Gesellschaft tummeln sich all diese Kreaturen unter uns und treiben ihr Unwesen oder begleiten uns ganz unauffällig z.B. als Rechtsanwälte, Ärzte oder Buchhändler.
Geknüpft an Atticus’ Position als letzter Druide, sind die Bücher alle eher naturbezogen als von Großstadtgeflimmer geprägt. Seine Magie gewinnt der Druide nicht durch angeborene Fähigkeiten, sondern durch jahrelange Ausbildung und die Kraft, die ihm die Erdelemente zugestehen. Es ist eher sandig und staubig als gläsern und leuchtend, so dass man als Leser einen atmosphärisch natürlich wirkenden Weltenbau in der Wüste Arizonas erhält, in dem sich überraschender Tiefgang und Heiterkeit der Charaktere im Einklang gegenüberstehen.
Jeder, der sich bei einem Buch gerne auch einmal öffentlich kaputtlachen möchte und dabei trotzdem eine solide, erwachsene Handlung im Urban-Fantasy-Style zu schätzen weiß, sollte dem Eisernen Druiden und seinem einmalig wurst- und specksüchtigen Begleiter Oberon einen Besuch abstatten und sich selbst von der Faszination dieser kurzweiligen Bücher gefangen nehmen lassen.
The Iron Druid Chronicles startet mit Hounded (2011, Del Rey, ISBN: 978-0-345-52247-4) bzw. der deutschen Übersetzung Die Hetzjagd (2013, Klett-Cotta, ISBN: 978-3-608-93931-6) und umfasst bisher sechs (englischsprachige) Bände.