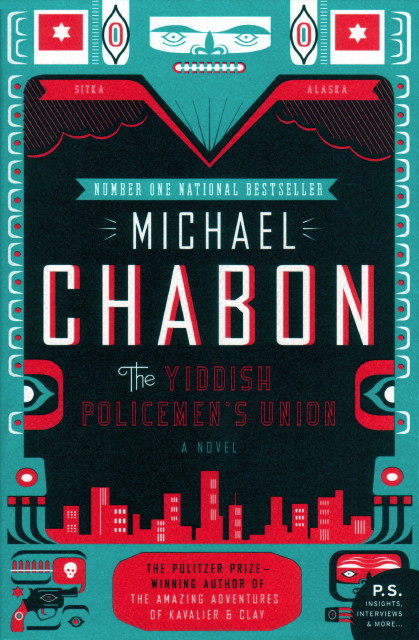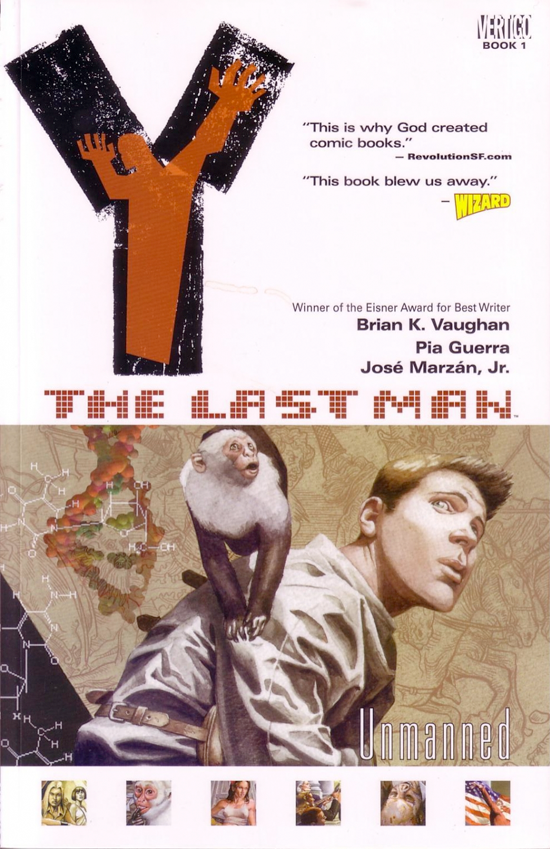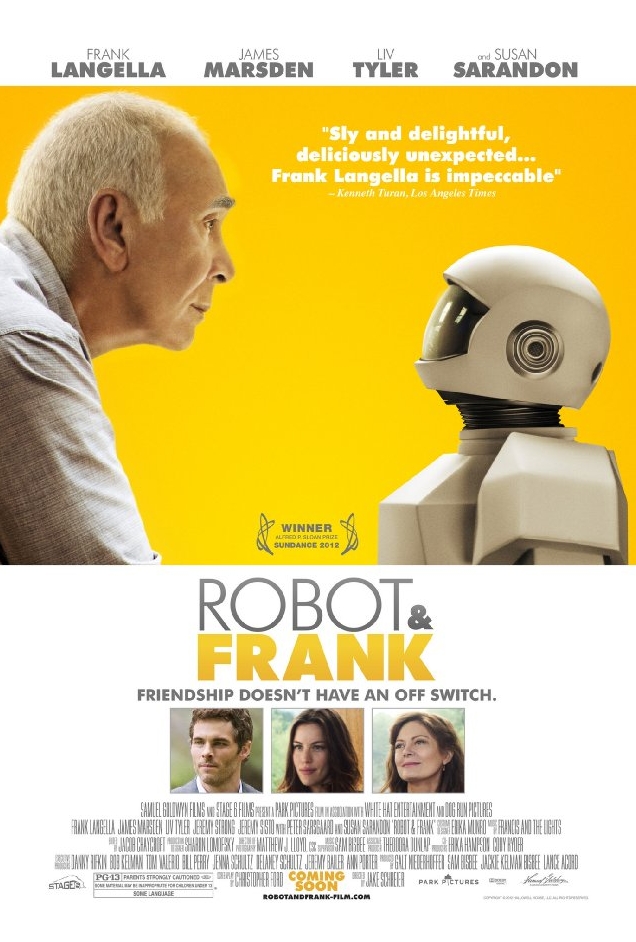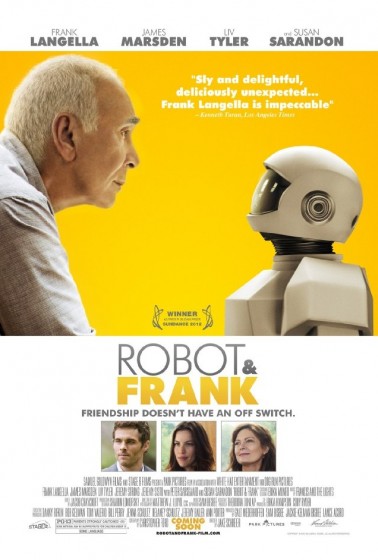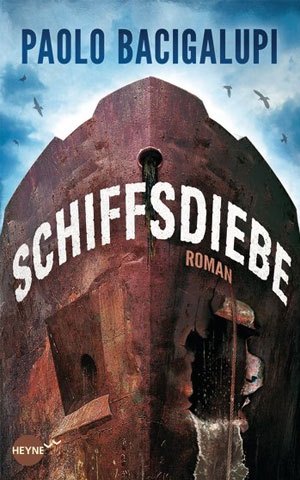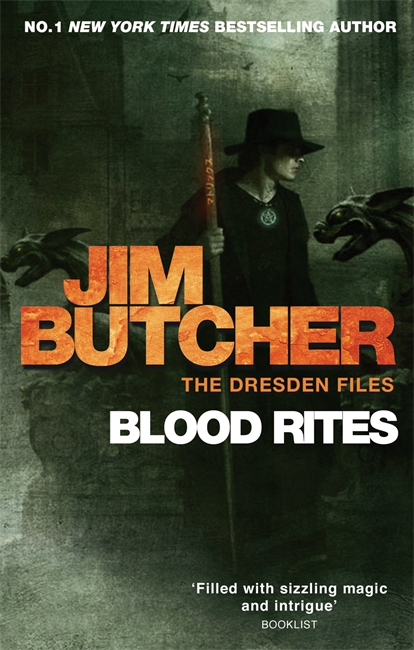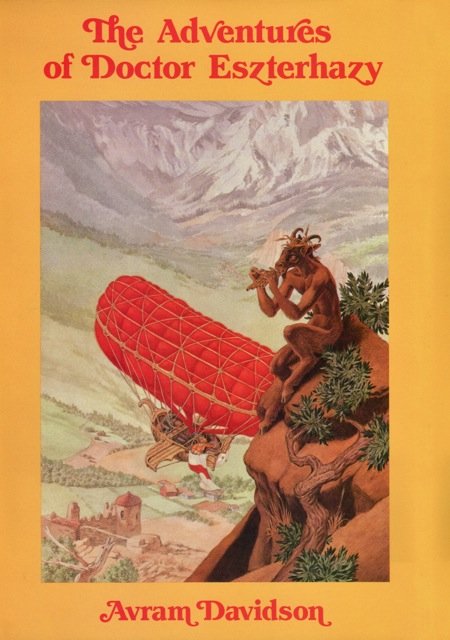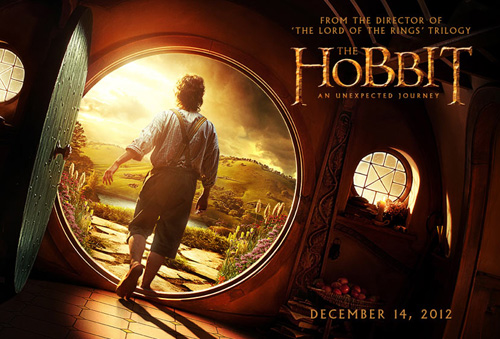Bibliotheka Phantastika erinnert an Edward Whittemore, der heute 80 Jahre alt geworden wäre. Es ist nicht ganz leicht, das literarische Schaffen des am 26. Mai 1933 in Manchester im US-Bundesstaat New Hampshire geborenen Edward Whittemore, zu dessen Bewunderern so unterschiedliche Autoren wie Jonathan Carroll, Tom Robbins und Jeff VanderMeer zählen, in einigen wenigen Sätzen zu umreißen, da es sich einerseits erzählerisch und stilistisch den typischen Genrekonventionen entzieht, andererseits aber auf ebenso typische Genremotive wie Geheimgesellschaften bzw. die großen unbekannten Strippenzieher im Hintergrund, Unsterblichkeit und übermenschliche Heldenfiguren zurückgreift. In Quin’s Shanghai Circus (1974), Whittemores Erstling, wird das noch nicht ganz so deutlich wie in seinem Hauptwerk, dennoch lässt sich hier bereits die Saat finden, die dann im Jerusalem Quartet aufgehen und zur Blüte kommen sollte.
Quin’s Shanghai Circus erzählt vordergründig und vor allem die Geschichte des jungen Quin, der im Jahre 1965 von dem mit einer riesigen Sammlung japanischer Pornographie in der Bronx aufgetauchten fetten Amerikaner Geraty auf die Suche nach seiner Vergangenheit geschickt wird, denn Quins Eltern sind in den Wirren des Zweiten Weltkriegs in Shanghai verschollen. Natürlich begibt Quin sich auf die Reise, in deren Verlauf er Dinge erlebt und erfährt und Menschen begegnet, die seinen Blick auf die Welt und die jüngere Weltgeschichte – so, wie sie sich normalerweise darstellt – völlig verändern. Vergangenheit und Gegenwart beginnen sich in dem Roman, der irgendwie auch ein Spionage- und Kriegsroman ist, zu vermischen, und Whittemore gelingt das Kunststück, nicht nur das Absurde (in Gestalt teils grotesk überzeichneter Figuren und bizarrer Geschehnisse) mit dem Schrecklichen (in Gestalt einer realistischen, erschütternden Passage über das Massaker von Nanking) zu verbinden, sondern das Buch auf eine versöhnliche Weise enden zu lassen.
Die Bedeutun g der Vergangenheit für die Gegenwart (und letztlich für die Zukunft) spielt in Quin’s Shanghai Circus bereits eine wichtige Rolle, die im Jerusalem Quartet noch einmal deutlich größer wird. Denn diese vier Romane umfassen vordergründig zwar nur einen Handlungszeitraum von rund 200 Jahren, doch die Geschehnisse, die in ihnen geschildert werden, haben ihre Wurzeln in einer Vergangenheit, die bis ins neunte Jahrhundert vor Christus (genauer betrachtet sogar noch weit darüber hinaus) zurückreicht. In Sinai Tapestry (1977) entfaltet sich nicht nur der historische Hintergrund der Handlung, sondern es werden auch die Figuren vorgestellt, die bzw. deren Nachkommen und Schüler in den Folgebänden eine mehr oder weniger wichtige Rolle spielen werden. Da wäre zunächst einmal Plantagenet Strongbow, ein sieben Fuß sieben Inch großer Hüne aus einem alten englischen Adelsgeschlecht, der sich schlicht geweigert hat, der Familientradition zu folgen und schon in jungen Jahren einem dummen Unfall zum Opfer zu fallen. Stattdessen wurde er zum größten Forscher, den sein Land jemals hervorgebracht hat, zu einem hervorragenden Schwertkämpfer und Botaniker sowie zum Verfasser einer 33-bändigen Geschichte des Sex in der Levante – und zeitweise zum Besitzer des gesamten Osmanischen Reiches, kurzum: zu einer wahrhaft legendären Gestalt (für die nebenbei bemerkt Richard Francis Burton Pate stand). Ein Mann von ähnlich mythologischen Proportionen ist Skanderberg Wallenstein, ein 1802 in Albanien geborener Trappistenmönch, der zufällig in einem vergessen Winkel eines Klosters in Jerusalem ein uraltes Manuskript entdeckt, das sich als älteste und einzig wahre Bibel entpuppt. Das und die Erkenntnisse, die er über die bisher als “richtig” erachtete Bibel gewinnt, bringen ihn dazu, Pläne in Bewegung zu setzen, die Das Buch der Bücher (1987) – so der deutsche Titel – zum zentralen Plotelement des Romans machen. Ebenfalls alles andere als unwichtig sind der Ire Joe O’Sullivan Beare, der nach dem Osteraufstand von 1916 als Nonne verkleidet ins Heilige Land geflohen ist und gelegentlich für Prester John bzw. den mythischen Priesterkönig Johannes gehalten wird, und Haj Harun, der 3000 Jahre alte Besitzer eines Antiquitätenladens, der im Assyrischen Reich als Steinmetz gearbeitet hat und in dessen Keller unter seinem Laden sich nicht nur Relikte aus unzähligen Städten und dreißig Jahrhunderten sondern auch 800 Jahre alter Cognac finden lassen. Die eigentliche Handlung von Sinai Tapestry lässt sich nur schwer in Worte fassen, denn sie besteht – nomen es omen – aus zeitlich und räumlich weit verstreuten Episoden der auf unterschiedliche Weise miteinander verwobenen Lebensgeschichten der vier Hauptfiguren und etlicher Nebenfiguren. Und natürlich aus Wallensteins Plan, eine neue Bibel zu schaffen, in der einerseits die wesentlichen Glaubensinhalte von Judentum, Christentum und Islam erhalten bleiben, aber um die wesentlichen Inhalte seines von ihm geheimgehaltenen Funds ergänzt werden sollen.
g der Vergangenheit für die Gegenwart (und letztlich für die Zukunft) spielt in Quin’s Shanghai Circus bereits eine wichtige Rolle, die im Jerusalem Quartet noch einmal deutlich größer wird. Denn diese vier Romane umfassen vordergründig zwar nur einen Handlungszeitraum von rund 200 Jahren, doch die Geschehnisse, die in ihnen geschildert werden, haben ihre Wurzeln in einer Vergangenheit, die bis ins neunte Jahrhundert vor Christus (genauer betrachtet sogar noch weit darüber hinaus) zurückreicht. In Sinai Tapestry (1977) entfaltet sich nicht nur der historische Hintergrund der Handlung, sondern es werden auch die Figuren vorgestellt, die bzw. deren Nachkommen und Schüler in den Folgebänden eine mehr oder weniger wichtige Rolle spielen werden. Da wäre zunächst einmal Plantagenet Strongbow, ein sieben Fuß sieben Inch großer Hüne aus einem alten englischen Adelsgeschlecht, der sich schlicht geweigert hat, der Familientradition zu folgen und schon in jungen Jahren einem dummen Unfall zum Opfer zu fallen. Stattdessen wurde er zum größten Forscher, den sein Land jemals hervorgebracht hat, zu einem hervorragenden Schwertkämpfer und Botaniker sowie zum Verfasser einer 33-bändigen Geschichte des Sex in der Levante – und zeitweise zum Besitzer des gesamten Osmanischen Reiches, kurzum: zu einer wahrhaft legendären Gestalt (für die nebenbei bemerkt Richard Francis Burton Pate stand). Ein Mann von ähnlich mythologischen Proportionen ist Skanderberg Wallenstein, ein 1802 in Albanien geborener Trappistenmönch, der zufällig in einem vergessen Winkel eines Klosters in Jerusalem ein uraltes Manuskript entdeckt, das sich als älteste und einzig wahre Bibel entpuppt. Das und die Erkenntnisse, die er über die bisher als “richtig” erachtete Bibel gewinnt, bringen ihn dazu, Pläne in Bewegung zu setzen, die Das Buch der Bücher (1987) – so der deutsche Titel – zum zentralen Plotelement des Romans machen. Ebenfalls alles andere als unwichtig sind der Ire Joe O’Sullivan Beare, der nach dem Osteraufstand von 1916 als Nonne verkleidet ins Heilige Land geflohen ist und gelegentlich für Prester John bzw. den mythischen Priesterkönig Johannes gehalten wird, und Haj Harun, der 3000 Jahre alte Besitzer eines Antiquitätenladens, der im Assyrischen Reich als Steinmetz gearbeitet hat und in dessen Keller unter seinem Laden sich nicht nur Relikte aus unzähligen Städten und dreißig Jahrhunderten sondern auch 800 Jahre alter Cognac finden lassen. Die eigentliche Handlung von Sinai Tapestry lässt sich nur schwer in Worte fassen, denn sie besteht – nomen es omen – aus zeitlich und räumlich weit verstreuten Episoden der auf unterschiedliche Weise miteinander verwobenen Lebensgeschichten der vier Hauptfiguren und etlicher Nebenfiguren. Und natürlich aus Wallensteins Plan, eine neue Bibel zu schaffen, in der einerseits die wesentlichen Glaubensinhalte von Judentum, Christentum und Islam erhalten bleiben, aber um die wesentlichen Inhalte seines von ihm geheimgehaltenen Funds ergänzt werden sollen.
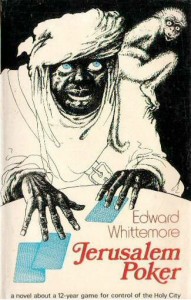 In Jerusalem Poker (1978) dreht sich dann fast alles um ein Pokerspiel, das Beare 1921 in Haj Haruns Laden beginnt, und dessen wichtigste Mitspieler Cairo Martyr und Monk Szondi auf mehrfache Weise mit Strongbow und Wallenstein verbunden sind. Natürlich wollen auch andere Menschen bei diesem Poker um Jerusalem (1989) mitmachen, was einer der Gründe sein dürfte, warum das Spiel, bei dem es – wie der deutsche Titel schon sagt – um die Kontrolle über Jerusalem geht, insgesamt zwölf Jahre dauert. Die immer neuen Mitspieler sorgen für immer neue Geschichten, ehe sie – normalerweise, nachdem sie ein gewaltiges Vermögen verloren haben – wieder im Dunkel des Vergessens verschwinden. Parallel dazu werden die Verflechtungen der wichtigsten Figuren deutlicher, ebenso wie ihre Verstrickung in die unterschiedlichsten geschichtlichen Ereignisse. In Nile Shadows (1983; Die Schatten des Nil (1990)) sind dann deutlich weniger phantastische Elemente zu finden; man könnte diesen im von Rommels Afrika-Korps bedrohten Kairo des Jahres 1942 beginnenden Roman wohl am ehesten als Spionageroman bezeichen (als solcher wurde er auch vermarktet), aber wenn man die Vorgängerbände kennt, spürt man die mythologische Dimension, die unter der realistisch geschilderten, sich um rivalisierende Geheimdienste unterschiedlichster Couleur drehenden Handlung liegt. Und außerdem trifft man O’Sullivan Beare wieder, der zeitweise als Schamane bei den Hopi gelebt hat. In Jericho Mosaic (1987; Das Jericho-Mosaik (1990)) sind die mythischen Gestalten der ersten beiden Bände schließlich endgültig zu verblassenden Schatten geworden, an die sich kaum noch jemand erinnert. Stattdessen geht es um die Ausbildung eines Meisterspions und um so reale Dinge wie den Sechstagekrieg, die Ursprünge der PLO, den Jom-Kippur-Krieg oder den Bürgerkrieg im Libanon. Da Whittemore vor seinem Autorendasein knapp zehn Jahre für die CIA gearbeitet hat, wusste er, wovon er schreibt, was unschwer zu bemerken ist.
In Jerusalem Poker (1978) dreht sich dann fast alles um ein Pokerspiel, das Beare 1921 in Haj Haruns Laden beginnt, und dessen wichtigste Mitspieler Cairo Martyr und Monk Szondi auf mehrfache Weise mit Strongbow und Wallenstein verbunden sind. Natürlich wollen auch andere Menschen bei diesem Poker um Jerusalem (1989) mitmachen, was einer der Gründe sein dürfte, warum das Spiel, bei dem es – wie der deutsche Titel schon sagt – um die Kontrolle über Jerusalem geht, insgesamt zwölf Jahre dauert. Die immer neuen Mitspieler sorgen für immer neue Geschichten, ehe sie – normalerweise, nachdem sie ein gewaltiges Vermögen verloren haben – wieder im Dunkel des Vergessens verschwinden. Parallel dazu werden die Verflechtungen der wichtigsten Figuren deutlicher, ebenso wie ihre Verstrickung in die unterschiedlichsten geschichtlichen Ereignisse. In Nile Shadows (1983; Die Schatten des Nil (1990)) sind dann deutlich weniger phantastische Elemente zu finden; man könnte diesen im von Rommels Afrika-Korps bedrohten Kairo des Jahres 1942 beginnenden Roman wohl am ehesten als Spionageroman bezeichen (als solcher wurde er auch vermarktet), aber wenn man die Vorgängerbände kennt, spürt man die mythologische Dimension, die unter der realistisch geschilderten, sich um rivalisierende Geheimdienste unterschiedlichster Couleur drehenden Handlung liegt. Und außerdem trifft man O’Sullivan Beare wieder, der zeitweise als Schamane bei den Hopi gelebt hat. In Jericho Mosaic (1987; Das Jericho-Mosaik (1990)) sind die mythischen Gestalten der ersten beiden Bände schließlich endgültig zu verblassenden Schatten geworden, an die sich kaum noch jemand erinnert. Stattdessen geht es um die Ausbildung eines Meisterspions und um so reale Dinge wie den Sechstagekrieg, die Ursprünge der PLO, den Jom-Kippur-Krieg oder den Bürgerkrieg im Libanon. Da Whittemore vor seinem Autorendasein knapp zehn Jahre für die CIA gearbeitet hat, wusste er, wovon er schreibt, was unschwer zu bemerken ist.
 Wie eingangs schon erwähnt, ist es schwer, das Oeuvre Whittemores – der nur diese fünf von der Kritik hochgelobten, verkaufstechnisch als Flops zu bezeichnenden Romane geschrieben hat – mit wenigen Sätzen griffig darzustellen. Das Jerusalem Quartet beginnt als eine Art Tall Tale of Tall Tales mit ebenso faszinierenden wie übermenschlichen Figuren und wird am Ende zu einer Bestandsaufnahme der Situation im Nahen Osten in den 60er und 70er Jahren. Und all das immer wieder vor dem auch in den bizarrsten Situationen authentisch wirkenden Hintergrund Jerusalems (wobei diese Authentizität nicht weiter verwunderlich ist, denn Whittemore hat etliche Jahre in Jerusalem gelebt). Überhaupt – diese Stadt. Ihre Rolle in der Geschichte ist weit größer, als das bisher deutlich geworden ist. Aber das ist bei einer so geschichtsträchtigen Stadt in einer Roman-Tetralogie, in der es nicht zuletzt um Geschichte, um ihre mythische Überhöhung und ihre Auswirkungen geht, eigentlich nicht verwunderlich.
Wie eingangs schon erwähnt, ist es schwer, das Oeuvre Whittemores – der nur diese fünf von der Kritik hochgelobten, verkaufstechnisch als Flops zu bezeichnenden Romane geschrieben hat – mit wenigen Sätzen griffig darzustellen. Das Jerusalem Quartet beginnt als eine Art Tall Tale of Tall Tales mit ebenso faszinierenden wie übermenschlichen Figuren und wird am Ende zu einer Bestandsaufnahme der Situation im Nahen Osten in den 60er und 70er Jahren. Und all das immer wieder vor dem auch in den bizarrsten Situationen authentisch wirkenden Hintergrund Jerusalems (wobei diese Authentizität nicht weiter verwunderlich ist, denn Whittemore hat etliche Jahre in Jerusalem gelebt). Überhaupt – diese Stadt. Ihre Rolle in der Geschichte ist weit größer, als das bisher deutlich geworden ist. Aber das ist bei einer so geschichtsträchtigen Stadt in einer Roman-Tetralogie, in der es nicht zuletzt um Geschichte, um ihre mythische Überhöhung und ihre Auswirkungen geht, eigentlich nicht verwunderlich.
Edward Whittemore ist ein Autor, der es seinen Lesern und Leserinnen nicht leicht macht. Man muss sich auf ihn einlassen, auf sein Spiel mit wirklicher und erfundener Geschichte, auf seine Geschichten in der Geschichte. Dann kann man vielleicht einen Autor entdecken, der aus gutem Grund von vielen Kritikern mit Thomas Pynchon verglichen wurde. Und der heute – knapp achtzehn Jahre, nachdem er am 03. August 1995 dem Vernehmen nach ziemlich mittellos an Prostatakrebs gestorben ist – zu Unrecht nur noch einer Handvoll (allerdings begeisterter) Anhänger bekannt ist.
Bibliotheka Phantastika Posts
Bibliotheka Phantastika gratuliert Michael Chabon, der heute seinen 50. Geburtstag feiert. Ursprünglich hat die E-Literatur den am 24. Mai 1963 in Washington, DC, USA geborenen Chabon für sich beansprucht, auch wenn man bereits bei seinen früheren Werken aufgrund der Themenwahl erahnen konnte, dass er mit dem Genre nicht auf Kriegsfuß steht: Sein mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnetes The Amazing Adventures of Kavalier and Clay (2000, dt. Die unglaublichen Abenteuer von Kavalier und Clay (2002)) beschreibt den Werdegang zweier jüdischer Künstler in den 40er Jahren, die mit einem Superhelden-Comic Erfolge feiern.
Das Jugendbuch Summerland (2002, dt. Sommerland (2004)) ist dann bereits ein waschechtes Genre-Stück: Drei Freunde sind dazu ausersehen, den Weltenbaum vor den Machenschaften von Coyote zu retten, wozu sie in die mythenhaften Sommerlande reisen müssen – um dort mit Baseball Allianzen zu schmieden und Konflikte zu lösen. Die Verquickung von nordischer und indianischer Mythologie und den amerikanischen Tall tales mit Baseball ist wahrscheinlich eine Mischung, die besonders gut für Leser und Leserinnen aus den USA funktioniert – dort war der Roman auch ein großer Erfolg –, Summerland ist aber auch ein nostalgisch angehauchtes Fantasy-Märchen, das man mit seiner originellen Zusammenstellung von Motiven und liebenswerten Figuren gut lesen kann, wenn man Jugendbüchern nicht abgeneigt ist.
Gentlemen of the Road (2006, dt. Schurken der Landstraße (2010)) ist zwar keine Fantasy im eigentlichen Sinne, aber die beiden Abenteurer Zelikman und Amram schlagen und gaunern sich definitiv im Geiste der Sword & Sorcery durch die Kaukasus-Region im 10. Jahrhundert.
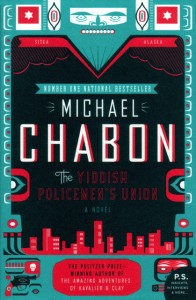 Und falls noch Fragen zu Chabons Verhältnis zur SF offen gewesen sein sollten, so wurden sie allerspätestens ausgeräumt, nachdem er für The Yiddish Policemen’s Union (2007, dt. Die Vereinigung jiddischer Polizisten (2008)) u.a. einen Hugo Award und einen Nebula Award erhielt. Der Krimi ist in einer Alternativwelt angesiedelt, in der sich die jüdischen Flüchtlinge nach dem Zweiten Weltkrieg nicht in Israel, sondern in Alaska niederließen. Dort wird in der Jetzt-Zeit unter politischen Spannungen (unter anderem mit den Ureinwohnern) ein Mordfall in der inzwischen auf Großstadt-Größe gewachsenen jiddischen Kommune aufgeklärt.
Und falls noch Fragen zu Chabons Verhältnis zur SF offen gewesen sein sollten, so wurden sie allerspätestens ausgeräumt, nachdem er für The Yiddish Policemen’s Union (2007, dt. Die Vereinigung jiddischer Polizisten (2008)) u.a. einen Hugo Award und einen Nebula Award erhielt. Der Krimi ist in einer Alternativwelt angesiedelt, in der sich die jüdischen Flüchtlinge nach dem Zweiten Weltkrieg nicht in Israel, sondern in Alaska niederließen. Dort wird in der Jetzt-Zeit unter politischen Spannungen (unter anderem mit den Ureinwohnern) ein Mordfall in der inzwischen auf Großstadt-Größe gewachsenen jiddischen Kommune aufgeklärt.
Michael Chabon mag also eher am Rande des Genres residieren, an dem er aber völlig ohne Berührungsängste begeistert teilnimmt (nachzulesen etwa hier), und egal, ob man seine früheren (nicht phantastischen) oder späteren Werke zur Hand nimmt, wird man immer auf einen humorvollen, ideenreichen und warmherzigen Erzähler treffen.
Bibliotheka Phantastika erinnert an Manly Wade Wellman, dessen Geburtstag sich heute zum 110. Mal jährt. Der am 21. Mai 1903 in Kamundongo in Portugiesisch Westafrika (dem heutigen Angola) geborene Manly Wade Wellman zählt zu den Autoren, ohne die die Pulps – diese auf Billigpapier gedruckten, alle möglichen Genres abdeckenden, zumeist monatlich erscheinenden Magazine – gar nicht möglich gewesen wären, denn er hat lange Zeit für sie geschrieben (wie später auch für die “seriöseren” SF- und Fantasymagazine). Von daher ist es nur folgerichtig, dass seine Karriere mit “Back to the Beast” 1927 in der Novemberausgabe von Weird Tales begonnen hat, das bis Ende der 40er Jahre zu seinem Hauptabnehmer werden sollte. Doch Wellman schrieb auch für andere Magazine und verfasste beispielsweise mehrere größtenteils in Amazing erschienene Stories um den prähistorischen Helden Hok, der es in der Morgendämmerung der Menschheitsgeschichte u.a. mit Neandertalern und Höhlenmenschen zu tun bekommt und einen Abstecher nach Atlantis macht. Die formal und inhaltlich nicht sonderlich aufregenden Hok-Geschichten sind klassisches Pulpmaterial mit all seinen typischen Stärken und Schwächen und wurden erst 2010 als Buchausgabe gesammelt unter dem Titel Battle in the Dawn: The Complete Hok the Mighty wieder aufgelegt. In eine ganz ähnliche Richtung geht Sojarr of Titan (komplett in Startling Stories März 1941, Buchausgabe 1949), das man am ehesten als “Tarzan im Weltall” bezeichnen könnte.
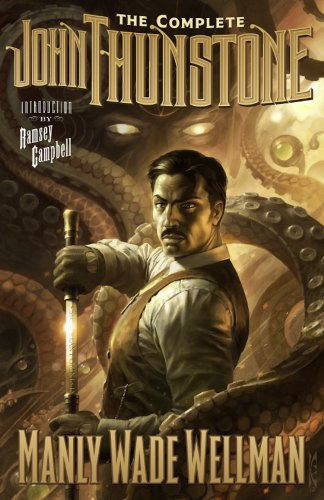 Weitaus interessanter waren da die Geschichten, die Wellman – teils unter dem Pseudonym Gans T. Field – in den 30er und 40er Jahren für Weird Tales schrieb, und die eine erstaunliche thematische Bandbreite aufweisen. Und in Weird Tales sind (beginnend mit “The Third Cry to Legba”, November 1943) auch die etwas mehr als ein Dutzend Stories um den okkulten Detektiv John Thunstone erschienen, die zwar einen damals weit verbreiteten und auch schon zuvor von Wellman selbst genutzten Trend aufgriffen, aber die vielleicht beste Umsetzung dieses Themas darstellen. Thunstone ist einerseits ein typischer Pulpheld – groß und kräftig, intelligent, gutaussehend und reich, dazu mit reichlich okkultem Wissen und wirksamen Waffen gegen übernatürliche Wesen ausgestattet – doch seine Gegner sind nicht nur die üblichen Geister, Werwölfe und Vampire, sondern auch die Shonokins, menschenähnliche Wesen, die behaupten, lange vor dem Auftauchen der Menschen über Nordamerika geherrscht zu haben. Und natürlich hat er wie alle Serienhelden auch einen Erzfeind: den Magier Rowley Thorne (für den dem Vernehmen nach Aleister Crowley Pate gestanden haben soll). In den 80er Jahren ist Wellman nach einer Pause von mehr als dreißig Jahren noch einmal zu John Thunstone zurückgekehrt, zunächst mit einer Story und dann mit zwei Romanen – What Dreams May Come (1983) und The School of Darkness (1985) – in denen der Detektiv mit dem modernen Phänomen der Zeitreise konfrontiert wird, ehe es zum großen Showdown mit seinem Erzfeind kommt. Sämtliche Geschichten und die beiden Romane sind vor kurzem auch in dem Sammelband The Complete John Thunstone (2012) erschienen.
Weitaus interessanter waren da die Geschichten, die Wellman – teils unter dem Pseudonym Gans T. Field – in den 30er und 40er Jahren für Weird Tales schrieb, und die eine erstaunliche thematische Bandbreite aufweisen. Und in Weird Tales sind (beginnend mit “The Third Cry to Legba”, November 1943) auch die etwas mehr als ein Dutzend Stories um den okkulten Detektiv John Thunstone erschienen, die zwar einen damals weit verbreiteten und auch schon zuvor von Wellman selbst genutzten Trend aufgriffen, aber die vielleicht beste Umsetzung dieses Themas darstellen. Thunstone ist einerseits ein typischer Pulpheld – groß und kräftig, intelligent, gutaussehend und reich, dazu mit reichlich okkultem Wissen und wirksamen Waffen gegen übernatürliche Wesen ausgestattet – doch seine Gegner sind nicht nur die üblichen Geister, Werwölfe und Vampire, sondern auch die Shonokins, menschenähnliche Wesen, die behaupten, lange vor dem Auftauchen der Menschen über Nordamerika geherrscht zu haben. Und natürlich hat er wie alle Serienhelden auch einen Erzfeind: den Magier Rowley Thorne (für den dem Vernehmen nach Aleister Crowley Pate gestanden haben soll). In den 80er Jahren ist Wellman nach einer Pause von mehr als dreißig Jahren noch einmal zu John Thunstone zurückgekehrt, zunächst mit einer Story und dann mit zwei Romanen – What Dreams May Come (1983) und The School of Darkness (1985) – in denen der Detektiv mit dem modernen Phänomen der Zeitreise konfrontiert wird, ehe es zum großen Showdown mit seinem Erzfeind kommt. Sämtliche Geschichten und die beiden Romane sind vor kurzem auch in dem Sammelband The Complete John Thunstone (2012) erschienen.
Weitaus bekannter – zumindest in den USA – haben Manly Wade Wellman allerdings die Stories und später auch Romane um John the Balladeer (bzw. Silver John wegen seiner mit silbernen Saiten bespannten Gitarre) gemacht, der durch das ländliche North Caroline wandert und dabei allerlei Kreaturen begegnet, die teils der amerikanischen Folklore, teils den Pulps entsprungen sind. Dass diese Begegnungen nicht immer freundlich und friedlich verlaufen, liegt auf der Hand, doch John – eine Mischung aus Johnny Cash und Johannes dem Täufer – verfügt 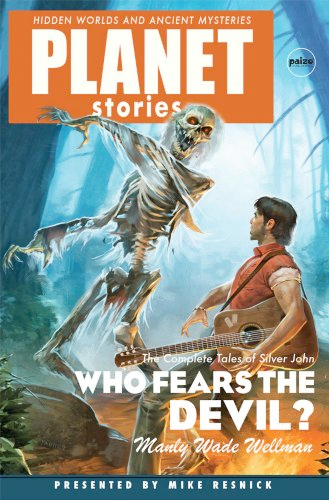 über Fähigkeiten, die man ihm gar nicht zugetraut hätte, und so gelingt es ihm immer, die Konflikte auf zufriedenstellende (nicht zwangsläufig gewaltsame) Weise zu lösen. Auf die erste Silver-John-Story “O Ugly Bird!” (1951 in der Dezemberausgabe des Magazine of Fantasy & Science Fiction) folgten in den 50er und 60er Jahren noch rund dreißig weitere. Ab 1979 erschienen dann fünf Romane – The Old Gods Waken (1979), After Dark (1980), The Lost and the Lurking (1981), The Hanging Stones (1982) und The Voice of the Mountain (1984) – in denen John etwas größere Abenteuer erlebt und es u.a. mit keltischen Druiden und den bereits aus den John-Thunstone-Geschichten bekannten Shonokins zu tun bekommt. Die Stories – am vollständigsten in Who Fears the Devil? The Complete Silver John (2010) gesammelt – und Romane um John the Balladeer sind durch ihr Aufgreifen folkloristischer Motive und die Verwurzelung im ländlichen Nordamerika in vielerlei Hinsicht ungewöhnlich; man könnte auch sagen, es sind Heimatromane der etwas anderen Art.
über Fähigkeiten, die man ihm gar nicht zugetraut hätte, und so gelingt es ihm immer, die Konflikte auf zufriedenstellende (nicht zwangsläufig gewaltsame) Weise zu lösen. Auf die erste Silver-John-Story “O Ugly Bird!” (1951 in der Dezemberausgabe des Magazine of Fantasy & Science Fiction) folgten in den 50er und 60er Jahren noch rund dreißig weitere. Ab 1979 erschienen dann fünf Romane – The Old Gods Waken (1979), After Dark (1980), The Lost and the Lurking (1981), The Hanging Stones (1982) und The Voice of the Mountain (1984) – in denen John etwas größere Abenteuer erlebt und es u.a. mit keltischen Druiden und den bereits aus den John-Thunstone-Geschichten bekannten Shonokins zu tun bekommt. Die Stories – am vollständigsten in Who Fears the Devil? The Complete Silver John (2010) gesammelt – und Romane um John the Balladeer sind durch ihr Aufgreifen folkloristischer Motive und die Verwurzelung im ländlichen Nordamerika in vielerlei Hinsicht ungewöhnlich; man könnte auch sagen, es sind Heimatromane der etwas anderen Art.
Der interessanteste von Manly Wade Wellmans gelegentlichen Abstechern in die SF dürfte der gemeinsam mit seinem Sohn Wade Wellman verfasste Episodenroman Sherlock Holmes’ War of the Worlds (1975) sein, in dem der bekannte Detektiv aus der Baker Street es mit den Wells’schen Marsianern zu tun bekommt. Und auch an der Sword & Sorcery hat Wellman sich (genau wie an nicht-phantastischen Genres) versucht: In den fünf zwischen 1977 und 1979 erschienenen Ausgaben der von Andrew J. Offutt jr. herausgegebenen Anthologiereihe Swords Against Darkness finden sich ebenso viele Geschichten um Kardios, den Harfespieler und letzten Überlebenden des versunkenen Atlantis, die zwar ganz nett sind, aber verständlich machen, wieso Wellman sich diesem Subgenre zu dessen Boomzeiten nie zugewandt hat.
In Deutschland sind von ihm nur ein paar Kurzgeschichten – u.a. auch mit Hok, John Thunstone, Silver John und Kardios – sowie zwei, drei eher uninspirierte SF-Romane und ein Horrorroman (Der Schattensee (1980), OT: The Beyonders (1977)) erschienen. Der weitaus interessantere Teil des Schaffens des am 05. April 1986 im Alter von 83 Jahren verstorbenen Manly Wade Wellman ist hingegen nie übersetzt worden.
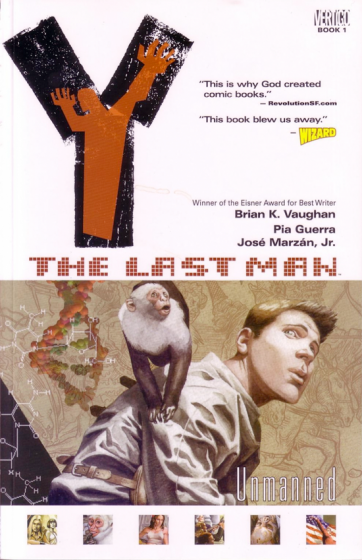 Yorrick telefoniert gerade mit seiner Freundin, die am andere Ende der Welt ein Praktikum in Australien macht, als eine nie da gewesene Katastrophe die Welt heimsucht. Durch eine Seuche ungeklärter Ursache fallen weltweit in Sekunden alle männlichen Lebewesen, von der Maus bis zum Humanoid, tot um. Nur Yorrick und sein Kapuzineräffchen Ampersand überleben. Doch was macht die beiden so besonders? Und was bedeutet eine Welt ohne Männer?
Yorrick telefoniert gerade mit seiner Freundin, die am andere Ende der Welt ein Praktikum in Australien macht, als eine nie da gewesene Katastrophe die Welt heimsucht. Durch eine Seuche ungeklärter Ursache fallen weltweit in Sekunden alle männlichen Lebewesen, von der Maus bis zum Humanoid, tot um. Nur Yorrick und sein Kapuzineräffchen Ampersand überleben. Doch was macht die beiden so besonders? Und was bedeutet eine Welt ohne Männer?
Zur Rezension bitte hier entlang.
Wem nach dem “Robot” im Titel noch der Schreck in den Gliedern sitzt, den kann ich beruhigen: obwohl der hier vorgestellte Film letztes Jahr erschien und Science-Fiction-Elemente besitzt – weder Will Smith noch eines seiner Kinder spielen irgendeine Rolle. Tatsächlich könnte der US-amerikanische Indiefilm “Robot & Frank” von Regisseur Jake Schreier den herkömmlichen Roboterphantasien nicht ferner liegen.
In einer “nahen Zukunft” lebt Frank, ehemaliger Juwelendieb und Fassadenkletterer, in einem beschaulichen Haus im Grünen und verbringt seinen Lebensabend mit Besuchen der Gemeindebibliothek und dem Stehlen geschnitzter Seifentiere. Futuristische Smartphones und der Robotergehilfe der Bibliothekarin Jennifer, der wenig humanoide und eher an einen wandelnden Kopierer erinnernde Mr. Darcy, sind die ersten Hinweise auf den technologischen Fortschritt dieser leisen, sensiblen Zukunftsvision. Von ähnlicher Subtilität ist auch das wahrhaft meisterhafte Spiel von Frank Langella, der behutsam die feinen Risse in die Zukunftsidylle zeichnet: was anfangs als schrulliges Eigenbrödlertum durchgehen mag, entpuppt sich erst für die Kinder des filmischen Franks, dann für die Zuschauer, und später, in unprätentiösen und schmerzhaft ehrlichen Momenten auch für den alten Mann selbst als Verwirrung, als Demenz. “Robot & Frank” ist jedoch nicht nur ein Film über das Älterwerden und die Vieldeutigkeit zwischenmenschlicher Beziehungen – es ist ein Film, der das Verhältnis von Mensch zur vermenschlichten Maschine mal verschmitzt-komisch, mal leise-traurig zum Thema macht. Denn Franks Kinder – großartig hier übrigens Liv Tyler als philanthropisch-nervige Tochter, die aus Turkmenistan schuldbewusste Videobotschaften sendet – stellen ihrem Vater einen Pflegeroboter zur Seite, der das übernehmen soll, was weder Frank als Vater, noch Hunter oder Madison als Kinder je gut konnten: sich kümmern.
Brokkoli statt Müsli, ein geregelter Tagesablauf, eine Freizeitbeschäftigung, die den Geist auf Trab bringt: es ist nicht verwunderlich, dass Frank wenig begeistert ist von der Technologisierung seiner Betreuung. Doch auch in der Bibliothek stehen die Zeichen auf Umbruch; Printmedien sind wie Frank ein Relikt vergangener Tage, und ein mutimediales Kulturzentrum soll den Bücherstaub ersetzen. Der Film greift an dieser Stelle mit verschmitztem Augenzwinkern eine nur allzu aktuelle Debatte auf, ohne zwischen Schlagworten wie Vorsintflutlichkeit und Fortschrittswahn Stellung zu beziehen.
Es bleibt ein Film der leisen Töne: Die zarte Romanze zwischen der Bibliothekarin und dem ehemaligen Juwelendieb, der immer öfter den Namen seines Sohnes vergisst, entspricht keinen Hollywoodnormen. Und zwischen allen menschlichen Verwicklungen sucht Franks Roboter nun nach einem Hobby, das gleichzeitig zu fordern und zu begeistern vermag. Was nur, wenn sich Schlösserknacken als perfektes Mittel herausstellt, Frank bei Laune zu halten…?
Die Beziehung von Frank zu seinem namenlosen Roboter ist das Herzstück dieses kleinen Filmjuwels. Schnell deutet Frank – und der Zuschauer – Humor und Emotion in die Handlungen der Maschine hinein, und es trifft beide gleichermaßen, wenn der Roboter wiederholt betont, dass er keine Persönlichkeit besitzt. Und an beide ist es auch gerichtet, wenn er dieser Feststellung ein “I know you don’t like it” voranstellt. Es sind Bilder, die aus einem Nachbartal des Uncanny Valley stammen, wenn der Roboter in zenartiger Gelassenheit den Garten umsorgt, dessen Pflege eigentlich Franks (bewegungs- und kognitionsfördernde) Aufgabe ist; und wenn der ausgeschaltete Roboter in die ausgebreiteten Arme des alten Mannes sinkt, der ihn schließlich doch als Freund und Partner bezeichnet, dann ist dies ein melancholisches, aber dennoch verräterisch tröstendes Zerrbild einer Umarmung. Ein Mann, der vergisst, und eine Maschine, die nicht vergessen kann: “Robot & Frank” ist weder ein reines Drama, eine reine Komödie, noch eine Science-Fiction-Vision. Mit seinem feinsinnigem Humor, dem nie kitischigen, nie nur traurigen Portrait einer Familie und der klugen Studie der Sehnsucht nach Vermenschlichung bewegt sich dieser Film vielleicht schwerfällig, wenn es um eine Genreeinteilung geht, aber umso leichtfüßiger, wenn man sich auf die Diebestour mit Roboter einlässt. Denn dass Fassadenkletterei unter die Definition “körperliche Betätigung” fällt, leuchtet auch dem Roboter ein – dessen Ethikprogramm ihn eindeutig auf nicht alle Situationen vorbereitet hat.
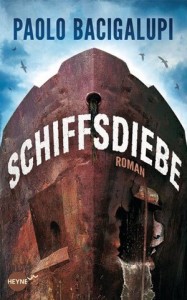 Nailer verdingt sich an einem der neu entstandenen Strände als Schiffsbrecher, das heißt, er schlachtet Öltanker nach wiederverwertbaren Materialien aus. Die Lebens- und Arbeitsbedingungen sind hart, Freunde hat er wenige, sein brutaler, drogensüchtiger Vater macht Nailers Leben zusätzlich zur Hölle. Hoffnung auf Besserung hat er keine, bis er nach einem schweren Sturm auf einen gestrandeten Klipper stößt – ein Schiff, das ebenso zu einer anderen (reicheren) Welt gehört wie das Mädchen, das er darin findet. Doch der Luxus, den sich Nailer nun erhofft, hat einen Preis, denn das reiche Mädchen hat nicht weniger mächtige Feinde …
Nailer verdingt sich an einem der neu entstandenen Strände als Schiffsbrecher, das heißt, er schlachtet Öltanker nach wiederverwertbaren Materialien aus. Die Lebens- und Arbeitsbedingungen sind hart, Freunde hat er wenige, sein brutaler, drogensüchtiger Vater macht Nailers Leben zusätzlich zur Hölle. Hoffnung auf Besserung hat er keine, bis er nach einem schweren Sturm auf einen gestrandeten Klipper stößt – ein Schiff, das ebenso zu einer anderen (reicheren) Welt gehört wie das Mädchen, das er darin findet. Doch der Luxus, den sich Nailer nun erhofft, hat einen Preis, denn das reiche Mädchen hat nicht weniger mächtige Feinde …
Zur Rezension bitte hier entlang.
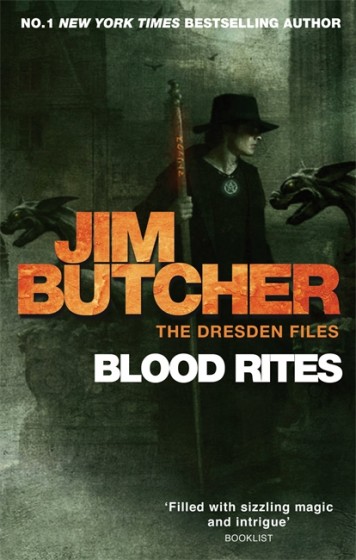 Wenn man gerade einer Horde wütender Affendämonen und ihrer fäkalen Wurfgeschosse entkommen ist, gibt es sicher Schöneres, als kurz darauf einem Vampir in die Arme zu laufen. Glück im Unglück, trifft Harry auf einen vergleichsweise harmlose Ausgabe, als Thomas vom Weißen Hof Harry bittet, einen Auftrag zu übernehmen. Der Regisseur eines kleinen Filmstudios glaubt sich verflucht, da seine weiblichen Darstellerinnen der Reihe nach auf merkwürdige Weise sterben. Harry übernimmt den Fall nur als Gefallen für Thomas, dessen Succubi-Clan er nicht mehr schätzt als fliegende Affenkacke. Dabei stolpert er jedoch über Geheimnisse, die ihm die Schuhe ausziehen.
Wenn man gerade einer Horde wütender Affendämonen und ihrer fäkalen Wurfgeschosse entkommen ist, gibt es sicher Schöneres, als kurz darauf einem Vampir in die Arme zu laufen. Glück im Unglück, trifft Harry auf einen vergleichsweise harmlose Ausgabe, als Thomas vom Weißen Hof Harry bittet, einen Auftrag zu übernehmen. Der Regisseur eines kleinen Filmstudios glaubt sich verflucht, da seine weiblichen Darstellerinnen der Reihe nach auf merkwürdige Weise sterben. Harry übernimmt den Fall nur als Gefallen für Thomas, dessen Succubi-Clan er nicht mehr schätzt als fliegende Affenkacke. Dabei stolpert er jedoch über Geheimnisse, die ihm die Schuhe ausziehen.
Zur Rezension bitte hier entlang.
Bibliotheka Phantastika erinnert an Avram Davidson, dessen Todestag sich heute zum 20. Mal jährt. Es ist schier unmöglich, in knapper Form diesem vielleicht quecksilbrigsten aller amerikanischen SF- und Fantasyautoren gerecht zu werden, der leicht ein Gigant des Genres hätte werden können, wenn dem nicht Marktgegebenheiten und seine eigene Persönlichkeit entgegengestanden hätten. Stattdessen ist der am 23. April 1923 in Yonkers, New York, geborene Avram James Davidson zwanzig Jahre nach seinem Tod in seiner Heimat fast vergessen. In Deutschland ist er so gut wie unbekannt, was natürlich damit zu tun hat, dass nur ein sehr kleiner Teil seines Schaffens übersetzt wurde.
Avram Davidsons Karriere begann 1954 mit der Veröffentlichung der Kurzgeschichte “My Boy Friend’s Name is Jello” im Magazine of Fantasy & Science Fiction, das in der Folgezeit nicht nur zum Hauptabnehmer seiner Stories werden sollte, sondern das er von 1962-64 auch herausgegeben hat. Die meisten seiner zahlreichen Geschichten aus den 50er und 60er Jahren neigen eher der Phantastik zu bzw. changieren zwischen Phantastik und SF; sie sind stilistisch maniriert, mal geistreich, mal launig, mal völlig überdreht, und sie widmen sich allen möglichen Themen, bedienen sich anfangs zeitgenössischer und SF-Settings, nutzen später auch Sword-&-Sorcery-, Alternativwelt- und Horrorszenarien. Or All The Seas with Oysters (1962), die erste Sammlung seiner Kurzgeschichten (zu der sich im Laufe seiner Karriere noch neun weitere gesellen sollten) vermittelt einen guten Überblick über diese Phase seines Schaffens. Seinen ersten SF-Roman schrieb Davidson in Zusammenarbeit mit Ward Moore (Joyleg, 1962), die nächsten sieben verfasste er allein, und in ihnen bewies er, dass er auch farbige Space Operas schreiben konnte. Da sich in seinen letzten SF-Romanen bereits in einen rationalen Mantel gekleidete Drachen und toltekische Götter finden, ist es nicht weiter verwunderlich, dass Davidson sich 1969 richtig der Fantasy zuwandte.
Denn in diesem Jahr erschienen die vielversprechenden Auftaktbände zweier Zyklen: Den Anfang machte der aus der gleichnamigen, bereits Mitte der 60er veröffentlichten Erzählung hervorgegangene Roman The Phoenix and the Mirror, der erste Band der Vergil Magus-Sequenz und nach einhelliger Meinung vieler Kritiker Davidsons opus magnum. Ausgehend von der Prämisse, dass 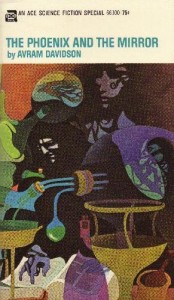 die mittelalterlichen Legenden stimmen, die aus dem Dichter Vergil (bzw. Virgil) den berühmten Magier Vergil gemacht haben, entwarf er in diesem Buch das Bild eines Römischen Imperiums, das dem entspricht, das man sich im Mittelalter von dieser Epoche gemacht hat. Vergil Magus erhält den Auftrag, einen speculum majorum (einen jungfräulichen Spiegel) zu konstruieren, der demjenigen, der als Erster hineinblickt, das zeigt, was er sich am sehnlichsten wünscht. Um diesen Auftrag zu erfüllen, bereist Vergil die mediterrane Welt, begegnet diversen Fabelwesen und erlebt allerlei Abenteuer. Der Roman hat gewisse Schwächen in der Konstruktion, besticht aber durch sein unglaublich authentisch wirkendes Setting mit wunderbar entworfenen Szenen und Sequenzen, die nicht nur in der damals zeitgenössischen Fantasy einzigartig waren, sondern für die es bis heute kaum Parallelen gibt. Der einzige echte Makel, den The Phoenix and the Mirror aufweist, besteht darin, dass man auf die Fortsetzung (die sich als Prequel entpuppen sollte) achtzehn Jahre warten musste – und dass Vergil in Averno (1987) sich in mehrfacher Hinsicht vom Vorgängerband unterscheidet.
die mittelalterlichen Legenden stimmen, die aus dem Dichter Vergil (bzw. Virgil) den berühmten Magier Vergil gemacht haben, entwarf er in diesem Buch das Bild eines Römischen Imperiums, das dem entspricht, das man sich im Mittelalter von dieser Epoche gemacht hat. Vergil Magus erhält den Auftrag, einen speculum majorum (einen jungfräulichen Spiegel) zu konstruieren, der demjenigen, der als Erster hineinblickt, das zeigt, was er sich am sehnlichsten wünscht. Um diesen Auftrag zu erfüllen, bereist Vergil die mediterrane Welt, begegnet diversen Fabelwesen und erlebt allerlei Abenteuer. Der Roman hat gewisse Schwächen in der Konstruktion, besticht aber durch sein unglaublich authentisch wirkendes Setting mit wunderbar entworfenen Szenen und Sequenzen, die nicht nur in der damals zeitgenössischen Fantasy einzigartig waren, sondern für die es bis heute kaum Parallelen gibt. Der einzige echte Makel, den The Phoenix and the Mirror aufweist, besteht darin, dass man auf die Fortsetzung (die sich als Prequel entpuppen sollte) achtzehn Jahre warten musste – und dass Vergil in Averno (1987) sich in mehrfacher Hinsicht vom Vorgängerband unterscheidet.
Ebenfalls 1969 begab sich Davidson mit The Island Under the Earth in Thomas-Burnett-Swann-Land. Allerdings spielt die an die Kentauromachie angelehnte Geschichte des Kampfes zwischen Kentauren und Lapithen nicht im irdischen Thessalien, sondern auf einer anderen Welt, die in diesem Roman allerdings nur angerissen wird. Bedauerlicherweise hat man nie mehr über diese Welt erfahren (das Wenige, das man im ersten Band zu sehen bekommt, macht durchaus neugierig), denn die bereits mit Titeln versehenen und teilweise in Verlagsvorschauen auftauchenden Fortsetzungen (The Sixlimbed Folk und The Cap of Grace) hat Davidson nie geschrieben.
1971 folgte mit Peregrine: Primus der erste Band einer in einem langsam zerfallenden Römischen Imperium angesiedelten Trilogie, die mit den Mitteln des Schelmenromans die Abenteuer eines Königssohns schildert, der von einem Zauberer in sein Wappentier verwandelt wird, dessen richtige Probleme allerdings erst anfangen, als er – leider nicht ganz perfekt – zurückverwandelt wird. Konventioneller als die beiden vorgenannten Titel und mit etwas weniger beeindruckenden und authentisch wirkenden Bildern, ist Peregrine: Primus dennoch ein Roman, der deutlich über das hinausragt, was in dieser Zeit ansonsten an Fantasy veröffentlicht wurde. Auf Peregrine: Secundus (1981) mussten die Leser dann “nur” zehn Jahre warten; Peregrine: Tertius schließlich – man ahnt es bereits – ist nie erschienen.
Über die Gründe für diese Verzögerungen bzw. das Nichterscheinen etlicher Bücher kann man nur spekulieren. Auffällig ist aber, dass sich in Vergil in Averno – der für sich betrachtet als Roman durchaus funktioniert, in struktureller Hinsicht sogar besser ist als sein Vorgänger, nur dass er eben die Wunder der durch die Brille des Mittelalters beobachteten Antike gegen die düster-bedrohliche und bedrückende Stimmung in einer “industrialisierten” Stadt im Innern eines Vulkans austauscht – Anzeichen einer Bitterkeit seines Schöpfers finden lassen, die vermutlich damit zu tun hat, dass Davidson sich zu diesem Zeitpunkt bereits schwer tat, Abnehmer für seine Geschichten und Romane zu finden. Aber da befinden wir uns schon in den 80er Jahren.
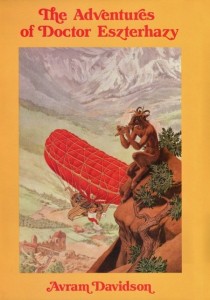 In den 70ern hat Davidson noch etliche Kurzgeschichten geschrieben, die auch immer noch in den entsprechenden Magazinen veröffentlicht wurden. Dazu gehören auch die Stories um den kaiserlichen Magier Dr. Engelbert Eszterhazy, der ein paar Jahre vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs mit einem dampfgetriebenen Gefährt über die gepflasterten Straßen der Hauptstadt des fiktiven Kaiserreichs Scythia-Pannonia-Transbalkania brettert. In The Enquiries of Doctor Eszterhazy (1975) wurden sie zu so etwas wie einem Episodenroman zusammengefasst und sind später – ergänzt um eine Handvoll Erzählungen aus den 80ern, in denen die Abenteuer des jugendlichen Eszterhazy geschildert werden – noch einmal in dem Sammelband The Adventures of Doctor Eszterhazy (1991) erschienen.
In den 70ern hat Davidson noch etliche Kurzgeschichten geschrieben, die auch immer noch in den entsprechenden Magazinen veröffentlicht wurden. Dazu gehören auch die Stories um den kaiserlichen Magier Dr. Engelbert Eszterhazy, der ein paar Jahre vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs mit einem dampfgetriebenen Gefährt über die gepflasterten Straßen der Hauptstadt des fiktiven Kaiserreichs Scythia-Pannonia-Transbalkania brettert. In The Enquiries of Doctor Eszterhazy (1975) wurden sie zu so etwas wie einem Episodenroman zusammengefasst und sind später – ergänzt um eine Handvoll Erzählungen aus den 80ern, in denen die Abenteuer des jugendlichen Eszterhazy geschildert werden – noch einmal in dem Sammelband The Adventures of Doctor Eszterhazy (1991) erschienen.
Ebenfalls bereits in den 70ern hat Davidson die ersten Geschichten veröffentlicht, in deren Mittelpunkt Jack Limekiller und seine merkwürdigen Erlebnisse in British Hidalgo – einem fiktiven, nach dem Vorbild von Britisch-Honduras (dem heutigen Belize) modellierten zentralamerikanischen Staat – stehen und zu denen Davidson durch zwei längere Aufenthalte in Britisch-Honduras Mitte und Ende der 60er Jahre inspiriert wurde. Zehn Jahre nach seinem Tod sind sie gesammelt in Limekiller! (2003) erschienen.
Kurzgeschichten hat Davidson also in den 70er Jahren noch geschrieben (und auch in den 80ern und 90ern bis kurz vor seinem Tod), aber nach 1973 nur noch einen einzigen Roman (denn Peregrine: Secundus besteht aus zwei langen Erzählungen) bzw. deren zwei, wenn man den zusammen mit seiner Ex-Frau Grania Davis verfassten Marco Polo and the Sleeping Beauty (1988) mit dazunimmt. Und bei seinen Kurzgeschichten fällt auf, dass sein zwar manirierter, aber immer präziser und kontrollierter Stil sich allmählich verändert, dass die schon immer zu findenden Abschweifungen häufiger und länger werden und ihrerseits Abschweifungen generieren, und dass die eine oder andere gute Idee unter dem Ballast der Worte mehr oder weniger verschwindet (gut zu beobachten in den o.e. Stories um Doctor Eszterhazy). Irgendwann hat Davidson diese Schwächeperiode aber überwunden und konnte in seinen letzten Lebensjahren wieder an die Qualität seiner frühen Geschichten anknüpfen.
Nur seine Romanzyklen hat er nicht mehr beendet. Das ist vor allem im Hinblick auf die Vergil Magus Sequenz bedauerlich, von der vor einigen Jahren noch ein dritter Band – der wiederum zeitlich früher als die Vorgängerbände angesiedelt ist – in einer kleinauflagigen Liebhaberedition unter dem Titel The Scarlet Fig; or Slowly Through a Land of Stone (2005) veröffentlicht wurde. Und somit bleibt das, was Avram Davidson einst als “a trinity of trilogies” geplant hatte, und für das er umfangreiche Recherchen betrieben und eine Matrix aus Querverweisen und Hintergrundmaterial geschaffen hatte, letztlich ein Fragment. Aber auch die Nichtfortsetzung von The Island Under the Earth ist bedauerlich, auch wenn der Roman an die Vergil Magus Sequenz nicht herankommt.
Es ließe sich noch viel über Avram Davidson schreiben – etwa darüber, dass es wohl nicht immer leicht war, mit ihm umzugehen; oder darüber, dass er ein unglaublich belesener Mann gewesen sein muss, der über ein beinahe enzyklopädisches Wissen verfügt hat (was man einerseits sehr schön an den Essays in Adventures in Unhistory (1993) sehen kann, in denen er sich mit den Fakten hinter diversen Legenden – u.a. über den Phoenix, Prester John oder Hyperborea – auseinandergesetzt hat, und was man z.B. in den Vergil-Romanen deutlich spürt); oder auch darüber, dass die deutschen Leser und Leserinnen nur rund zwei Dutzend Kurzgeschichten (etliche davon – vor allem frühe – in einigen Utopia-Zukunft-Storybänden) kennenlernen können, weil er als gläubiger Jude keine Rechte nach Deutschland verkaufen wollte; oder man könnte noch erwähnen, dass Davidson zu Anfang seiner Karriere auch ein erfolgreicher Krimiautor war.
Aber das alles würde diesem komplexen, am 08. Mai 1993 gut zwei Wochen nach seinem 70. Geburtstag verstorbenen Menschen und Autor, dessen Geschichten mit denen eines Jorge Luis Borges verglichen wurden, und der vermutlich auch ein Vorbild für Gene Wolfe war, noch immer nicht annähernd gerecht werden.
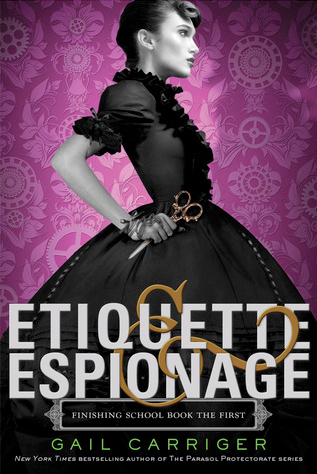 Die 14-jährige Sophronia Angelina Temminnick ist ein Wildfang, der ihrer Mutter mehr Arbeit und Sorge macht als alle (zahlreichen) Geschwister zusammen. Ihr Knicks ist zum Fürchten, ihr ständig zerrauftes Erscheinungsbild sowieso, und von ihrer freien Meinungsäußerung wachsen Mrs. Temminnick noch graue Haare. Höchste Zeit also, das Kind auf eine anständige Benimmschule für Mädchen zu verfrachten, wo man Sophronia die Flausen austreiben und aus ihr eine wohlerzogene junge Dame machen soll. Doch spätestens auf dem Weg dorthin wird schnell klar, dass hier irgendetwas im Busch ist, als die Kutsche von fliegenden Wegelagerern angegriffen wird.
Die 14-jährige Sophronia Angelina Temminnick ist ein Wildfang, der ihrer Mutter mehr Arbeit und Sorge macht als alle (zahlreichen) Geschwister zusammen. Ihr Knicks ist zum Fürchten, ihr ständig zerrauftes Erscheinungsbild sowieso, und von ihrer freien Meinungsäußerung wachsen Mrs. Temminnick noch graue Haare. Höchste Zeit also, das Kind auf eine anständige Benimmschule für Mädchen zu verfrachten, wo man Sophronia die Flausen austreiben und aus ihr eine wohlerzogene junge Dame machen soll. Doch spätestens auf dem Weg dorthin wird schnell klar, dass hier irgendetwas im Busch ist, als die Kutsche von fliegenden Wegelagerern angegriffen wird.
Zur Rezension bitte hier entlang.
Peter Jacksons Hobbit-Verfilmung ist erst kürzlich auf DVD erschienen, aber man hat dennoch den Eindruck, dass die allgemeine Begeisterung schneller nachgelassen hat als bei den Herr-der-Ringe-Filmen und anderen Franchises und Blockbustern. An den kommerziellen Erfolg der vorausgehenden Trilogie wird sie wohl schon allein aufgrund der Ausmaße anknüpfen, mit denen sie auf allen Kanälen präsent ist; der zweite und dritte Film werden es zeigen.
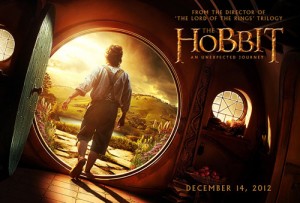 Eines ist jedoch bereits jetzt klar: Die allergrößte Freude, die Peter Jackson den Fans gemacht hat, ist zugleich das größte Problem der Hobbit-Verfilmung. Es gibt beim Hobbit in erster Linie mehr von Peter Jacksons Mittelerde zu sehen, eine Rückkehr zum Herr der Ringe und ein Fest von Anspielungen auf die Trilogie, die nicht nur in den direkten Verknüpfungen (etwa durch die Rahmengeschichte mit Frodo) offenbar werden. Monumentale Minen, angeschmutzte, aber edle Helden, ätherische Elbenheime, der Zwergenwitz in zwölffacher Ausführung – sie sind alle wieder da, sogar noch ein bisschen größer und glänzender als zuvor. Konnte man beim Herr der Ringe durchaus von einem Gesamtkunstwerk sprechen (ob es in allen Aspekten gelungen ist, ist eine andere Frage – aber ohne Zweifel hat die Trilogie den Fantasy-Film maßgeblich beeinflusst), brüht der Hobbit schlicht ein zweites Mal auf, was erprobt ist und beim Publikum ankommt.
Eines ist jedoch bereits jetzt klar: Die allergrößte Freude, die Peter Jackson den Fans gemacht hat, ist zugleich das größte Problem der Hobbit-Verfilmung. Es gibt beim Hobbit in erster Linie mehr von Peter Jacksons Mittelerde zu sehen, eine Rückkehr zum Herr der Ringe und ein Fest von Anspielungen auf die Trilogie, die nicht nur in den direkten Verknüpfungen (etwa durch die Rahmengeschichte mit Frodo) offenbar werden. Monumentale Minen, angeschmutzte, aber edle Helden, ätherische Elbenheime, der Zwergenwitz in zwölffacher Ausführung – sie sind alle wieder da, sogar noch ein bisschen größer und glänzender als zuvor. Konnte man beim Herr der Ringe durchaus von einem Gesamtkunstwerk sprechen (ob es in allen Aspekten gelungen ist, ist eine andere Frage – aber ohne Zweifel hat die Trilogie den Fantasy-Film maßgeblich beeinflusst), brüht der Hobbit schlicht ein zweites Mal auf, was erprobt ist und beim Publikum ankommt.
Das Traurige an der Tatsache, dass Peter Jackson den Hobbit einfach als ein weiteres episches Mittelerde-Heldenstück ausgeführt hat, für das keine neue Bildsprache und Erzählweise vonnöten waren, ist die Allgegenwart seiner Interpretation, die durch den Hobbit so zementiert wurde, dass Mittelerde für Künstler nun vermutlich jahrelang verbrannte Erde sein wird.
Betrachtet man dagegen die Vielzahl an künstlerischen Interpretationen, die in der Vergangenheit allein nur der Hobbit angeregt hat, erkennt man, dass Mittelerde viel mehr hergibt als den hyperrealistischen, häufig zwischen bierernst und albern changierenden Stil von Peter Jackson.
Aber wer kann sich jetzt noch von den omnipräsenten Filmbildern freimachen? Wer eigene, neue finden (oder sich noch an die alten erinnern, die man vor den Filmen hatte)?
Ganz besonders bedauerlich ist, dass wir von Guillermo del Toros Interpretation wohl so gut wie gar nichts zu Gesicht bekommen. Vielleicht hätte sein Einfluss dem Hobbit die dringend nötige Eigenständigkeit und jene spielerisch-zauberhafte, aber auch leicht unheimliche Atmosphäre angedeihen lassen können, auf die Peter Jackson zugunsten einer realistischeren und mit aufgeblasener Dramaturgie aufgemotzten Darstellung verzichtet hat. Hellboy (vor allem der zweite Teil) und Pans Labyrinth wären auf jeden Fall Hausnummern gewesen, nach deren Beispiel man sich auch einen anderen Hobbit gut hätte vorstellen können.
So aber weiß Mittelerde eigentlich nicht mehr zu überraschen, auch nicht im Aufbau, der ohne Rücksicht auf Verluste bewährte Muster abspult. Wohl auch der Aufspaltung in drei Filme geschuldet wird nicht einmal der Versuch unternommen, die allmähliche und fast unmerkliche Steigerung vom beschaulichen Hobbitdasein über erst eher burleske bis groteske Abenteuer bis hin zur Katastrophe der epischen Schlacht nachzuzeichnen. Nicht zuletzt durch die Einführung bedrohlicher und durchaus ernstzunehmender Dauergegner in Gestalt von Azog und seinem Gefolge herrscht in Peter Jacksons Filmfassung schon früh fast durchgehend munteres Kampfgetümmel, das unabhängig vom kurzfristigen Unterhaltungsfaktor Figurenzeichnung und Gesamtaussage in sehr konventionelle Bahnen verschiebt.
Der in diese Rachefehde eingebundene Thorin ist von seiner Buchvorlage ohnehin ein gutes Stück entfernt, da es ihm weit weniger auf die Rückgewinnung des Schatzes (die ja erst die Mitnahme eines vorgeblichen Meistereinbrechers auf die Queste motiviert) als auf den patriotischen Kampf um die verlorene Heimat anzukommen scheint. Kein Wunder, dass Bilbo sich bemüßigt fühlt, einem solchen Ersatz-Aragorn seine Heldenqualitäten zu demonstrieren und sich mit seiner hochdramatischen Rettungstat einen Respekt zu verdienen, der in dieser Version von Mittelerde anscheinend nur arg stereotypen echten Kerlen gebührt. Wie Thorin aus dieser Konstellation heraus noch glaubwürdig zu seiner Erkenntnis gelangen soll, dass man das Kind des freundlichen Westens vielleicht gerade für seine unkriegerischen Seiten würdigen sollte, erschließt sich nicht ganz, und so wird zumindest in diesem ersten Teil eine potentiell differenzierte Geschichte einem recht beliebigen Actionspektakel geopfert. Dagegen können auch liebevolle Anspielungen und seelenvolle Zwergengesänge nur sehr begrenzt ankommen.
Es drängt sich (wie bei vielen Blockbustern) der Verdacht auf, das Überbemühte, das jedes Haar im Zwergenbart sichtbar macht und eine dramaturgische Formel umsetzt, die das Publikum dort abholt, wo es gerade zu eigenen Überlegungen ansetzen könnte, soll nur einen Mangel an Charme und Phantasielosigkeit übertünchen. Wo ideenreicher und risikofreudigerer visueller Zauber Mittelerde als lebendiges und vielseitiges Setting hätte vertiefen können, ist lediglich solides Handwerk herausgekommen, ebenso wie erzählerisch das gewünschte “more of the same” geliefert wurde. Was der Hobbit letztlich in keiner Form aufweist, ist eine künstlerische Vision, und damit wird Mittelerde, das in der Vergangenheit so viele zu eigenen Geschichten, Bildern und Musik inspiriert hat, zu einem Kontinent der Einfallslosigkeit.