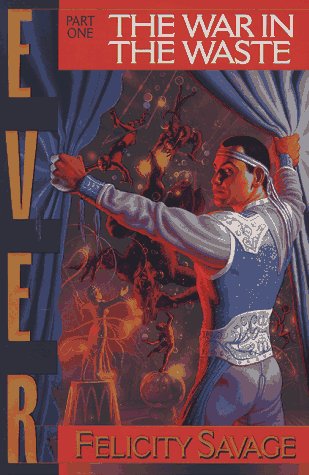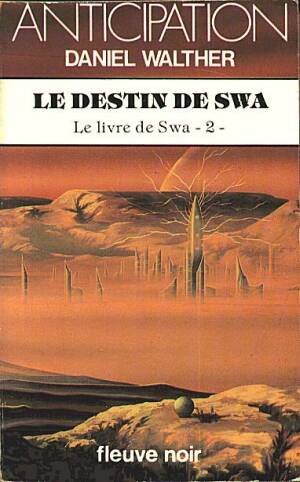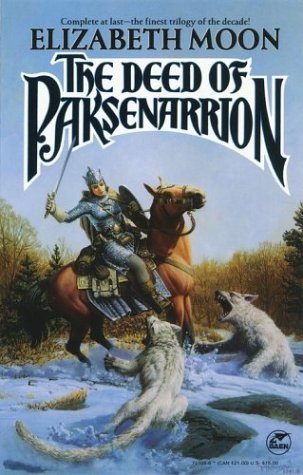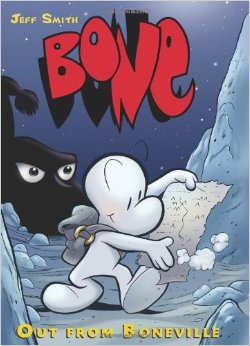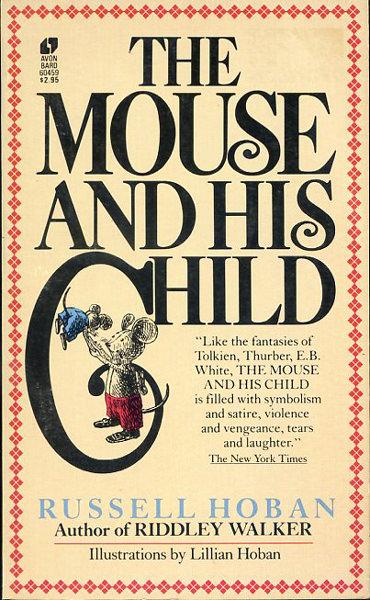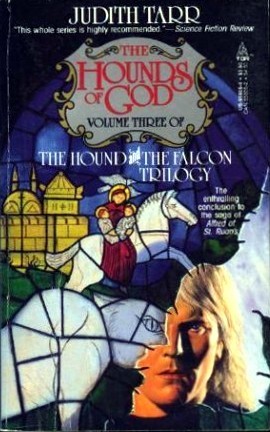Bibliotheka Phantastika gratuliert Felicity Savage, die heute ihren 40. Geburtstag feiern kann. Die am 14. März 1975 in Columbia, South Carolina, geborene Autorin hat ihre Kindheit und Jugend in Frankreich, Irland und auf den Äußeren Hebriden verbracht und lebt mittlerweile seit etlichen Jahren in Tokyo. Auch ihre Karriere ist ähnlich ungewöhnlich verlaufen: Als mit “Camera Man” ihre erste Kurzgeschichte veröffentlicht wurde (in der Februarausgabe ’94 von Tomorrow Speculative Fiction), war sie noch nicht einmal 19 Jahre alt, und im gleichen Jahr erschienen drei weitere Stories von ihr im renommierten Magazine of Fantasy & Science Fiction. Im darauffolgenden Jahr kam kurz vor ihrem Geburtstag mit Humility Garden ihr erster Roman auf den Markt, der im Herbst 1995 mit Delta City zum Zweiteiler Garden of Salt ergänzt wurde (unter diesem Titel auch als Sammelband (1996)).
Humility Garden und dessen Fortsetzung erzählen von den Abenteuern der gleichnamigen Titelheldin auf einer Welt namens Salt, die es auf der Suche nach ihrem Bruder nach Delta City verschlägt, eine Stadt, die nur aus politischen Intrigen und sexuellen Obsessionen zu bestehen scheint. Es dauert ein bisschen, bis Humility sich eingelebt hat – und ihr klar wird, welche Rolle ihr in der Revolution gegen die seit Jahrhunderten herrschenden Götter zufällt … Mit Garden of Salt hat die damals gerade 20-jährige Felicity Savage thematisches Neuland und ein Terrain betreten, das ein paar Jahre später von Jacqueline Carey und in jüngerer Vergangenheit von N.K. Jemisin weiter erforscht und ausgelotet wurde. Sie war – wenn man so will – ihrer Zeit ein bisschen voraus, und das lässt sich auch über ihre Ever Trilogy sagen.
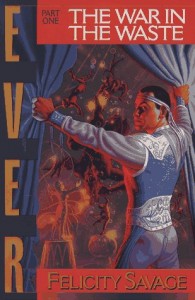 Denn besagte, mit The War in the Waste (1997) begonnene und mit The Daemon in the Machine und Trickster in the Ashes (beide 1998) fortgesetzte Trilogie lässt sich mit ein bisschen gutem Willen als Vorläufer des New Weird betrachten. Immerhin befindet man sich in The War in the Waste nicht in einer klassischen Fantasy-Welt, sondern in einem Setting, das bereits seine eigene industrielle – oder vielmehr dämonische – Revolution hinter sich hat, denn Fahrzeuge, Flugzeuge und andere Maschinen werden hier von Dämonen angetrieben, mit denen man allerdings auch umzugehen wissen muss. Einer von denen, die davon Ahnung haben, ist die Hauptfigur Crispin, der aufgrund widriger Umstände den Wanderartisten, mit denen er unterwegs ist, den Rücken kehren muss und sich bald mit Rae zusammentut, einem Flüchtling aus dem bekriegten Nachbarreich. Von diesem Krieg werden die beiden herumgeworfen, getrennt und wieder vereint, mit Seltsamkeiten und Vorurteilen konfrontiert und in Intrigen verstrickt – und der Umgang mit den Dämonen hat, wie man vor allem in den Folgebänden feststellen kann, auch seinen Preis. Felicity Savage nahm aber nicht nur mit ihrem ungewöhnlichen Setting einiges vorweg, das im Genre erst später abgefeiert werden sollte, sondern hat auch den passenden Erzählstil: Sie wirft Leser und Leserinnen relativ unvorbereitet mitten in ihre fremdartige Welt, lässt neue Begriffe und Konzepte auf sie einprasseln und lässt die Figuren dadurch sehr authentisch in ihren jeweiligen Milieus agieren.
Denn besagte, mit The War in the Waste (1997) begonnene und mit The Daemon in the Machine und Trickster in the Ashes (beide 1998) fortgesetzte Trilogie lässt sich mit ein bisschen gutem Willen als Vorläufer des New Weird betrachten. Immerhin befindet man sich in The War in the Waste nicht in einer klassischen Fantasy-Welt, sondern in einem Setting, das bereits seine eigene industrielle – oder vielmehr dämonische – Revolution hinter sich hat, denn Fahrzeuge, Flugzeuge und andere Maschinen werden hier von Dämonen angetrieben, mit denen man allerdings auch umzugehen wissen muss. Einer von denen, die davon Ahnung haben, ist die Hauptfigur Crispin, der aufgrund widriger Umstände den Wanderartisten, mit denen er unterwegs ist, den Rücken kehren muss und sich bald mit Rae zusammentut, einem Flüchtling aus dem bekriegten Nachbarreich. Von diesem Krieg werden die beiden herumgeworfen, getrennt und wieder vereint, mit Seltsamkeiten und Vorurteilen konfrontiert und in Intrigen verstrickt – und der Umgang mit den Dämonen hat, wie man vor allem in den Folgebänden feststellen kann, auch seinen Preis. Felicity Savage nahm aber nicht nur mit ihrem ungewöhnlichen Setting einiges vorweg, das im Genre erst später abgefeiert werden sollte, sondern hat auch den passenden Erzählstil: Sie wirft Leser und Leserinnen relativ unvorbereitet mitten in ihre fremdartige Welt, lässt neue Begriffe und Konzepte auf sie einprasseln und lässt die Figuren dadurch sehr authentisch in ihren jeweiligen Milieus agieren.
Nach der Ever Trilogy legte Felicity Savage eine mehrjährige Schaffenspause ein; erst 2011 ist sie mit der Veröffentlichung der Kurzgeschichtenbände Black Wedding and Five More Funerals (Horrorstories) sowie Love in Japan: Coming Clean and Four More Ways of F**king Up (literarische Stories) plötzlich wieder aufgetaucht. Weitere Veröffentlichungen einzelner Stories deuten ebenso auf eine dauerhafte Rückkehr zum Genre hin, wie ihre Pläne, über die sie sich 2013 in einem Interview (in der Märzausgabe des Lightspeed Magazine) folgendermaßen geäußert hat: “I’m working on a fat fantasy trilogy entitled The Godslayer Cycle. Imagine A Song of Ice and Fire … with guns, tanks, high finance, and sovereign debt denominated in holy relics. I believe this is going to be the world’s first fantasy trilogy to feature a credit crisis. It also features an eponymous magical sword, the boy who was born to wield it, an undercover magician in a world where magic is a felony, and a female intelligence operator who continues my tradition of strong women protagonists. Actually it may be a quartet at the rate I’m going. The setting is a fantasy world with 1980s-equivalent technology … and a few major differences.”
Tag: Jubiläen
Bibliotheka Phantastika gratuliert Daniel Walther, der heute 75 Jahre alt wird. Auch für den am 10. März 1940 im elsässischen Städtchen Munster geborenen SF- und Phantastik-Autor Daniel Walther gilt, was auf fast alle seine französischsprachigen Kolleginnen und Kollegen zutrifft: Von seinem recht umfangreichen Œuvre wurde nur ein kleiner Teil ins Deutsche übersetzt, und das meiste davon bereits in den 80er Jahren.
Walther hat nach dem Abbruch eines Pharmazie-Studiums Englisch und Deutsch studiert (was mit ein Grund dafür sein dürfte, dass er hervorragend Deutsch spricht) und viele Jahre lang hauptberuflich für eine elsässische Regionalzeitung gearbeitet. Seine ersten SF-Stories erschienen – angefangen mit “Les étrangers” – ab Mitte der 60er Jahre in dem langlebigen französischen SF-Magazin Fiction, und insgesamt hat er in den vergangenen 50 Jahren mehr als 200 längere und kürzere Erzählungen verfasst, von denen gerade mal ein gutes Dutzend auch hierzulande erschienen sind. Was seine vergleichsweise wenigen Romane angeht, sieht das Verhältnis etwas besser aus: von den zwischen 1972 (Mais l’espace … mais le temps …) und 2008 (Morbidezza, inc.) erschienenen ca. 20 Romanen wurden immerhin fünf übersetzt, und die dreibändige Sequenz Le Livre de Swa – sein einziger Mehrteiler – ist der Grund, warum Daniel Walther anlässlich seines heutigen Geburtstags hier überhaupt auftaucht.
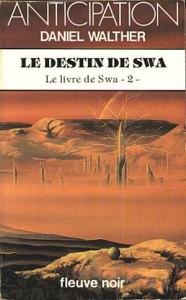 Denn Le Livre de Swa (1982), der Auftaktband, der der ganzen Reihe den Titel verleiht, und dessen Folgebände Le Destin de Swa und La Légende de Swa (beide 1983) haben es unter den Titeln Das Gesetz der goldenen Schlange (1985), Der Kristallkrieg und Der Tod der großen Schlange (beide 1986) als Das erste, zweite und dritte Buch von Shai ins Deutsche geschafft und bieten ein zwischen Fantasy und SF pendelndes Post-Doomsday-Setting, wie man es auch aus dem angloamerikanischen Sprachraum kennt.
Denn Le Livre de Swa (1982), der Auftaktband, der der ganzen Reihe den Titel verleiht, und dessen Folgebände Le Destin de Swa und La Légende de Swa (beide 1983) haben es unter den Titeln Das Gesetz der goldenen Schlange (1985), Der Kristallkrieg und Der Tod der großen Schlange (beide 1986) als Das erste, zweite und dritte Buch von Shai ins Deutsche geschafft und bieten ein zwischen Fantasy und SF pendelndes Post-Doomsday-Setting, wie man es auch aus dem angloamerikanischen Sprachraum kennt.
Hauptfigur der Reihe ist der junge Shai (im Original Swa), der am Anfang von Das Gesetz der goldenen Schlange in der Zitadelle, dem Tempel des Ordens der goldenen Schlange, zum Lehrling geweiht wird. Sein Weg in der Gemeinschaft derer, die altes Wissen bewahren und in einem ständigen Kampf mit den Horden des Draußen liegen, scheint vorgezeichnet – doch Shai hat merkwürdige Träume, in denen ihm einer der Anführer der Draußen lebenden Wesen erscheint, und die sein Unbehagen mit den restriktiven Regeln und Dogmen des Ordens mehr und mehr verstärken. Und schon bald kommt es zu Ereignissen, die Shai eine schicksalhafte Entscheidung treffen lassen und sein Leben von Grund auf verändern. Shais Entscheidung verschafft ihm nicht nur alte und neue Freunde wie Lsi (die ein Knabe sein musste, weil nur Knaben zu Neophyten des Ordens werden können) oder den geheimnisvollen Bärengesicht oder den zwergenhaften Dorn, sondern in Dmitri Vashar auch einen unbarmherzigen Feind – und sie führt ihn auf eine Odyssee quer durch eine bizarre und gelegentlich doch irgendwie vertraut wirkende Welt, auf der so manche Überraschung auf ihn wartet …
Die Bücher von Shai unterscheiden sich in mehrfacher Hinsicht von den meisten ähnlich gelagerten Werken angloamerikanischer Provenienz. Da wäre beispielsweise der den Bänden jeweils vorangestellte kurze Prolog, in dem knapp, aber plastisch geschildert wird, warum und wie die Welt sich verändert hat, da wäre die teilweise fast schon atemlos dahingaloppierende Handlung, die dafür sorgt, dass in den drei dünnen Büchern (die deutschen Ausgaben haben jeweils um die 150 Seiten) erstaunlich viel passiert, da wäre eine metaphernreiche Sprache, die sich ganz anders liest als das, was man von Übersetzungen aus dem Englischen gewohnt ist, und da wäre schließlich noch die Tatsache, dass Le Livre de Swa von Daniel Walther als bewusster Gegenentwurf zu Ayn Rands Anthem konzipiert wurde.
Natürlich führt die dahineilende Handlung auch zu einer sparsameren Figurenzeichnung und dazu, dass vor allem in Sachen Hintergrund und Setting Vieles nur angerissen und angedeutet wird. Wer also eine Geschichte braucht, in der alles 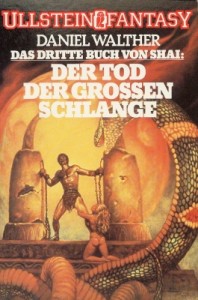 “auserzählt” wird, dürfte mit Walthers Post-Doomsday-Dreiteiler eher nicht glücklich werden. Das Gleiche gilt vermutlich für alle diejenigen, die von Ayn Rands Denkmodellen begeistert sind, denn in Shais Welt hat das Individuum, das nur auf sich selbst konzentriert und fixiert ist, nur begrenzte Möglichkeiten, zu überleben. Im Gegenteil – wenn Shai auf seiner Reise durch eine Welt, deren Achse sich verschoben und deren Geografie sich verändert hat, etwas lernt, dann das, dass er Freunde und Kameradinnen wie Bärengesicht, Dorn und Lsi und noch ein paar andere braucht, und dass es einer Gemeinschaft bedarf, wenn die Dinge sich irgendwann zum Besseren ändern sollen.
“auserzählt” wird, dürfte mit Walthers Post-Doomsday-Dreiteiler eher nicht glücklich werden. Das Gleiche gilt vermutlich für alle diejenigen, die von Ayn Rands Denkmodellen begeistert sind, denn in Shais Welt hat das Individuum, das nur auf sich selbst konzentriert und fixiert ist, nur begrenzte Möglichkeiten, zu überleben. Im Gegenteil – wenn Shai auf seiner Reise durch eine Welt, deren Achse sich verschoben und deren Geografie sich verändert hat, etwas lernt, dann das, dass er Freunde und Kameradinnen wie Bärengesicht, Dorn und Lsi und noch ein paar andere braucht, und dass es einer Gemeinschaft bedarf, wenn die Dinge sich irgendwann zum Besseren ändern sollen.
Neben Le Livre de Swa (das 2006 in Frankreich noch einmal als Sammelband erschienen ist) hat Daniel Walther mit der aus bislang fünf Erzählungen bestehenden La Saga de Synge et de Brennan noch ein zweites, ähnlich gelagertes Werk geschaffen, das in ferner Zukunft in einem Science-Fantasy-Setting angesiedelt ist. Die ersten vier Erzählungen (von denen drei bereits in den 70er Jahren entstanden sind) erschienen 1984 in dem Band Nocturne sur fond d’épées auch in Buchform; eine um eine ganz aktuelle Geschichte ergänzte zweite Ausgabe kam 2007 unter dem gleichen Titel auf den Markt.
Beim Rest von Daniel Walthers Œuvre handelt es sich einerseits um SF mit mehr oder minder starkem Phantastik-Einschlag, andererseits um reine Phantastik. (Interessanterweise hat er auch mindestens einen “echten” SF-Roman verfasst, der sich eines Post-Doomsday-Settings bedient, und der unter dem Titel Der neue Sonnenstaat (1985; OT: Happy end (1982)) auch hierzulande veröffentlicht wurde.)
Bibliotheka Phantastika gratuliert Elizabeth Moon, die heute 70 Jahre alt wird. Die am 07. März in McAllen, Texas, geborene Susan Elizabeth Norris begann schon in jungen Jahren zu schreiben und verfasste als Teenager ihre ersten SF-Stories. Doch ehe aus diesen Anfängen eine Karriere als Fantasy- und SF-Autorin werden sollte, standen ein Geschichtsstudium, eine mehrjährige Dienstzeit im US Marine Corps, eine Heirat und ein 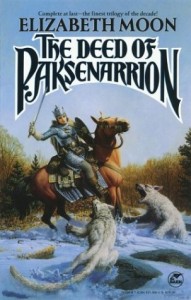 Biologiestudium auf dem Programm. Im Juli 1986 war es dann aber schließlich soweit: mit “Bargains” erschien ihre erste Kurzgeschichte in der von Marion Zimmer Bradley herausgegebenen Anthologie Sword and Sorceress III. Danach wandte Elizabeth Moon sich zunächst einmal der SF zu und veröffentlichte ein gutes halbes Dutzend Kurzgeschichten in dem der Hard SF zuneigenden Magazin Analog. Überraschenderweise war ihr erstes Romanprojekt dann wieder Fantasy – und dazu so umfangreich, dass The Deed of Paksenarrion in drei Teilen veröffentlicht wurde (denn den gut tausendseitigen Erstling einer bislang eher unbekannten Autorin auf den Markt zu bringen, beinhaltet natürlich gewisse verlegerische Risiken).
Biologiestudium auf dem Programm. Im Juli 1986 war es dann aber schließlich soweit: mit “Bargains” erschien ihre erste Kurzgeschichte in der von Marion Zimmer Bradley herausgegebenen Anthologie Sword and Sorceress III. Danach wandte Elizabeth Moon sich zunächst einmal der SF zu und veröffentlichte ein gutes halbes Dutzend Kurzgeschichten in dem der Hard SF zuneigenden Magazin Analog. Überraschenderweise war ihr erstes Romanprojekt dann wieder Fantasy – und dazu so umfangreich, dass The Deed of Paksenarrion in drei Teilen veröffentlicht wurde (denn den gut tausendseitigen Erstling einer bislang eher unbekannten Autorin auf den Markt zu bringen, beinhaltet natürlich gewisse verlegerische Risiken).
Interessanterweise sind die drei Teile trotzdem in sich sehr rund, was nicht zuletzt damit zu tun hat, dass in ihnen jeweils ein anderer Aspekt der Handlung und der Entwicklung ihrer Hauptfigur im Mittelpunkt steht. In Sheepfarmer’s Daughter (1988) lernen wir Paksenarrion Dorthansdotter kennen, die Tochter eines Schafszüchters, der irgendwo unweit der nördlichen Grenze eines mittelalterlichen Königreichs ein armseliges Leben fristet. Seine Tochter Paks – wie Paksenarrion dankenswerterweise zumeist genannt wird –, ein großes, kräftiges und mehr als ein bisschen eigensinniges Mädchen, träumt im Stillen von einem Leben als heldenhafte Kriegerin, von Ruhm und magischen Schwertern und großen Taten. Und als sie erfährt, dass sie den Sohn eines Nachbarn heiraten soll, schnappt sie sich das Schwert ihres Großvaters und läuft davon, um sich einer in der Nähe lagernden Söldnertruppe anzuschließen. Doch das Leben, das sie dort erwartet, hat zunächst wenig mit ihren Träumen gemein. Statt Ruhm und großer Taten gibt es endlose Tage voller erbarmungslosem Drill, und als der überstanden ist, folgen lange, anstrengende Märsche und langwierige Belagerungen. Und Kämpfe, in denen Paks töten muss, um nicht selbst getötet zu werden. Natürlich übersteht Paks das alles – und nicht nur das, sie wächst auch an den Aufgaben, die sich ihr stellen. Aber das muss sie auch, denn die eigentliche Herausforderung wartet erst in Divided Allegiance (1988) und Oath of Gold (1989) – und nachdem sie Herzog Phelans Söldnertruppe verlassen hat – auf sie.
Elizabeth Moons The Deed of Paksenarrion (1992 auch als Sammelband) ist in doppelter Hinsicht ein interessantes Werk. Da wäre zunächst einmal die Welt, die wir durch Paks’ Augen nach und nach kennenlernen, eine Welt, in der es Elfen, Zwerge, Orks und Magie gibt (wobei diese Aspekte allerdings erst ab dem zweiten Band deutlicher zum Tragen kommen) und die dadurch wie eine oft gesehene generische Fantasywelt wirkt. Allerdings spielen in dieser Welt auch der Glaube bzw. die unterschiedlichen Religionen eine wesentliche Rolle, was u.a. mit dazu beiträgt, dass sie sich wesentlich authentischer “mittelalterlich” anfühlt als so manch andere Welt, die sich dieses Settings bedient. Und dann haben wir natürlich noch Paksenarrion Dorthansdotter, die weit mehr als das weibliche Äquivalent der in der Fantasy gelegentlich auftretenden Stallburschen und Küchenjungen ist. Denn auch, wenn sie in gewisser Hinsicht eine “Auserwählte” ist, muss sie sich ihre Entwicklung hart erarbeiten. Ihr, der eher schlichten Schafszüchtertochter aus dem Hinterland des Königreichs, fällt nichts in den Schoß – doch gerade die Tatsache, dass sie sich in kleinen Schritten und unter großen körperlichen und geistigen Anstrengungen weiterentwickelt, macht das, was in den Bänden zwei und drei geschieht bzw. aus ihr wird, umso glaubwürdiger. (Wobei nicht verschwiegen werden soll, dass besagte kleine Schritte vor allem Paks’ Ausbildung bei den Söldnern zu einem etwas zähen Leseerlebnis machen.)
Mit dem aus den Bänden Surrender None (1990) und Liar’s Oath (1992) bestehenden Zweiteiler The Legacy of Gird (1996 unter diesem Titel auch als SB; auch als A Legacy of Honour (2010)) erzählte Elizabeth Moon zunächst noch eine weitere Geschichte aus der gleichen Welt, und zwar die einer zu Zeiten Paksenarrions nur noch legendären Figur, denn in ihr geht es um Gird, den Schutzpatron der Krieger, dessen Leben nicht unbedingt deckungsgleich zu seiner Legende verlaufen ist. Parallel dazu veröffentlichte sie ihre ersten SF-Romane (die im Gegensatz zu ihren Fantasyromanen zumi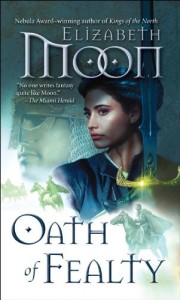 ndest teilweise auch ins Deutsche übersetzt wurden) und blieb der SF anschließend fast zwanzig Jahre lang treu.
ndest teilweise auch ins Deutsche übersetzt wurden) und blieb der SF anschließend fast zwanzig Jahre lang treu.
2010 ist Elizabeth Moon schließlich mit dem aus den Bänden Oath of Fealty (2010), Kings of the North (2011), Echoes of Betrayal (2012), Limits of Power (2013) und Crown of Renewal (2014) bestehenden Fünfteiler Paladin’s Legacy, dessen erster Band direkt an Oath of Gold bzw. The Deed of Paksenarrion anschließt, wieder nach “Paksworld” und zu Paksenarrion zurückgekehrt, und mit Deeds of Honor (2014) liegen inzwischen auch die zuvor verstreut erschienenen zum Zyklus gehörenden Erzählungen zumindest als E-Book gesammelt vor.
Bibliotheka Phantastika gratuliert Zachary Jernigan, der heute seinen 35. Geburtstag feiert. Damit gehört der am 05. März 1980 in Farmington, Connecticut, USA, geborene Autor in dieser Jubiläenreihe eindeutig zum Nachwuchs, und zwar zur vielversprechenden Sorte, wie er mit seinem Romandebüt No Return (2013) bewiesen hat, dem ersten Teil einer auf der Welt Jeroun angesiedelten Reihe, mit der Jernigan einige interessante Konzepte einführt: Jeroun ist eine düstere, von Konflikten überzogene, ideologisch zersplitterte Welt, auf der die Natur dem Menschen nicht wohlgesonnen ist und sich die Befürworter Gottes mit den Gottes-Ablehnern kloppen, unter anderem in organisierten Straßenschlachten. Denn der zur Debatte stehende Gott, Adrash, ist da, schwebt missvergnügt im Orbit und tätschelt 27 von ihm dort deponierte Objekte, die zusammen (von unten betrachtet) die Konstellation The Needle ergeben, die er jederzeit auf die Welt schleudern 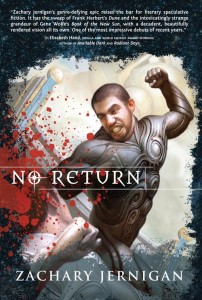 und damit die Zivilisation vernichten könnte. Dort unten versuchen nun verschiedene Menschen die Launen des Gottes und ihre Folgen mal mehr, mal weniger direkt zu beeinflussen: In No Return steht das Schicksal des Glaubenskriegers Vedas im Mittelpunkt, eines formidablen Kämpfers, der seine Ablehnung gegenüber Adrash auf körperlichem Wege ausdrückt und die Anhänger des Gottes vermöbelt. Auf seiner Mission zu einem Turnier als Anti-Gottes-Champion schließen sich ihm ein künstlicher Mensch aus Metall und eine Gladiatorin an, die jeweils eigene Pläne verfolgen, und diese drei schwierigen Personen werden zunächst keine fröhliche, sondern eine sehr schweigsame Reisegruppe. Einen anderen Weg verfolgen die sogenannten outbound mages, die mit Magie und Alchemie in den Orbit fliegen und Adrash direkter zu beeinflussen suchen, allerdings ein von Ränken und Missgunst zerfressener Orden sind.
und damit die Zivilisation vernichten könnte. Dort unten versuchen nun verschiedene Menschen die Launen des Gottes und ihre Folgen mal mehr, mal weniger direkt zu beeinflussen: In No Return steht das Schicksal des Glaubenskriegers Vedas im Mittelpunkt, eines formidablen Kämpfers, der seine Ablehnung gegenüber Adrash auf körperlichem Wege ausdrückt und die Anhänger des Gottes vermöbelt. Auf seiner Mission zu einem Turnier als Anti-Gottes-Champion schließen sich ihm ein künstlicher Mensch aus Metall und eine Gladiatorin an, die jeweils eigene Pläne verfolgen, und diese drei schwierigen Personen werden zunächst keine fröhliche, sondern eine sehr schweigsame Reisegruppe. Einen anderen Weg verfolgen die sogenannten outbound mages, die mit Magie und Alchemie in den Orbit fliegen und Adrash direkter zu beeinflussen suchen, allerdings ein von Ränken und Missgunst zerfressener Orden sind.
Man sieht schon, dass Jernigan zu den wenigen Autoren gehört, die der Fantasy klassische SF-Elemente einverleiben, und dass er auch etwas andere Fragen an seinen Figuren abarbeitet als in der üblichen Questen-Geschichte, auch wenn No Return vordergründig als eine solche daherkommt. Vedas’ Geschichte und die seiner Gefährten wird dieses Jahr mit Shower of Stones fortgesetzt – und man darf auch über Jeroun hinaus gespannt sein, was Zachary Jernigan noch aus der Fantasy herausholen wird, denn er ist ein Autor, der sich in die Mitte des Genres begibt und beweist, dass es auch dort noch Interessantes zu entdecken gibt.
Bibliotheka Phantastika gratuliert Jeff Smith, der heute seinen 55. Geburtstag feiert. Wenn es eine Synthese von klassischem Comic-Erzählen und Fantasy im engeren Sinne gibt, dann findet man sie im Werk des am 27. Februar 1960 in McKees Rocks, Pennsylvania, USA, geborenen Jeff Smith.
Doch nicht nur sein Transfer der Motive der epischen Fantasy – und zwar nicht kurzer Abenteuer, sondern eines langen, epischen Handlungsverlaufs mit einer am Questenmotiv orientierten Struktur – verleihen seinem Hauptwerk Bone (55 Folgen von 1991 bis 2004) eine Sonderstellung: Man könnte in Jeff Smith einen Vorläufer der modernen Webcomic-Künstler und Selfpublisher sehen, denn er brachte sein ambitioniertes Projekt zunächst in Eigenregie heraus – und es verkaufte sich so gut, dass es inzwischen etliche Auflagen (in Farbe, in Sammelbänden, als großer Sammelband) gibt, und natürlich eine Verlagsveröffentlichung.
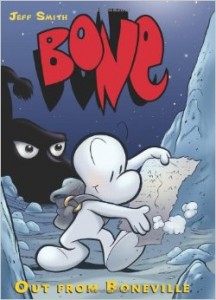 Worum geht es nun bei Bone, und was macht den Comic inhaltlich so besonders? Es gibt das Böse in Form des Herrn der Heuschrecken, der über ein friedliches, leicht mittelalterlich angehauchtes Tal herfällt, es gibt Thorn, die ausersehene Heldin, die ihn vielleicht zurückschlagen könnte, es gibt Drachen, aufmüpfige Insekten, Prophezeiungen und ein Heer von dunklen (aber auch sehr lustigen) Schergen – den Rattenmonstern. Und es gibt die Bone-Brüder, drei knubbelige, weiße Gestalten, die auch aus einem Zeitungscartoon stammen könnten, und die es nach einem kriminellen Fehlschlag des gerissenen Bruders in das doch nicht ganz so friedliche Tal verschlägt. Die Bones sind trotz ihrer Verfremdung (alle anderen Figuren sind realistischer gehaltene Menschen oder … Drachen oder Rattenmonster) Typen wie du und ich, die sich in einer fantastischen Welt wiederfinden (und sie dann auch gehörig aufmischen), und zu den drei unterschiedlichen Brüdern, dem Moby-Dick-süchtigen Fone Bone, dem nicht ganz hellen Smiley Bone und dem mit verbrecherischer Ader ausgestatteten Phoney Bone, kann man schnell eine Verbindung herstellen. Der Abenteuer-Geschichte fehlt es nicht an herzerwärmenden Momenten, skurrilen Nebenfiguren und -handlungen und Humor, und sie schafft es wie kaum ein anderer Comic, die Themen der epischen Fantasy mit viel Verständnis für ihre Wirkweise und sanfter Ironie zu transportieren.
Worum geht es nun bei Bone, und was macht den Comic inhaltlich so besonders? Es gibt das Böse in Form des Herrn der Heuschrecken, der über ein friedliches, leicht mittelalterlich angehauchtes Tal herfällt, es gibt Thorn, die ausersehene Heldin, die ihn vielleicht zurückschlagen könnte, es gibt Drachen, aufmüpfige Insekten, Prophezeiungen und ein Heer von dunklen (aber auch sehr lustigen) Schergen – den Rattenmonstern. Und es gibt die Bone-Brüder, drei knubbelige, weiße Gestalten, die auch aus einem Zeitungscartoon stammen könnten, und die es nach einem kriminellen Fehlschlag des gerissenen Bruders in das doch nicht ganz so friedliche Tal verschlägt. Die Bones sind trotz ihrer Verfremdung (alle anderen Figuren sind realistischer gehaltene Menschen oder … Drachen oder Rattenmonster) Typen wie du und ich, die sich in einer fantastischen Welt wiederfinden (und sie dann auch gehörig aufmischen), und zu den drei unterschiedlichen Brüdern, dem Moby-Dick-süchtigen Fone Bone, dem nicht ganz hellen Smiley Bone und dem mit verbrecherischer Ader ausgestatteten Phoney Bone, kann man schnell eine Verbindung herstellen. Der Abenteuer-Geschichte fehlt es nicht an herzerwärmenden Momenten, skurrilen Nebenfiguren und -handlungen und Humor, und sie schafft es wie kaum ein anderer Comic, die Themen der epischen Fantasy mit viel Verständnis für ihre Wirkweise und sanfter Ironie zu transportieren.
Bone gibt es auch auf Deutsch in Einzel- und Sammelausgaben (ab 1994), genauso die beiden Add-ons Stupid, Stupid Rat-Tails (1998, dt. Bone: Legenden (2011)) und Rose (2000-2002, dt. Rose (2011)).
Nach Bone hat sich Smith mit einem selbst herausgebrachten SF-Comic dem Wissenschaftler Rasl (2008-2012) zugewandt und ist mit dem als Webcomic erscheinenden Tüki (ab 2013) in die prähistorische Welt abgetaucht, womit er weiter auf dem Genre-Gebiet bleibt, das er sich mit Bone so perfekt erschlossen hat.
Bibliotheka Phantastika gratuliert Liz Williams, die heute ihren 50. Geburtstag feiert. Mit ihren bis auf eine Ausnahme stets als Einzelromanen erschienenen Geschichten, die meist schwer einzuordnen irgendwo zwischen SF, Fantasy und New Weird schillern, ist die am 26. Februar 1965 in Gloucester, Gloucestershire, England, UK, geborene Elizabeth Helen Laura Williams eine Autorin, die seit 15 Jahren interessante Beiträge zum Genre liefert, aber für die meisten Leser und Leserinnen – hierzulande auch mangels Übersetzung – unter dem Radar fliegt.
Ihr Debut The Ghost Sister (2001) deutet an, wohin die Reise geht, wenn man einen ihrer Romane zur Hand nimmt: Er konzentriert sich auf Mevennen, die auf ihrem Planeten zum Ausschussmaterial gehört, denn auf Monde D’Isle lebt man völlig im Einklang mit dem natürlichen Lauf der Dinge, und da müssen die Schwächsten eben dran glauben. Dass es noch etwas anderes gibt als Instinkte und völliges Verlassen auf den Rhythmus des Lebens, muss Mevennen erst erfahren.
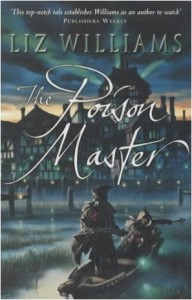 In The Poison Master (2003) greift Williams dann konzeptmäßig in die Vollen: Dort hat Alivet Dee (Nachfahrin von John Dee, der ebenfalls eine wichtige Rolle in diesem Roman spielt) nur ein Ziel: Auf ihrem sumpfigen Heimatplaneten ihre Schwester aus der Sklaverei bei den mysteriösen, grausamen Aliens zu befreien, die nur als die Night Lords bekannt sind. Die Reisen auf andere Welten, während derer sie die Hilfe eines Meisters der Gifte gewinnen kann, um ihre Feinde ein für allemal aus dem Weg zu räumen, zeigen ein Universum, das von alchemischen und kabbalistischen Prinzipien bestimmt wird.
In The Poison Master (2003) greift Williams dann konzeptmäßig in die Vollen: Dort hat Alivet Dee (Nachfahrin von John Dee, der ebenfalls eine wichtige Rolle in diesem Roman spielt) nur ein Ziel: Auf ihrem sumpfigen Heimatplaneten ihre Schwester aus der Sklaverei bei den mysteriösen, grausamen Aliens zu befreien, die nur als die Night Lords bekannt sind. Die Reisen auf andere Welten, während derer sie die Hilfe eines Meisters der Gifte gewinnen kann, um ihre Feinde ein für allemal aus dem Weg zu räumen, zeigen ein Universum, das von alchemischen und kabbalistischen Prinzipien bestimmt wird.
Nine Layers of the Sky (2003) basiert auf den Erfahrungen, die Williams bei einem Aufenthalt in Kasachstan gesammelt hat, und greift auf die Mythologie Russlands und Zentralasiens zurück, um diese im Stil der Urban Fantasy mit dem Leben in den modernen ehemaligen Sowjet-Staaten zu verbinden, während es die Reise der Ex-Weltraumforscherin Elena nach Samarkand beschreibt.
Der Ansatz muss für Williams gut funktioniert haben, denn ihr bisher zugänglichstes und (vielleicht auch wegen der hübschen Original-Cover) am stärksten wahrgenommenes Werk, die Romane um 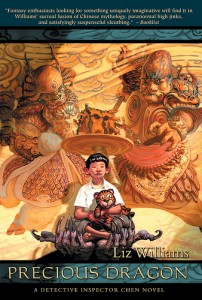 Detective Inspector Chen, funktionieren nach einem ähnlichen Prinzip, nur noch etwas weiter im Osten, wo sie, beginnend mit Snake Agent (2005), die Abenteuer der bei der Polizei von Singapur 3 für die übernatürlichen Fälle zuständigen Titelfigur erzählen, und die seines unfreiwilligen Partners Zhu Irz, eines Dämons direkt aus der chinesischen Hölle. Den richtigen Durchbruch scheint das Liz Williams aber auch nicht gebracht zu haben, denn nach drei weiteren Bänden (The Demon and the City (2006), Precious Dragon (2007) und The Shadow Pavillion (2009)) kam es zum Wechsel zu einem kleineren Verlag, und den abschließenden Band Morningstar hat sie (nach The Iron Khan (2010)) offenbar letzten Herbst in Eigenregie für die Fans zu Ende gebracht.
Detective Inspector Chen, funktionieren nach einem ähnlichen Prinzip, nur noch etwas weiter im Osten, wo sie, beginnend mit Snake Agent (2005), die Abenteuer der bei der Polizei von Singapur 3 für die übernatürlichen Fälle zuständigen Titelfigur erzählen, und die seines unfreiwilligen Partners Zhu Irz, eines Dämons direkt aus der chinesischen Hölle. Den richtigen Durchbruch scheint das Liz Williams aber auch nicht gebracht zu haben, denn nach drei weiteren Bänden (The Demon and the City (2006), Precious Dragon (2007) und The Shadow Pavillion (2009)) kam es zum Wechsel zu einem kleineren Verlag, und den abschließenden Band Morningstar hat sie (nach The Iron Khan (2010)) offenbar letzten Herbst in Eigenregie für die Fans zu Ende gebracht.
Mit ihrer jüngsten Verlagspublikation Worldsoul (2012) blieb sie ihren Themen treu – Alchemie und Kabbala spielen auch im Multiversum eine große Rolle, durch das sich Mercy bewegt: Sie ist Bibliothekarin in einer Stadt, in der verschiedenste Welten aufeinandertreffen, und schnappt sich zur Arbeit in den gefährlichen Archiven morgens erstmal die passende Waffe.
Angesichts von Liz Williams’ Karriere bestätigt sich wohl, dass extravagante Themen und Ansätze, die weniger in der physischen als in der metaphysischen Welt verankert sind, und Settings abseits vom Mainstream nicht unbedingt das Erfolgsrezept für den Buchmarkt darstellen. Es lohnt sich aber, sich die älteren Titel dieser spannenden Autorin anzuschauen, wenn man für ideenbasierte Genre-Grenzgänger etwas übrig hat, und man kann hoffen, dass sie der Phanastik zumindest als Selfpublisherin erhalten bleibt.
Bibliotheka Phantastika erinnert an Ardath Mayhar, die heute 85 Jahre alt geworden wäre. Geschrieben hat die am 20. Februar 1930 in Timpson, Texas, geborene Ardath Frances Hurst schon als Teenager (und im Alter von 19 Jahren ihre ersten Gedichte veröffentlicht), doch so richtig in Gang gekommen ist ihre Autorenkarriere erst, als sie sich Mitte der 70er Jahre (und nun unter dem Familiennamen ihres Mannes) der SF und Fantasy bzw. ganz allgemein der Belletristik zuwandte. Den Anfang machte die später in den zweiten Band der vierteiligen Fantasysequenz Tales of the Triple Moons eingearbeitete Kurzgeschichte “The Cat with the Sapphire Eyes” (1974 in Weirdbook Eight), auf die noch viele weitere folgen sollten, so dass Ardath Mayhars Bibliographie zum Zeitpunkt ihres Todes am 01. Februar 2012 mehr als 200 längere und kürzere Geschichten ausweist. Hinzu kommen rund 60 Romane quer durch (fast) alle Genres, von SF und Fantasy über historische Romane, Jugendbücher und prähistorische Abenteuerromane bis hin zu Western (die sie unter Pseudonymen wie John Killdeer, Frank Cannon oder Frances Hurst verfasst hat).
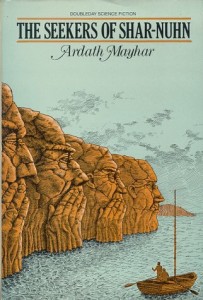 Mayhars frühe Romane lassen sich fast ausschließlich der Fantasy zurechnen; ihr Erstling How the Gods Wove in Kyrannon (1979) bildete den Auftakt der bereits erwähnten Tales of the Triple Moons, die mit The Seekers of Shar-Nuhn (1980), Warlock’s Gift (1982), und Lords of the Triple Moons (1983) weitergeführt wurden. Die vier nur locker durch den Hintergrund miteinander verbundenen Bände orientieren sich thematisch und inhaltlich mehr an klassischer Abenteuerliteratur als an der damals noch vorherrschenden Sword & Sorcery oder den gerade aufkommenden, mehr oder weniger tolkienesken Questen. Im ersten geht es darum, einen tyrannischen Herrscher zu stürzen (wobei diejenigen, die dabei eine wichtige Rolle spielen, sich zunächst einmal von einer vernichtenden Niederlage erholen müssen), im dritten muss sich ein Prinz sein Geburtsrecht zurückholen, was bedeutet, sich mit einem üblen Zauberer und Usurpator auseinandersetzen zu müssen, und auch im vierten ist der Feind ein despotischer Tyrann und Usurpator. Der zweite Band The Seekers of Shar-Nuhn fällt ein bisschen aus dem Rahmen (und ist vermutlich deswegen auch der interessanteste), denn in diesem Episodenroman geht es um Klah-Noh, einen “Seeker After Secrets” (oder modern: Detektiv) und seinen Assistenten Si-Lun, die mit immer neuen Rätseln und Geheimnissen konfrontiert werden. Nicht ganz unproblematisch an der Sache ist, dass jedes ungelöste Rätsel und jedes unaufgedeckte Geheimnis Klah-Noh grundsätzlich furchtbar nervös macht – und Si-Lun ein paar sehr persönliche Geheimnisse hat … Die Episoden leben nicht zuletzt von der Interaktion der beiden Hauptfiguren, und auch die Welt, auf der die gesamte Sequenz spielt – eine Welt, die eher an eine postapokalyptische Welt mit Fantasy-Elementen als an ein Fantasy-Standardsetting erinnert – gewinnt spürbar an Konturen.
Mayhars frühe Romane lassen sich fast ausschließlich der Fantasy zurechnen; ihr Erstling How the Gods Wove in Kyrannon (1979) bildete den Auftakt der bereits erwähnten Tales of the Triple Moons, die mit The Seekers of Shar-Nuhn (1980), Warlock’s Gift (1982), und Lords of the Triple Moons (1983) weitergeführt wurden. Die vier nur locker durch den Hintergrund miteinander verbundenen Bände orientieren sich thematisch und inhaltlich mehr an klassischer Abenteuerliteratur als an der damals noch vorherrschenden Sword & Sorcery oder den gerade aufkommenden, mehr oder weniger tolkienesken Questen. Im ersten geht es darum, einen tyrannischen Herrscher zu stürzen (wobei diejenigen, die dabei eine wichtige Rolle spielen, sich zunächst einmal von einer vernichtenden Niederlage erholen müssen), im dritten muss sich ein Prinz sein Geburtsrecht zurückholen, was bedeutet, sich mit einem üblen Zauberer und Usurpator auseinandersetzen zu müssen, und auch im vierten ist der Feind ein despotischer Tyrann und Usurpator. Der zweite Band The Seekers of Shar-Nuhn fällt ein bisschen aus dem Rahmen (und ist vermutlich deswegen auch der interessanteste), denn in diesem Episodenroman geht es um Klah-Noh, einen “Seeker After Secrets” (oder modern: Detektiv) und seinen Assistenten Si-Lun, die mit immer neuen Rätseln und Geheimnissen konfrontiert werden. Nicht ganz unproblematisch an der Sache ist, dass jedes ungelöste Rätsel und jedes unaufgedeckte Geheimnis Klah-Noh grundsätzlich furchtbar nervös macht – und Si-Lun ein paar sehr persönliche Geheimnisse hat … Die Episoden leben nicht zuletzt von der Interaktion der beiden Hauptfiguren, und auch die Welt, auf der die gesamte Sequenz spielt – eine Welt, die eher an eine postapokalyptische Welt mit Fantasy-Elementen als an ein Fantasy-Standardsetting erinnert – gewinnt spürbar an Konturen.
Mal abgesehen von The Seekers of Shar-Nuhn wirken Ardath Mayhars Fantasyromane – und das gilt nicht nur für die anderen Bände der Tales, sondern auch für den etwa zeitgleich erschienenen Tyrnos-Zweiteiler (Soul-Singer of Tyrnos (1981) und Runes of the Lyre (1982)) oder spätere Titel wie Makra Choria (1987) oder The Exiles of Damaria (2009) – immer ein bisschen wie Jugendbücher, auch wenn sie nicht als solche konzipiert wurden bzw. in einem Jugendbuchverlag erschienen sind. Das hat einerseits vermutlich mit der inhaltlichen Ausrichtung am klassischen Abenteuerroman zu tun, dürfte aber andererseits vor allem auf die moralische Integrität ihrer Heldenfiguren zurückzuführen sein. Und natürlich darauf, dass sich meist junge Menschen ihren Platz im Leben erkämpfen und an dieser Aufgabe wachsen müssen. Ardath Mayhars häufig vermittelte Botschaft, dass Menschen mehr erreichen, wenn sie miteinander statt gegeneinander arbeiten (die z.B. auch in ihrem Post-Doomsday-Roman The World Ends in Hickory Hollow (1985) zu finden ist), mag heutzutage ein bisschen angestaubt wirken – was nicht heißt, dass die Idee als solche nicht bedenkenswert wäre.
Eine Sonderstellung unter ihren Fantasyromanen nimmt auch The Saga of Grittel Sundotha (1985) ein; Ardath Mayhar selbst sagt über die Titelheldin des (aus der in Amazons II veröffentlichten Geschichte “Who Courts a Reluctant Maiden” hervorgegangenen) Romans: “Grittel Sundotha is A. Mayhar, if I had been seven feet instead of five feet two”, und lässt die nicht nur überdurchschnittlich große, sondern auch entsprechend kräftige Grittel Abenteuer in bester Sword-&-Sorcery-Manier erleben.
 Ardath Mayhars vielleicht bekanntester Roman dürfte Golden Dream: A Fuzzy Odyssey (1982) sein, ein SF-Roman und Teil eines Versuchs, aus den von H. Beam Piper erfundenen “Fuzzies” ein Franchise zu machen (ein Versuch, den man mit dem von John Scalzi unter dem Titel Fuzzy Nation (2011) verfassten “Reboot” der originalen Fuzzy-Reihe übrigens kürzlich ein weiteres Mal unternommen hat). In der ersten Hälfte von Golden Dream verleiht sie den Fuzzies (oder Gashta, wie sie sich selbst nennen), aus denen Michael Whelan vermutlich die cutest aliens ever gemacht hat, deutlich mehr Konturen als je zuvor, gibt ihnen eine eigene Sprache und soziale und familiäre Strukturen, und bettet das Ganze in eine abenteuerliche Handlung, bei der es um nichts weniger als das Überleben der Fuzzies geht. Denn diese sind die Nachkommen von vor mehreren Generationen gestrandeten Raumfahrern und haben alle Mühe, auf der für sie fremden Welt Zarathustra zu überleben. In der zweiten Hälfte geht es dann um den ersten Kontakt mit den “Hagga”, den Menschen – was bedeutet, dass in ihr der erste Fuzzy-Roman H. Beam Pipers (dieses Mal eben aus Sicht der Fuzzies) nacherzählt wird. Man sollte sich übrigens von Michael Whelans putzigem Cover (das hier in voller Größe und ohne störende Typographie zu bewundern ist) nicht täuschen lassen. Paradiesisch geht es im Tal der Fuzzies wahrlich nicht zu, ganz im Gegenteil …
Ardath Mayhars vielleicht bekanntester Roman dürfte Golden Dream: A Fuzzy Odyssey (1982) sein, ein SF-Roman und Teil eines Versuchs, aus den von H. Beam Piper erfundenen “Fuzzies” ein Franchise zu machen (ein Versuch, den man mit dem von John Scalzi unter dem Titel Fuzzy Nation (2011) verfassten “Reboot” der originalen Fuzzy-Reihe übrigens kürzlich ein weiteres Mal unternommen hat). In der ersten Hälfte von Golden Dream verleiht sie den Fuzzies (oder Gashta, wie sie sich selbst nennen), aus denen Michael Whelan vermutlich die cutest aliens ever gemacht hat, deutlich mehr Konturen als je zuvor, gibt ihnen eine eigene Sprache und soziale und familiäre Strukturen, und bettet das Ganze in eine abenteuerliche Handlung, bei der es um nichts weniger als das Überleben der Fuzzies geht. Denn diese sind die Nachkommen von vor mehreren Generationen gestrandeten Raumfahrern und haben alle Mühe, auf der für sie fremden Welt Zarathustra zu überleben. In der zweiten Hälfte geht es dann um den ersten Kontakt mit den “Hagga”, den Menschen – was bedeutet, dass in ihr der erste Fuzzy-Roman H. Beam Pipers (dieses Mal eben aus Sicht der Fuzzies) nacherzählt wird. Man sollte sich übrigens von Michael Whelans putzigem Cover (das hier in voller Größe und ohne störende Typographie zu bewundern ist) nicht täuschen lassen. Paradiesisch geht es im Tal der Fuzzies wahrlich nicht zu, ganz im Gegenteil …
Ardath Mayhar war gewiss keine “große” Autorin, die der Fantasy oder der SF wesentliche Impulse verliehen oder unsterbliche Werke hinterlassen hat; dessen ungeachtet eignen sich ihre Romane nicht zuletzt aufgrund ihrer klaren moralischen Standpunkte als Einstiegslektüre für jugendliche Leser und Leserinnen. Darüberhinaus war sie ein wichtiger Bestandteil der texanischen SF- und Fantasy-Community und wurde von ihren Kollegen und Kolleginnen in der SFWA als Author Emeritus geehrt. Und die Einleitung zu ihrer 1994 erschienenen ersten Kurzgeschichtensammlung Mean Little Old Lady at Work: The Selected Works of Ardath Mayhar (1994) hat kein Geringerer als ihr berühmter texanischer Kollege Joe R. Lansdale verfasst.
Auf Deutsch sind von Ardath Mayhar nur drei Romane erschienen; der Battletech-Roman Das Schwert und der Dolch (1990; OT: The Sword and the Dagger (1987)) zeigt dabei deutlich, dass Military SF nicht unbedingt zu ihren Stärken zu zählen ist (aber den Roman hat sie auch nur geschrieben, weil Margaret Weis & Tracy Hickman plötzlich einen lukrativeren Auftrag in der Tasche hatten und man bei FASA jemanden brauchte, der schnell einspringen konnte). Bei Der Windtänzer (1998; OT: People of the Mesa (1992)) und Der Traumhüter (2001; OT: Island in the Lake (1993)) handelt es sich um die ersten beiden Romane einer im Original Lost Tribes übertitelten vierbändigen Sequenz, in deren Mittelpunkt prähistorische Indianerstämme stehen. Hinzu kommen eine Handvoll Kurzgeschichten, darunter auch die bereits erwähnte um Grittel Sundotha, die als “Der Widerspenstigen Rache” in der Anthologie Neue Amazonen-Geschichten (1983) enthalten ist.
Bibliotheka Phantastika erinnert an Russell Hoban, der heute 90 Jahre alt geworden wäre. Im Rahmen dieser Reihe schauen wir ja immer mal wieder über den Tellerrand hinaus, und auch wenn sich in mehreren Romanen und Erzählungen des am 04. Februar 1925 in Lansdale, Pennsylvania, geborenen Russell Conwell Hoban phantastische Elemente und Motive finden lassen, sind seine Werke eher außerhalb der engeren Genregrenzen angesiedelt. Seine ersten schriftstellerischen Gehversuche machte Hoban – nachdem er zuvor u.a. als Illustrator und Werbetexter gearbeitet hatte – Ende der 50er Jahre mit Kinderbüchern, denen er über zehn Jahre lang treu bleiben sollte. In dieser Zeit verfasste er beispielsweise eine Reihe um das Dachsmädchen Francis (Fränzi in der deutschen Ausgabe), die von seiner damaligen Frau Lillian illustriert wurde. Parallel dazu schrieb er seinen ersten längeren Roman The Mouse and His Child, bei dem es sich zwar ebenfalls um ein Kinderbuch handelt – und zwar um eines, das im englischen Sprachraum als Klassiker gilt –, der aber eigentlich viel mehr als ein Kinderbuch ist.
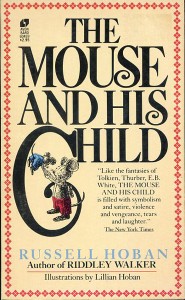 The Mouse and His Child (1967; dt. Der Mausevater und sein Sohn (1979)) sind zwei Spielzeugmäuse, die sich an den Händen halten; wenn der Vater mittels des Schlüssels auf seinem Rücken aufgezogen wird, tanzt er im Kreis und schwingt dabei seinen Sohn durch die Luft. Kurz vor Weihnachten erwachen die beiden in einem Spielzeugladen – wo sie sich sehr wohlfühlen – zum Leben, finden sich bald darauf unter dem Weihnachtsbaum einer Familie wieder, verbringen das Jahr in einer dunklen Schachtel und werden zu Weihnachten wieder hervorgeholt. Das Ganze wiederholt sich mehrere Jahre – bis etwas passiert und die beiden Mäuse in der Mülltonne landen. Doch damit beginnt ihre Odyssee erst, in deren Verlauf sie auf die unterschiedlichsten Wesen treffen, allerhand Abenteuer erleben und ihnen Gutes und Böses widerfährt – Ersteres beispielsweise in Gestalt eines Landstreichers, der sie in der Mülltonne findet und notdürftig repariert (so dass sie nicht mehr im Kreis tanzen, sondern gehen können), den Mäusevater aufzieht und die beiden mit dem Rat “Seid Landstreicher” sich selbst überlässt, während für Letzteres vor allem Manny Rat (aka Manny Ratz), der König der Müllhalde, steht. Doch am schlimmsten für die beiden Mäuse ist, dass sie immer darauf angewiesen sind, dass jemand sie aufzieht … Es ist schwer, die Magie dieses in jeder Hinsicht zauberhaften Buches – in dem es auf für ein Kinderbuch erstaunliche Weise ganz schön zur Sache geht, in dem gelitten und gestorben wird – in Worte zu fassen, ohne zu viel zu verraten. Auf alle Fälle ist The Mouse and His Child wie alle guten Kinderbücher eines, das man auch als Erwachsener mit Genuss lesen kann und – von vielleicht einer Ausnahme abgesehen – Hobans zugänglichster Roman (der außerdem 1977 unter dem gleichen Titel als Zeichentrickfilm umgesetzt wurde).
The Mouse and His Child (1967; dt. Der Mausevater und sein Sohn (1979)) sind zwei Spielzeugmäuse, die sich an den Händen halten; wenn der Vater mittels des Schlüssels auf seinem Rücken aufgezogen wird, tanzt er im Kreis und schwingt dabei seinen Sohn durch die Luft. Kurz vor Weihnachten erwachen die beiden in einem Spielzeugladen – wo sie sich sehr wohlfühlen – zum Leben, finden sich bald darauf unter dem Weihnachtsbaum einer Familie wieder, verbringen das Jahr in einer dunklen Schachtel und werden zu Weihnachten wieder hervorgeholt. Das Ganze wiederholt sich mehrere Jahre – bis etwas passiert und die beiden Mäuse in der Mülltonne landen. Doch damit beginnt ihre Odyssee erst, in deren Verlauf sie auf die unterschiedlichsten Wesen treffen, allerhand Abenteuer erleben und ihnen Gutes und Böses widerfährt – Ersteres beispielsweise in Gestalt eines Landstreichers, der sie in der Mülltonne findet und notdürftig repariert (so dass sie nicht mehr im Kreis tanzen, sondern gehen können), den Mäusevater aufzieht und die beiden mit dem Rat “Seid Landstreicher” sich selbst überlässt, während für Letzteres vor allem Manny Rat (aka Manny Ratz), der König der Müllhalde, steht. Doch am schlimmsten für die beiden Mäuse ist, dass sie immer darauf angewiesen sind, dass jemand sie aufzieht … Es ist schwer, die Magie dieses in jeder Hinsicht zauberhaften Buches – in dem es auf für ein Kinderbuch erstaunliche Weise ganz schön zur Sache geht, in dem gelitten und gestorben wird – in Worte zu fassen, ohne zu viel zu verraten. Auf alle Fälle ist The Mouse and His Child wie alle guten Kinderbücher eines, das man auch als Erwachsener mit Genuss lesen kann und – von vielleicht einer Ausnahme abgesehen – Hobans zugänglichster Roman (der außerdem 1977 unter dem gleichen Titel als Zeichentrickfilm umgesetzt wurde).
Interessanterweise geht es auch in The Lion of Boaz-Jachin and Jachin-Boaz (1973; dt. Der Kartenmacher (1987)), Hobans erstem Roman für Erwachsene, um einen Vater und seinen Sohn. Jachin-Boaz ist ein Kartenmacher, der seit vielen Jahren in seiner Freizeit heimlich an einer “Meisterkarte” arbeitet, die er als wichtigstes Vermächtnis für seinen Sohn betrachtet und die diesem zeigen soll, wo alles, wonach auch immer er vielleicht zu suchen begehrt, zu finden sein wird. Doch als Boaz-Jachin die Karte zu seinem sechzehnten Geburtstag erstmals präsentiert wird, ist er von ihr bedauerlicherweise nicht sonderlich beeindruckt. Schließlich könne er mit ihrer Hilfe z.B. keinen Löwen finden (weil Löwen zum Zeitpunkt der Handlung längst ausgestorben und fast schon mythische Tiere 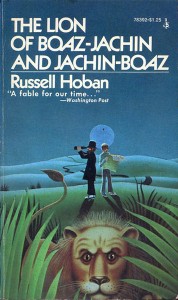 sind). Boaz-Jachins Reaktion hat Folgen, denn schon bald begibt Jachin-Boaz auf eine Reise, um einen Löwen zu finden (und stürzt unterwegs mehrfach in eine existenzielle Krise); Boaz-Jachin wiederum macht sich auf die Suche nach seinem Vater – nachdem er zuvor noch den Geist eines in Stein gehauenen Löwen befreit hat … Die phantastischen Elemente in The Lion of Boaz-Jachin and Jachin-Boaz wirken ziemlich surrealistisch, und der Roman hat vermutlich autobiografische Bezüge, doch davon abgesehen geht es nicht zuletzt um Väter und Söhne und deren Unfähigkeit, wirklich miteinander zu sprechen bzw. sich zu verstehen.
sind). Boaz-Jachins Reaktion hat Folgen, denn schon bald begibt Jachin-Boaz auf eine Reise, um einen Löwen zu finden (und stürzt unterwegs mehrfach in eine existenzielle Krise); Boaz-Jachin wiederum macht sich auf die Suche nach seinem Vater – nachdem er zuvor noch den Geist eines in Stein gehauenen Löwen befreit hat … Die phantastischen Elemente in The Lion of Boaz-Jachin and Jachin-Boaz wirken ziemlich surrealistisch, und der Roman hat vermutlich autobiografische Bezüge, doch davon abgesehen geht es nicht zuletzt um Väter und Söhne und deren Unfähigkeit, wirklich miteinander zu sprechen bzw. sich zu verstehen.
Reichlich surrealistisch geht es auch in Kleinzeit (1974; dt. Kleinzeit (1989)) zu, Hobans zweitem Roman für Erwachsene (der gleichzeitig der erste mit einem deutschen Titel bzw. einer Hauptfigur mit einem deutschen Namen ist), denn dessen Titelheld Kleinzeit ist – nur mit einem Glockenspiel und einer Ausgabe von Thukydides’ Der Peloponnesische Krieg bewaffnet – auf der Suche nach der Realität. Dummerweise schickt ihn sein Arzt aufgrund gewisser Beschwerden ins Krankenhaus … und in diesem Krankenhaus ist die Sache mit der Realität so richtig kompliziert und undurchschaubar.
Auch wenn Russell Hobans nächster Roman Turtle Diary (1975; dt. Ozeanische Gefühle (1985)) gänzlich ohne phantastische Elemente auskommt, lohnt sich ein Blick, denn er ist sein neben dem Mausevater wohl zugänglichster und außerdem ein – vor allem verglichen mit der einen oder anderen düsteren Vision, die später folgen sollte – unglaublich lebensbejahender Roman. Erzählt wird er in Form von Tagebucheinträgen von seinen beiden Hauptfiguren, als da wären: die melancholische dreiundvierzigjährige unverheiratete (und darüber alles andere als glückliche) Kinderbuchautorin Neara H., sowie der introvertierte fünfundvierzigjährige geschiedene Buchhändler William G., der vor allem darunter leidet, dass er seine Töchter nicht mehr sieht. Beide stehen unabhängig voneinander immer wieder im Londoner Zoo vor einem Aquarium, in dem drei Meeresschildkröten unablässig im Kreis schwimmen. Ebenso unabhängig voneinander kommen sie auf die Idee, die Schildkröten aus ihrem ihnen längst zu klein gewordenen Gefängnis zu befreien und ans Meer zu bringen – und nachdem sie sich kennengelernt haben, machen sie sich daran, ihre Idee in die Tat umzusetzen … In dem unter dem gleichen Titel mit Ben Kingsley und Glenda Jackson 1985 verfilmten Roman geht es auf sehr unsentimentale Weise um Einsamkeit und (manchmal selbstgebaute) Gefängnisse – und darum, dass es immer eine Möglichkeit gibt, aus diesen Gefängnissen auszubrechen, auch wenn es dazu manchmal der Hilfe von außen bedarf.
Mit Riddley Walker (1980) legte Hoban fünf Jahre später so etwas wie den ultimativen Post-Doomsday-Roman vor, und dieser Sprung sozusagen mitten ins Genre wurde folgerichtig mit dem John W. Campbell Memorial Award und dem Ditmar Award (das ist das australische 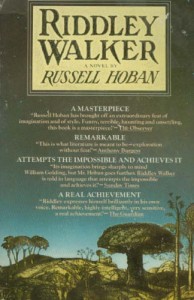 Pendant des Hugo) ausgezeichnet. Der anfangs zwölfjährige Titelheld lebt vielleicht 2000 Jahre nach einem verheerenden Atomkrieg in einer Stammesgesellschaft in Südengland, die sich vor allem mit Hundemeuten – den schlimmsten Feinden der Menschen – herumschlagen muss. Von der glorreichen Vergangenheit sind nur noch ein paar Relikte sowie Mythen und Legenden übriggeblieben, doch diese Legenden werden ebenso wie die alltäglichen Dinge in einer Sprache erzählt, die sich so vielleicht tatsächlich in 2000 Jahren aus dem uns bekannten Englischen entwickeln könnte. So originell es einerseits ist, endlich einmal eine auch auf der sprachlichen Ebene konsequent weitergedachte Vision einer postapokalyptischen Gesellschaft vorzufinden, so schwer macht es diese Sprache für Nicht-Native-Speaker, Riddley Walkers Abenteuern zu folgen. Wer allerdings eine echte Herausforderung sucht …
Pendant des Hugo) ausgezeichnet. Der anfangs zwölfjährige Titelheld lebt vielleicht 2000 Jahre nach einem verheerenden Atomkrieg in einer Stammesgesellschaft in Südengland, die sich vor allem mit Hundemeuten – den schlimmsten Feinden der Menschen – herumschlagen muss. Von der glorreichen Vergangenheit sind nur noch ein paar Relikte sowie Mythen und Legenden übriggeblieben, doch diese Legenden werden ebenso wie die alltäglichen Dinge in einer Sprache erzählt, die sich so vielleicht tatsächlich in 2000 Jahren aus dem uns bekannten Englischen entwickeln könnte. So originell es einerseits ist, endlich einmal eine auch auf der sprachlichen Ebene konsequent weitergedachte Vision einer postapokalyptischen Gesellschaft vorzufinden, so schwer macht es diese Sprache für Nicht-Native-Speaker, Riddley Walkers Abenteuern zu folgen. Wer allerdings eine echte Herausforderung sucht …
Pilgermann (1983) erzählt die Geschichte eines gleichnamigen deutschen Juden, der im 11. Jahrhundert kurz nach einem Stelldichein mit der Frau eines Steuereintreibers von einem Juden hassenden Mob brutal kastriert wird, und der sich daraufhin auf eine Pilgerreise nach Jerusalem begibt, begleitet von so illustren Gefährten wie dem scharfzüngigen Bruder Pförtner – einer Art Avatar des Todes –, dem kopflosen Leichnam des Steuereintreibers, mit dessen Frau Pilgermann sich vergnügt hatte, und der Sau, die seine Genitalien gefressen hat.
In The Medusa Frequency (1987; dt. Die Medusenfrequenz (1991)) geht es um den Comic-Texter und Schriftsteller Herman Orff, der nach Inspiration für seinen dritten Roman sucht, und auf dessen PC-Monitor plötzlich grünlich phosphoreszierende Buchstaben in Blockschrift auftauchen, mittels derer eine ebenso entsetzliche wie unschuldige Entität mit ihm Kontakt aufnehmen will. So richtig durcheinander gerät Orff allerdings erst, als ihm an den unmöglichsten Orten Orpheus’ Kopf erscheint und ihm immer wieder die Geschichte erzählt, wie er Eurydike für immer verloren hat.
Während Herman Orff ein Sucher war, ist Fremder Gorn, die Hauptfigur von Fremder (1996), ein Mensch mit Geheimnissen. Schließlich hat er nicht nur einige Zeit im All ohne Raumanzug überlebt, sondern ist auch das einzige wieder aufgetauchte Besatzungsmitglied der Clever Daughter, eines spurlos verschwundenen Raumfrachters. Fremders Mutter hat den “Flicker Drive” entwickelt, der der Menschheit die interstellare Raumfahrt ermöglicht – und sich umgebracht, als sie im siebten Monat mit Fremder schwanger war (nicht, ohne Anweisungen an das Krankenhaus und eine Botschaft an ihren ungeborenen Sohn zu hinterlassen). Dieses und weitere Bruchstücke aus Fremders Vergangenheit erfahren wir, während Fremder selbst gleichzeitig von Psychologen durchleuchtet wird – und schließlich in die Obhut des Supercomputers Pythia gegeben wird.
Zwar gibt es auch in den späteren Romanen Hobans noch phantastische Elemente – etwa in Amaryllis Night and Day (2001; dt. Amaryllis Tag und Traum (2007)) – doch für heute soll dies einmal genügen. Russell Hoban, der am 13. Dezember 2011 im Alter von 86 Jahren verstorben ist und im englischen Sprachraum als Kultautor gilt, hat ein teilweise eingängiges, teilweise nur schwer verständliches (und gelegentlich auch anstrengend zu lesendes) Œuvre mit einer beeindruckenden Bandbreite hinterlassen. Wer “schräge” Ideen und Geschichten sucht, wird bei ihm ebenso fündig wie diejenigen, die am liebsten Bücher lesen, bei denen man die Wärme spürt, mit der der Autor auf seine Figuren blickt – auch wenn er ihnen so manches zumutet.
Bibliotheka Phantastika gratuliert Gilles Servat, der heute 70 Jahre alt wird. Der am 01. Februar 1945 im südfranzösischen Tarbes im Département Hautes-Pyrénées in eine Familie mit bretonischen Wurzeln hineingeborene Sänger, Musiker, Songwriter, Schauspieler, Dichter und Schriftsteller Gilles Servat ist in Nantes und Cholet aufgewachsen und hat in Angers Malerei, Grafik 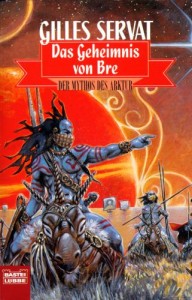 und Skulptur (aka Bildhauerkunst) studiert. Während eines Aufenthalts auf der Île de Groix kam er mit bretonischer Dichtkunst in Berührung und begann bald darauf – u.a inspiriert durch Musiker wie Alan Stivell – sich intensiv mit der Sprache und Kultur seiner Vorfahren auseinanderzusetzen und Lieder in bretonischer Sprache zu komponieren und vorzutragen. 1971 erschien mit La Blanche Hermine das erste von mittlerweile 25 Solo-Alben, außerdem hat Servat an etlichen Alben befreundeter Musiker mitgewirkt und war jahrelang mit seinen Songs – die er in Bretonisch, aber auch in Englisch, Französisch und anderen keltischen Sprachen vorträgt – auf Tournee.
und Skulptur (aka Bildhauerkunst) studiert. Während eines Aufenthalts auf der Île de Groix kam er mit bretonischer Dichtkunst in Berührung und begann bald darauf – u.a inspiriert durch Musiker wie Alan Stivell – sich intensiv mit der Sprache und Kultur seiner Vorfahren auseinanderzusetzen und Lieder in bretonischer Sprache zu komponieren und vorzutragen. 1971 erschien mit La Blanche Hermine das erste von mittlerweile 25 Solo-Alben, außerdem hat Servat an etlichen Alben befreundeter Musiker mitgewirkt und war jahrelang mit seinen Songs – die er in Bretonisch, aber auch in Englisch, Französisch und anderen keltischen Sprachen vorträgt – auf Tournee.
Darüberhinaus engagierte und engagiert Gilles Servat sich hinsichtlich der Beibehaltung und Pflege der bretonischen Kultur und Sprache und hat – denn es muss ja einen Grund geben, warum er hier auftaucht – einen Artus-Zyklus der etwas anderen Art geschaffen, der sich auf bretonische und andere keltische Mythen bezieht.
Ein erster Versuch in dieser Richtung ist 1986 unter dem Titel La Naissance d’Arcturus erschienen, doch erst als der Roman 1995 – dieses Mal als Skinn Mac Dana und Auftakt des Zyklus Les Chroniques d’Arcturus – erneut veröffentlicht wurde, scheint sich der erhoffte Erfolg eingestellt zu haben, denn schon ein Jahr später kam mit La Navigation de Myrdhinn der zweite Band heraus, dem alsbald weitere folgten. Skinn Mac Dana erzählt die Geschichte des gleichnamigen Titelhelden, der auf dem kleinen, unbedeutenden Planeten Bre notlanden muss und dort – da sein Raumschiff explodiert – strandet. Doch Skinn, der in seiner Heimat der Nuada (ein Anführer der Krieger) war, lässt sich davon nicht unterkriegen, und er macht auch mit dem Monster, das kurz nach der Landung auf ihn losgeht, kurzen Prozess. Diese Tat macht einen enormen Eindruck auf die (menschlichen – oder genauer: keltischen) Einwohner Bres, und sie bringen ihn zu ihrem König, wo er alsbald der Beschützer von dessen Tochter wird – und sich natürlich in sie verliebt. Als die beiden zusammen weglaufen – da Prinzessin Lirne bereits einem anderen König versprochen ist, den sie keineswegs zu heiraten gedenkt –, ist mehr oder weniger absehbar, wie sich die Dinge entwickeln werden. Das tun sie auch, aber letztlich doch ein bisschen anders als gedacht …
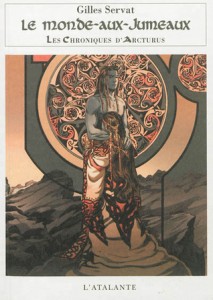 Was Gilles Servats mit den Bänden La Navigation de Myrdhinn (1996), Arcturus (1997), Les Ssahanis (2000), Le Dixième Jour du Branvode (2003), La Lance de Lughern (2007) und Le Monde-aux-Jumeaux (2013) fortgesetzte Chroniques d’Arcturus so interessant und ziemlich einzigartig macht, ist die spielerische Leichtigkeit, mit der in ihnen Fantasy- und SF-Elemente mit Motiven aus – vor allem, aber nicht nur – keltischen Mythen verknüpft werden, und wie gleichermaßen fremd und vertraut viele Namen und Geschehnisse wirken. Dies gilt sowohl für Skinn, den Nuada, der aus gewissen Gründen den Beinamen Silberhand bekommt, als auch für Myrdhinn, von dem im ersten Band häufig die Rede ist und der im Mittelpunkt von Band zwei und drei steht, und natürlich für Arktur, den Sohn von Skinn und Lirne, der ab Band drei immer wichtiger wird. Hinzu kommt, dass sich Servats Romane (zumindest in der Übersetzung) spürbar anders lesen als der größte Teil der aus dem Englischen übersetzten Fantasy, da ihr Erzählduktus ein anderer ist (wobei dennoch gewisse Ähnlichkeiten zu Romanen und Erzählungen aus den Subgenres Sword & Sorcery bzw. Sword & Planet existieren).
Was Gilles Servats mit den Bänden La Navigation de Myrdhinn (1996), Arcturus (1997), Les Ssahanis (2000), Le Dixième Jour du Branvode (2003), La Lance de Lughern (2007) und Le Monde-aux-Jumeaux (2013) fortgesetzte Chroniques d’Arcturus so interessant und ziemlich einzigartig macht, ist die spielerische Leichtigkeit, mit der in ihnen Fantasy- und SF-Elemente mit Motiven aus – vor allem, aber nicht nur – keltischen Mythen verknüpft werden, und wie gleichermaßen fremd und vertraut viele Namen und Geschehnisse wirken. Dies gilt sowohl für Skinn, den Nuada, der aus gewissen Gründen den Beinamen Silberhand bekommt, als auch für Myrdhinn, von dem im ersten Band häufig die Rede ist und der im Mittelpunkt von Band zwei und drei steht, und natürlich für Arktur, den Sohn von Skinn und Lirne, der ab Band drei immer wichtiger wird. Hinzu kommt, dass sich Servats Romane (zumindest in der Übersetzung) spürbar anders lesen als der größte Teil der aus dem Englischen übersetzten Fantasy, da ihr Erzählduktus ein anderer ist (wobei dennoch gewisse Ähnlichkeiten zu Romanen und Erzählungen aus den Subgenres Sword & Sorcery bzw. Sword & Planet existieren).
Wie bereits erwähnt, wurden Les Chroniques d’Arcturus auch ins Deutsche übersetzt. Das gilt zumindest für die ersten vier Bände, die unter dem Obertitel Der Mythos des Arktur als Das Geheimnis von Bre, Myrdhinns Reise, Das Vermächtnis des Nuada (alle 2000) und Die Waffen der Götter (2001) hierzulande erschienen sind. Woran die Fortführung der Reihe gescheitert ist – ob an mangelndem Verkaufserfolg oder der Tatsache, dass die Bände fünf bis sieben im Original in deutlich größeren Abständen als die ersten vier auf den Markt kamen –, lässt sich nur schwer sagen; vermutlich dürfte beides eine Rolle gespielt haben.
Bibliotheka Phantastika gratuliert Judith Tarr, die heute 60 Jahre alt wird. Dass sich etliche der mehr als vierzig Romane, die die am 30. Januar 1955 in Augusta, Maine, geborene Judith Tarr von 1985 bis 2010 in steter Regelmäßigkeit veröffentlicht hat, eines historischen Settings bedienen, ist nicht sonderlich überraschend – schließlich hat sie u.a. Alte und Mittelalterliche Geschichte studiert, ehe sie zu schreiben begann. Bei einigen dieser Romane handelt es sich um “echte” historische Romane, die keine oder nur wenig phantastische Elemente beinhalten, während andere auf Alternativwelten spielen, in denen Magie bekannt ist und eine wichtige Rolle spielt. Zur letztgenannten Kategorie zählt beispielsweise Tarrs Erstling The Isle of Glass (1985), der Auftaktband der Trilogie The Hound and the Falcon.
Im Mittelpunkt von The Isle of Glass steht der junge Möch Alf bzw. Alfred, der im Kloster St. Ruan lebt und dort Novizen unterrichtet. Allerdings ist Alf nicht so jung, wie er aussieht, denn er wurde vor mehr als 70 Jahren vor der Pforte des Klosters als Säugling gefunden. Und er altert nicht nur wesentlich langsamer als ein Mensch, sondern ist auch auf eine ätherische Weise schön – und er hat Heilfähigkeiten, die mit den Lehren Gottes nicht in Einklang zu bringen sind. Denn Alf ist – das wird schnell klar – ein Elf, ein Geschöpf aus dem magischen Königreich Rhiyana; Alf ist aber auch ein überzeugter, gläubiger Christ, was ihn in einen tiefen inneren Zwiespalt stürzt, denn gemäß der herrschenden christlichen Doktrin besitzen Elfen keine Seele. Trotz seiner ungelösten inneren Konflikte begibt sich Alf auf Wunsch seines Abts auf eine Reise zu Richard Löwenherz, dem König von Anglia, um ihm eine wichtige Botschaft zu überbringen. Doch die Welt jenseits der Klostermauern ist gefährlich, denn dort lauern die Hunde Gottes, eine fanatische christliche Sekte, die sich geschworen hat, alle heidnischen Elfen zu töten …
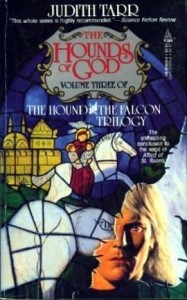 So originell die Grundidee (die mehrfach zum Gegenstand theologischer Diskussionen und Erwägungen wird) auch sein mag, so fremd – um nicht zu sagen anachronistisch – dürfte der unglaublich edle, gutherzige und schöne Alf auf die heutige Fantasylesergeneration wirken. Falls man mit einer derart idealisierten Hauptfigur – und einer alles andere als unwichtigen Liebesgeschichte (das geht, denn Alf hat sein Mönchsgelübde aufgelöst) – klarkommt, kann man durchaus Spaß am überzeugend ausgearbeiteten Setting und Alfs weiteren Abenteuern haben, die ihn in den Folgebänden The Golden Horn (1985) und The Hounds of God (1986) u.a. nach Konstantinopel und Rom – und natürlich auch in seine eigentliche Heimat, das Königreich Rhiyana – führen.
So originell die Grundidee (die mehrfach zum Gegenstand theologischer Diskussionen und Erwägungen wird) auch sein mag, so fremd – um nicht zu sagen anachronistisch – dürfte der unglaublich edle, gutherzige und schöne Alf auf die heutige Fantasylesergeneration wirken. Falls man mit einer derart idealisierten Hauptfigur – und einer alles andere als unwichtigen Liebesgeschichte (das geht, denn Alf hat sein Mönchsgelübde aufgelöst) – klarkommt, kann man durchaus Spaß am überzeugend ausgearbeiteten Setting und Alfs weiteren Abenteuern haben, die ihn in den Folgebänden The Golden Horn (1985) und The Hounds of God (1986) u.a. nach Konstantinopel und Rom – und natürlich auch in seine eigentliche Heimat, das Königreich Rhiyana – führen.
The Hound and the Falcon ist auch auf Deutsch erschienen – sogar zwei Mal. Das erste Mal in den 80ern (unter dem Obertitel Die Jäger der Inquisition als Die gläserne Insel (1986), Das goldene Horn und Die Hunde Gottes (beide 1987)) und dann noch einmal in den Nullerjahren (unter dem Obertitel Die Geheimnisse von Rhiyana; in diesem Fall hieß der dritte Band Die heilige Stadt (2003)). Ein paar Jahre später ist Judith Tarr mit Alamut (1989; dt. Die Zauberin von Alamut (1991)) und The Dagger and the Cross (1991) noch einmal ins Setting von The Hound and the Falcon zurückgekehrt, dieses Mal jedoch ins Königreich Jerusalem während der Herrschaft von Balduin IV. Hier bekommt es der halbmenschliche Prinz und Kreuzritter Aidan vor allem mit der Assassine Morgiana zu tun, die genau wie er weit mehr ist, als sie zu sein scheint.
Bei dem anfangs aus den Romanen The Hall of the Mountain King (1986), The Lady of Han-Gilen (1987) und A Fall of Princes (1988) bestehenden und später mit Arrows of the Sun (1993), Spear of Heaven (1994) und Tides of Darkness (2002) erweiterten Zyklus Avaryan Rising (dessen erste drei Bände es als Der König von Han-Ianon, Elians Schwur und Der Krieg der Prinzen (alle 1990) unter dem Obertitel Der Sohn der Sonne auch nach Deutschland geschafft haben) handelt es sich um Judith Tarrs ersten Ausflug in die “richtige” bzw. Sekundärwelt-Fantasy, in dem es um dynastische Intrigen und Verwicklungen zwischen bzw. in benachbarten Reichen geht. Doch viel wichtiger als die politischen Machtkämpfe und kriegerischen Auseinandersetzungen sind die Liebesbeziehungen der Hauptfiguren – eine Tendenz, die sich auch in ihren späteren Romanen fortgesetzt hat.
Die Epona-Sequenz (White Mare’s Daughter (1998), The Shepherd Kings (1999), Lady of Horses (2000), Daughter of Lir (2001)), von der ebenfalls drei Bände als Zeit des Feuers (1999), Zeit der Pharaonen und Zeit der Götter (beide 2002) auf Deutsch erschienen sind, spielt größtenteils in vor- bzw. frühgeschichtlicher Zeit und thematisiert u.a. den Zusammenprall matriarchalischer und patriarchalischer Kulturen. Sie verdankt ihren Namen der Göttin Epona, die sich in einer weißen Stute inkarniert. Pferde spielen in Judith Tarrs späterem Werk öfters eine wichtige Rolle, und in der White Magic Trilogy (2004-06), die sie als Caitlin Brennan geschrieben hat, spielen sie sogar die Hauptrolle (was letztlich bei einer Autorin, die nebenbei Lippizaner züchtet, auch wieder nicht so überraschend ist).
Von ihren Einzelromanen, die anfangs – A Wind in Cairo, Ars Magica (beide 1989) – eher der Fantasy, danach eher dem historischen Roman zuneigen, hat es nur Lord of the Two Lands (1993) – ein in Ägypten spielender Alexander-Roman – als Der Herr der zwei Länder (1996) nach Deutschland geschafft. Recht interessant klingen die beiden Amazonen-Romane Queen of the Amazons (2004) und Bring Down the Sun (2008).
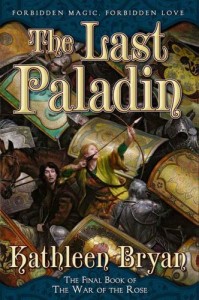 Mit der unter dem Pseudonym Kathleen Bryan verfassten Trilogie The War of the Rose hat Judith Tarr sich – wie der deutsche Obertitel Das magische Land deutlicher verrät – noch einmal der Sekundärwelt-Fantasy angenommen. Allerdings ist die aus den Bänden The Serpent and the Rose (2007), The Golden Rose (2008) und The Last Paladin (2009) bzw. Der Orden der Rose, Das Amulett der Schlange und Die Tochter des Lichts (alle 2008) bestehende Trilogie arg generisch ausgefallen, komplett mit dem einfachen, aber über eine besondere Begabung verfügenden Bauernjungen und der unglaublich schönen, aber natürlich zugleich überaus freundlichen und bescheidenen Fürstentochter.
Mit der unter dem Pseudonym Kathleen Bryan verfassten Trilogie The War of the Rose hat Judith Tarr sich – wie der deutsche Obertitel Das magische Land deutlicher verrät – noch einmal der Sekundärwelt-Fantasy angenommen. Allerdings ist die aus den Bänden The Serpent and the Rose (2007), The Golden Rose (2008) und The Last Paladin (2009) bzw. Der Orden der Rose, Das Amulett der Schlange und Die Tochter des Lichts (alle 2008) bestehende Trilogie arg generisch ausgefallen, komplett mit dem einfachen, aber über eine besondere Begabung verfügenden Bauernjungen und der unglaublich schönen, aber natürlich zugleich überaus freundlichen und bescheidenen Fürstentochter.
Nach einer 25 Jahre dauernden und wie bereits erwähnt mehr als 40 Romane umfassenden Karriere hat Judith Tarr etwa ab 2010 anscheinend unter einer Schreibblockade gelitten, die sie mit der Veröffentlichung des Jugendbuchs Living in Threes (2014) aber – wie’s aussieht – überwunden hat.