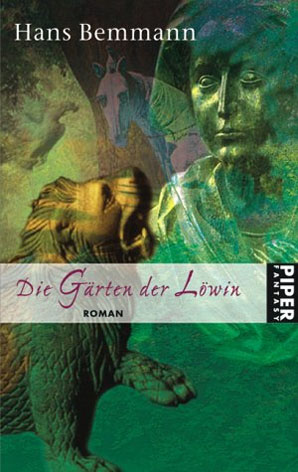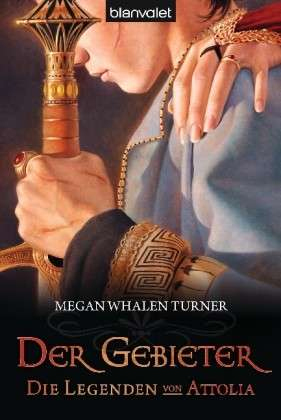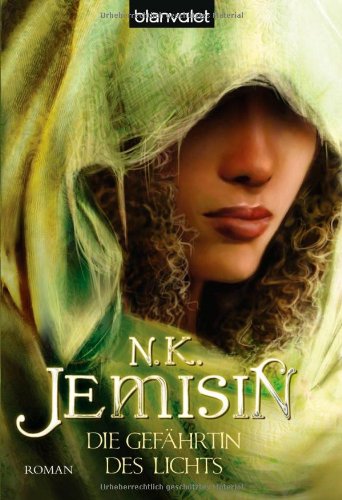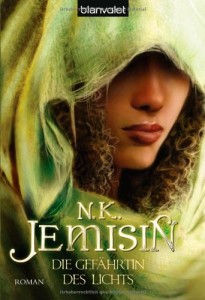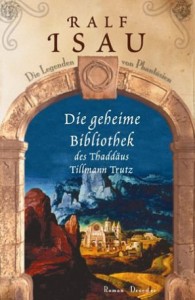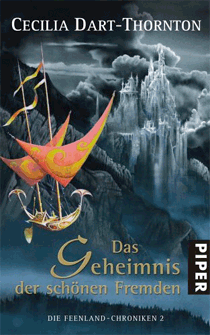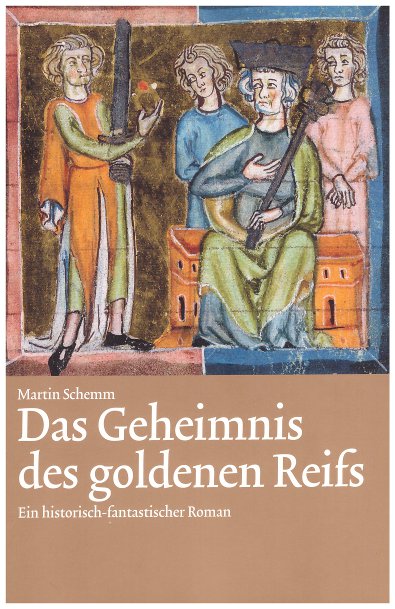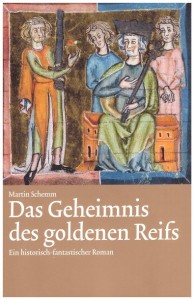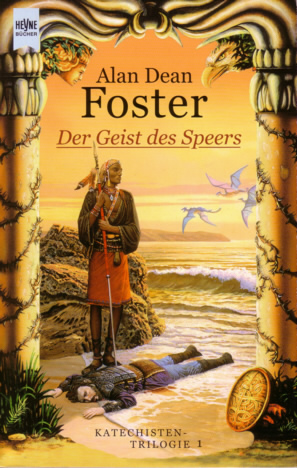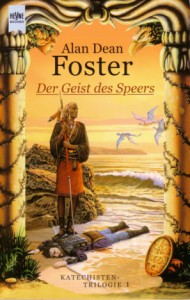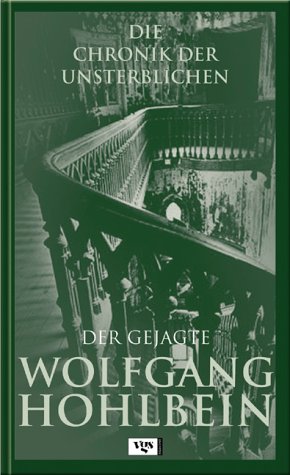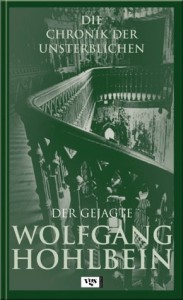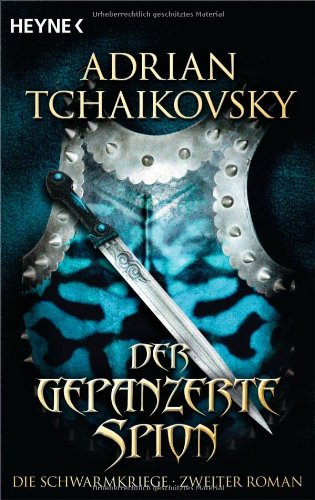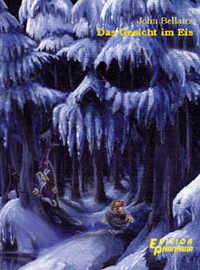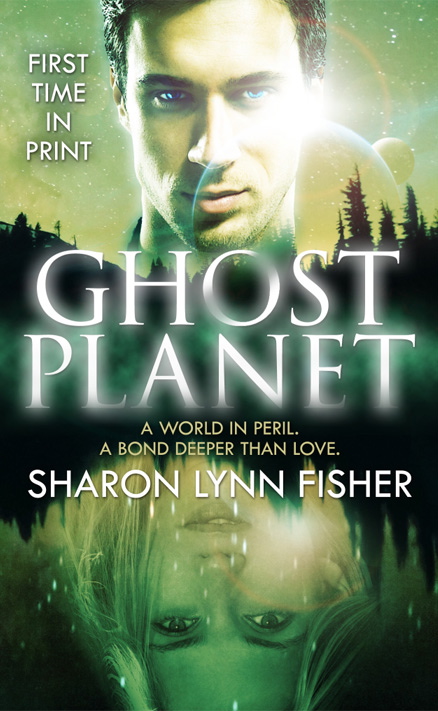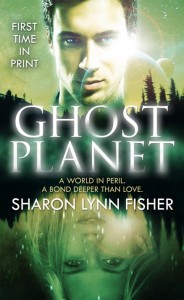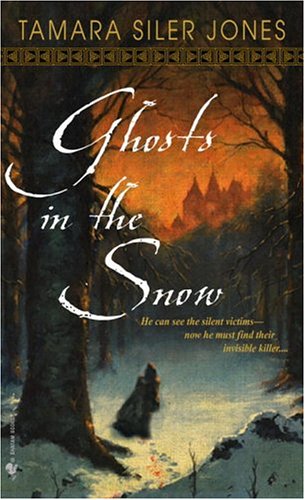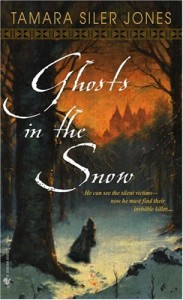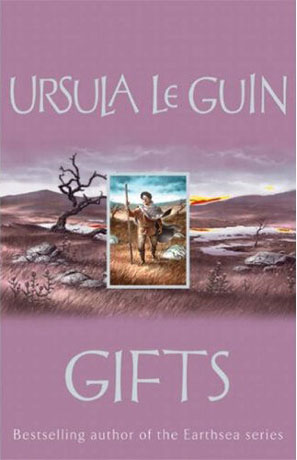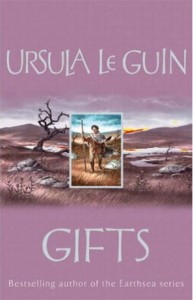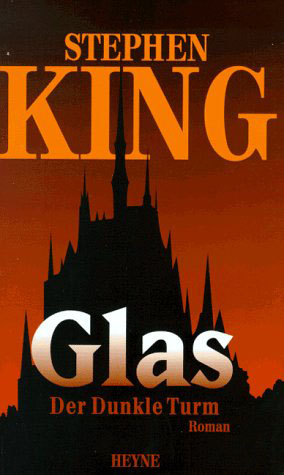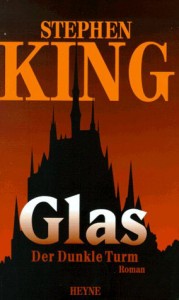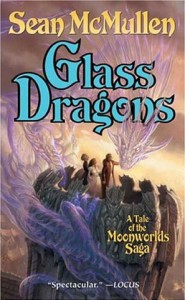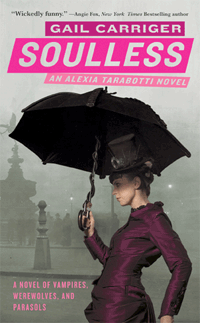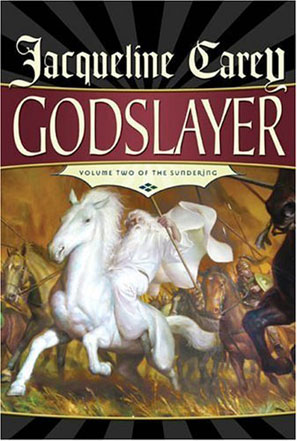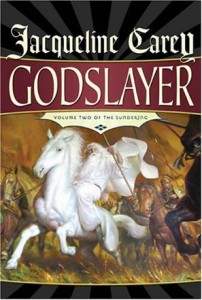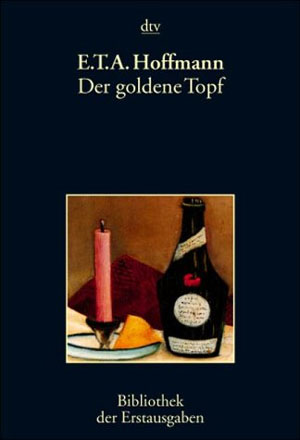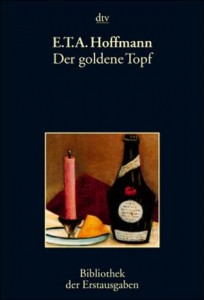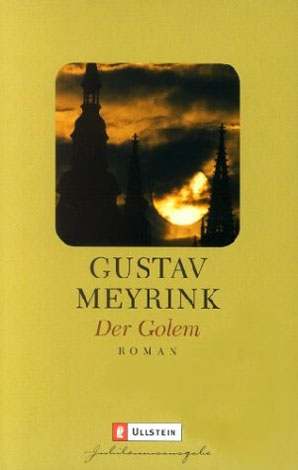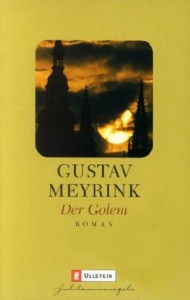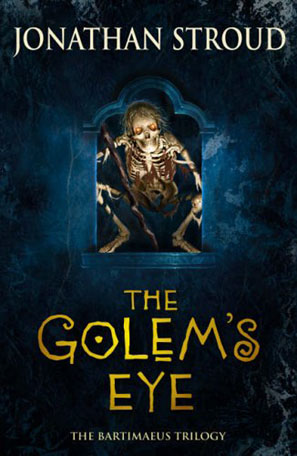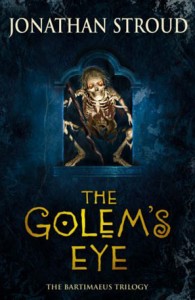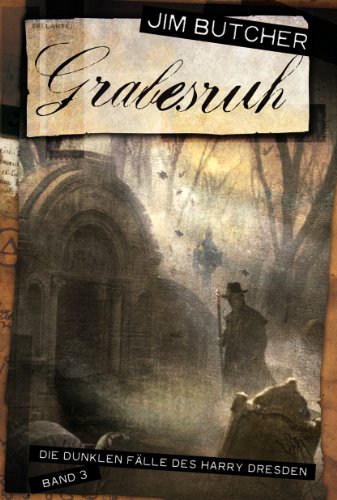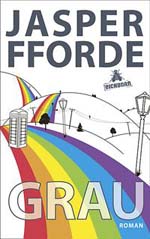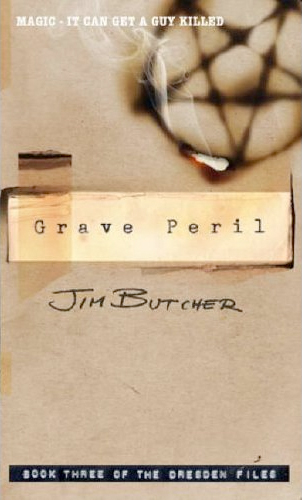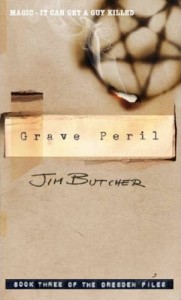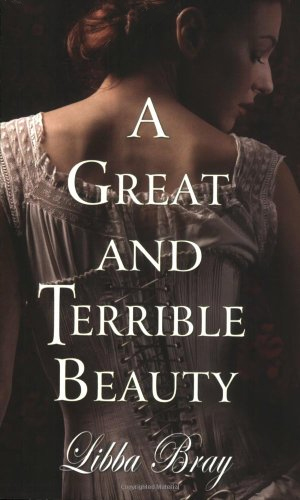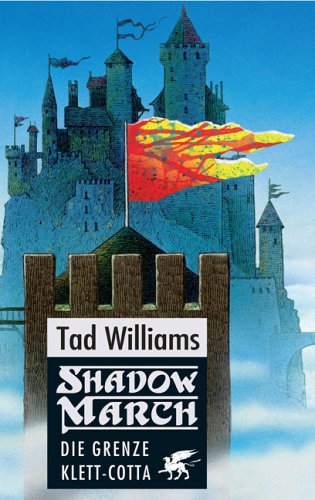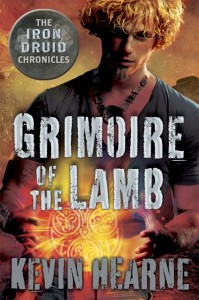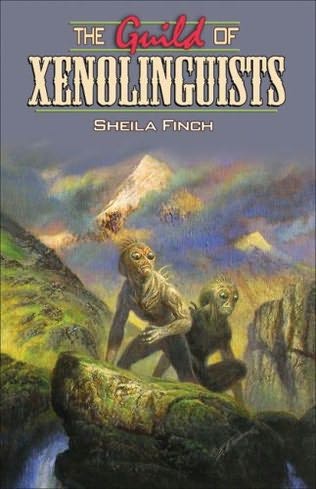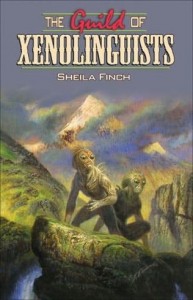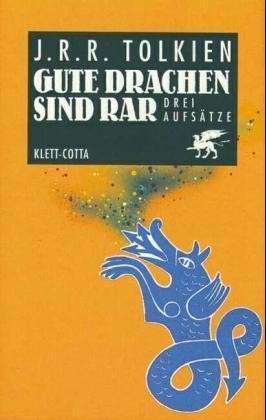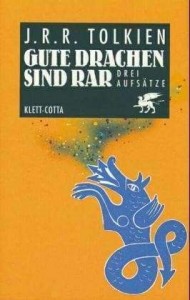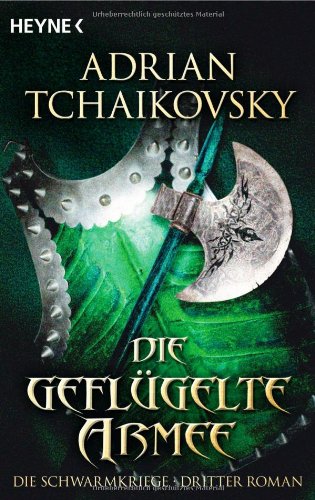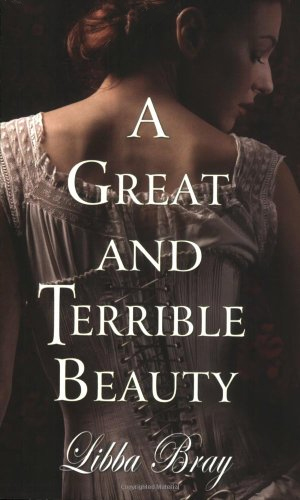 1895 – Gemma Doyle, ein launischer und verwöhnter Teenager, feiert ihren sechzehnten Geburtstag, als sie zum ersten Mal von einer Vision heimgesucht wird, die ihr bisheriges Leben völlig verändert. Gemma sieht, wie ihre Mutter sich selbst tötet, um einem Schattenwesen zu entkommen, das sie zu verschlingen droht. Gemma, die ihr Leben in Indien verbracht hat, wird zu ihrer Familie nach London geschickt, wo sie ein Pensionat für junge Damen besuchen soll. Niemand ahnt etwas von ihren Visionen, die nur der Anfang eines viel größeren Geheimnisses sind.
1895 – Gemma Doyle, ein launischer und verwöhnter Teenager, feiert ihren sechzehnten Geburtstag, als sie zum ersten Mal von einer Vision heimgesucht wird, die ihr bisheriges Leben völlig verändert. Gemma sieht, wie ihre Mutter sich selbst tötet, um einem Schattenwesen zu entkommen, das sie zu verschlingen droht. Gemma, die ihr Leben in Indien verbracht hat, wird zu ihrer Familie nach London geschickt, wo sie ein Pensionat für junge Damen besuchen soll. Niemand ahnt etwas von ihren Visionen, die nur der Anfang eines viel größeren Geheimnisses sind.
– She walks out towards them, an apparition in white and blue velvet, her head held high as they stare in awe at her, the goddess. I don’t yet know what power feels like. But this is surely what it looks like, and I think I’m beginning to understand why those ancient women had to hide in caves. Why our parents and teachers and suitors want us to behave properly and predictably. It’s not that they want to protect us; it’s that they fear us. –
Kapitel 8, S. 207
A Great And Terrible Beauty (Gemmas Visonen), der erste Roman aus der Trilogie Gemma Doyle (Der geheime Zirkel), entführt in das ausklingende viktorianische Zeitalter und öffnet gleichzeitig die Tür in eine andere Welt, die man vielleicht am ehesten mit einem magischen Garten Eden vergleichen könnte. Der Roman spielt mit historischen Elementen der Hexerei, Mythologie, phantastischen Zwischenwelten, Dämonen und anderen mystischen Einflüssen, bleibt dabei aber bodenständig und relativ realitätsnah. Der Handlungsort wechselt zwischen Indien, England und den magischen Landen, wodurch auch Themen wie Klassengesellschaft und der Umgang mit anderen Völkern angesprochen werden.
Anfangs kommt der Roman nur schwer in Fahrt und konzentriert sich eher auf Ortsbeschreibungen und die Schilderung gesellschaftlicher Zustände als auf die Anstoß gebenden Visionen der Protagonistin. Die magischen Lande werden nur kurz besucht und erkundet, der Aufenthalt dort wiederholt sich ein paar Mal ohne große Änderungen. So wird die eigentliche Handlung erst zur Buchmitte hin wirklich spannend, liefert einem dann aber ein altes Tagebuch mit dunklen Geheimnissen, eine Spur scheuer und verbotener Romantik und heranwachsende Frauen mit einem ausgeprägten Hang zu Abenteuern, Entdeckungstouren und anderen, verbotenen Dingen. Auf folgsame, unterwürfige Frauen, die einen Beschützer suchen, braucht man in diesem Roman nicht zu warten, denn es geht hier recht feministisch zu. Da sich die Autorin insgesamt an die realen Zustände jener Zeit hält und ihre Gesellschaft entsprechend formt, zeichnet A Great And Terrible Beauty ein aus heutiger Sicht bedrückendes Bild viktorianischer Mädchen und Frauen, die zu gerne aus den vorbestimmten Bahnen ausbrechen würden. Dabei wirkt die Handlung nicht überzogen, nicht zu modern feministisch, es bleibt der Zeit angemessen glaubwürdig und verbindet alles mit dieser magischen Welt des Gartens. Die phantastischen Elemente halten sich aber doch stark zurück, so dass der Roman mehr zu einem nostalgischen Mystery-Abenteuer mit viel erzählerischem Ausbau wird.
Tragische Ereignisse und Enttäuschungen bleiben ebenfalls nicht außen vor, denn dieser Roman ist nicht darauf ausgelegt, eine schillernde, softe Heldinnenreise zu beschreiben.
Sich als LeserIn mit den Hauptcharakteren zu identifizieren, gestaltet sich anfangs schwierig. Gemma ist ein launischer, verwöhnter Teenager von sechzehn Jahren. Zickig, ein bisschen hochnäsig und verantwortungslos. Im Laufe des Romans entwickelt sie sich langsam weiter, bleibt aber insgesamt sprunghaft und ignoriert Dinge, die ihr unliebsam sind. Neben ihrem jugendlichen Verhalten denkt sie allerdings recht emanzipiert und ist keine Freundin der herrschenden Geschlechterrollen, was eine erfrischende Abwechslung zu den zahlreichen Jugendbüchern mit sehr klischeehaften Rollenbildern bietet.
Auch Gemmas Freundinnen sind keine großen Symphatiträgerinnen. Die Mädchen begegnen sich mit Hass und intrigantem Verhalten und schließen sich mehr aus der Not heraus zusammen denn aus echter Freundschaft. Keine kann die Andere so richtig leiden und sie trauen einander auch nicht. Nach und nach wird aber deutlich, dass jedes der Mädchen, so unsympathisch sie einem zunächst bleiben, ein ernüchterndes Geheimnis hat, sich alle vor der Zukunft fürchten und sich als Frauen mehr Wertschätzung wünschen. Es sind halbwüchsige Teenager an der Schwelle zum Erwachsensein, mit all den Fehlern, Launen, rebellischen Gedanken und Dummheiten. Sie sind auf der Suche nach sich selbst und einem Sinn für ihr Leben. Erst mit Einbruch einer Katastrophe realisieren sie allmählich, dass ihr oft überstürztes und nicht durchdachtes Handeln sie von ihren Zielen und Wünschen immer weiter entfernt.
Es gibt viele gegensätzliche Impulse in A Great And Terrible Beauty. Neben der vorhandenen emanzipierten Denkweise träumen die Mädchen manchmal auch einfach nur von ihrem Traumprinzen oder vielmehr einem Ideal der wahren Liebe. Sie lernen gerade erst mit der veränderten Wahrnehmung von Männern und Frauen umzugehen und auch mit den damit verbundenen sexuellen Empfindungen – in einer Zeit, in der ein unbedeckter Fußknöchel bereits als skandalös gilt. Verdeutlicht wird dieses Spiel mit den Gegensätzen z.B. anhand einer der wenigen männlichen Figuren des Romans. Kartik, der von seiner Bruderschaft, den Rakshana, damit beauftragt wurde, Gemma zu bewachen und sie von den magischen Landen fern zuhalten, tritt gleichzeitig auch als ihr Beschützer auf. Er ist abwechselnd herrisch und fürsorglich, unsicher, wie er sich richtig verhalten muss. Es führt dazu, dass zwischen Kartik und der selbstbewussten Gemma eine offensichtliche Rivalität und gleichzeitig naive Unsicherheit herrscht. Ähnlich wie es Gemma nicht möglich ist eine klare Entscheidung zu treffen, weiß man als LeserIn ebenfalls lange nicht, ob Kartik Freund oder Feind ist, ob man ihn begehren oder zum Teufel schicken soll. Um die Dinge möglichst kompliziert zu gestalten, ist natürlich auch beides gleichzeitig möglich – es lebe die Pubertät mit ihren verwirrenden Auswirkungen. Libba Bray zeichnet in ihrem Debütroman keine Teenager mit einem unrealistisch erwachsenen Denkmuster oder utopischen Vorstellungen von der ersten und einzig wahren, ewig existierenden Liebe. Sie liefert Jugendliche auf der Suche nach dem eigenen Weg ins Erwachsensein und dem Erkennen des Unterschieds von Wunsch und Realität.
Dieses Buch wird durchaus nicht jedem gefallen, denn man muss sich auf wirklich launische und nicht immer vernünftig handelnde Heranwachsende einlassen können. Was aber klar für diesen Roman spricht, ist ein komplex verflochtenes Netz verschiedener, schwieriger Themen, seine viktorianisch-elitäre Atmosphäre und seine überzeugende Darstellung, die einen an die eigene, manchmal schwierige Jugendzeit erinnert.
Sprachlich ist A Great An Terrible Beauty keine große Herausforderung. Das Buch sollte für halbwegs geübte Leser auch im englischen Original mühelos verständlich sein.
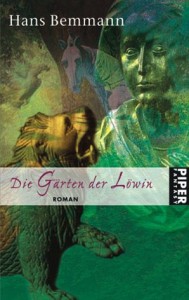 Eine junge Studentin erzählt ihrem Geliebten aus ihrer Vergangenheit. Dabei greift sie auf die Märchen zurück, die ihr Großvater einst erzählt hat. Die Heldin dieser Märchen ist die Königstochter Herod, mit der sich die Studentin immer mehr identifiziert, bis Realität und Phantasie zusammenfließen.
Eine junge Studentin erzählt ihrem Geliebten aus ihrer Vergangenheit. Dabei greift sie auf die Märchen zurück, die ihr Großvater einst erzählt hat. Die Heldin dieser Märchen ist die Königstochter Herod, mit der sich die Studentin immer mehr identifiziert, bis Realität und Phantasie zusammenfließen.