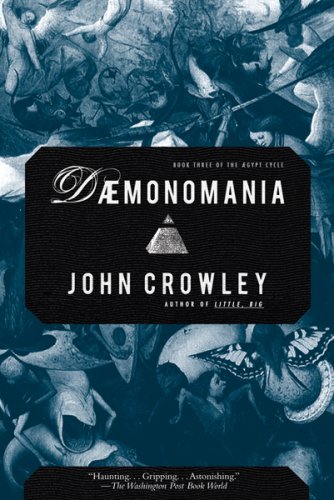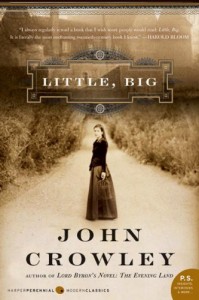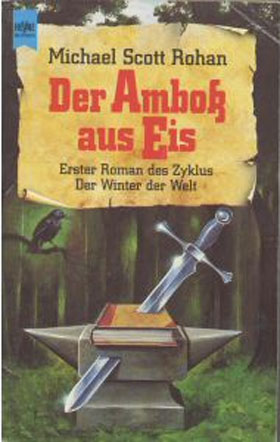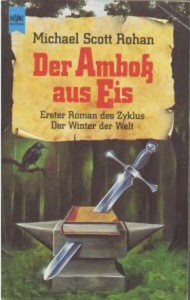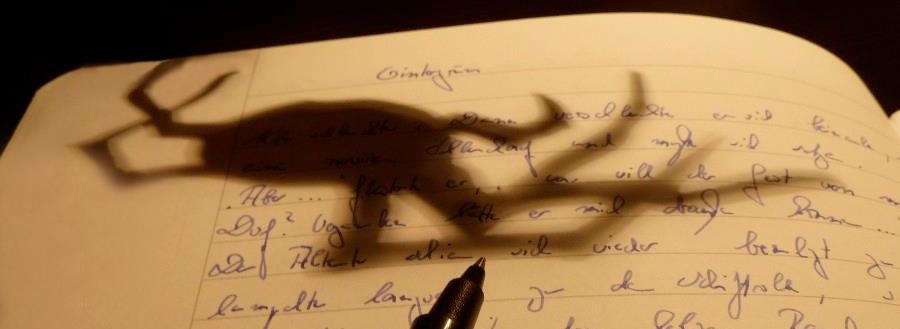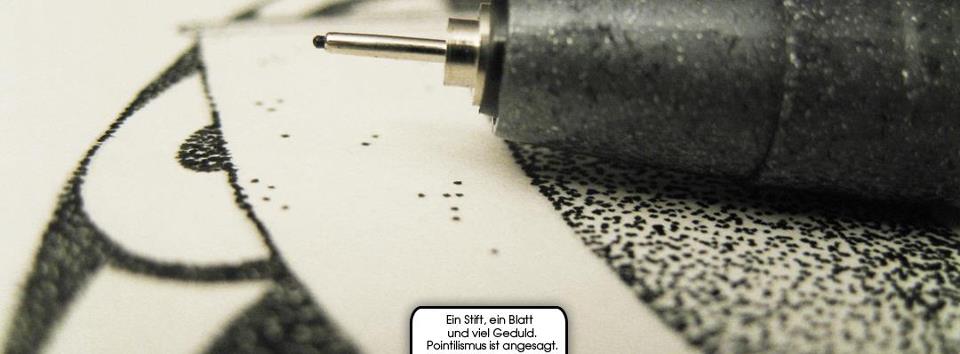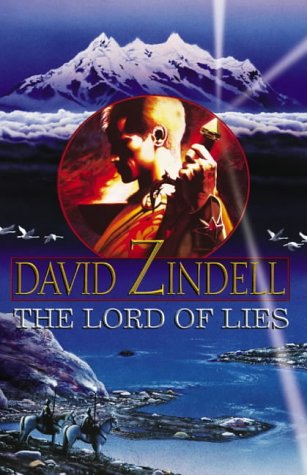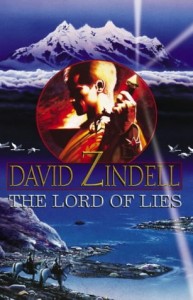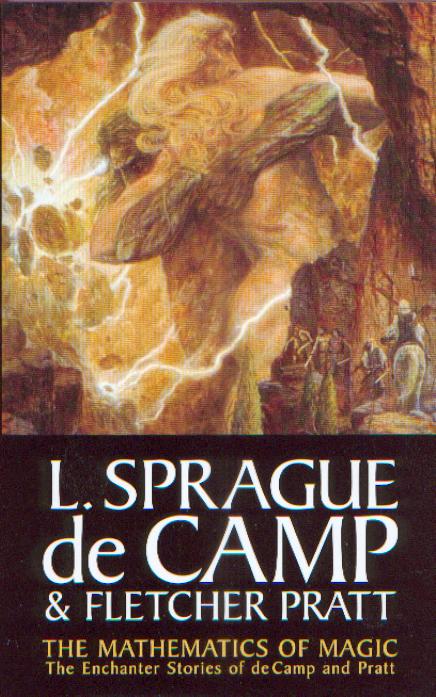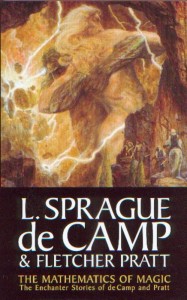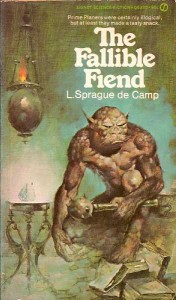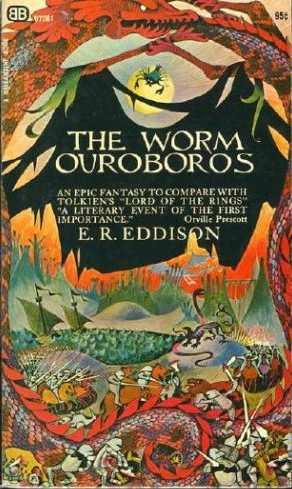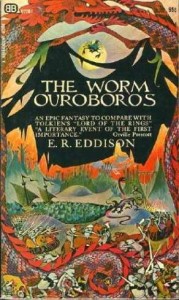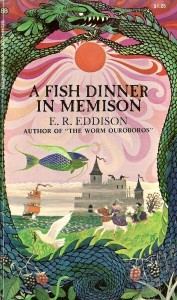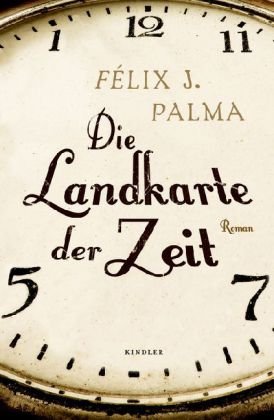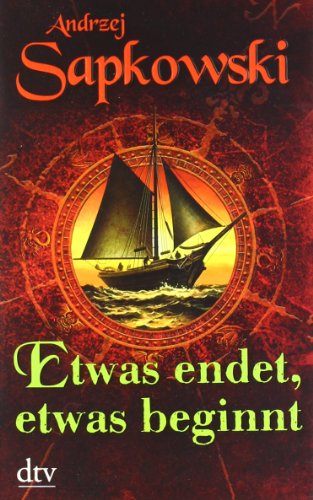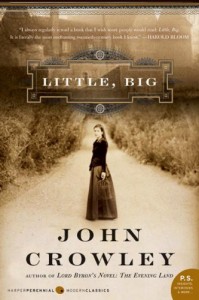 Bibliotheka Phantastika gratuliert John Crowley, der heute 70 Jahre alt wird. Der am 01. Dezember 1942 in Presque Isle, Maine, geborene Crowley zählt gewiss zu den literarisch anspruchsvollsten zeitgenössischen angloamerikanischen Autoren und Autorinnen, die phantastische Literatur schreiben (oder geschrieben haben, denn seine neuesten Romane enthalten keine oder allenfalls marginale, als solche kaum noch erkennbare phantastische Elemente), was vermutlich mit dazu beigetragen hat, dass seine Romane – von einer Ausnahme abgesehen – nie der große Publikumserfolg waren und er sich weder im Genre noch im Mainstream eine große Stammleserschaft erworben hat. Allerdings muss man auch zugeben, dass er es seinen Lesern und Leserinnen vor allem in seinen Nicht-SF-Romanen nicht gerade leicht macht.
Bibliotheka Phantastika gratuliert John Crowley, der heute 70 Jahre alt wird. Der am 01. Dezember 1942 in Presque Isle, Maine, geborene Crowley zählt gewiss zu den literarisch anspruchsvollsten zeitgenössischen angloamerikanischen Autoren und Autorinnen, die phantastische Literatur schreiben (oder geschrieben haben, denn seine neuesten Romane enthalten keine oder allenfalls marginale, als solche kaum noch erkennbare phantastische Elemente), was vermutlich mit dazu beigetragen hat, dass seine Romane – von einer Ausnahme abgesehen – nie der große Publikumserfolg waren und er sich weder im Genre noch im Mainstream eine große Stammleserschaft erworben hat. Allerdings muss man auch zugeben, dass er es seinen Lesern und Leserinnen vor allem in seinen Nicht-SF-Romanen nicht gerade leicht macht.
Begonnen hat John Crowley als Autor von SF-Romanen, die in ihrem Instrumentarium tief auf SF-Konventionen zurückgreifen, dabei aber bereits auf mehr oder weniger eigenwillige Weise sehr ungewöhnliche Geschichten erzählen. In The Deep (1975; dt. In der Tiefe (1981)) ist eine scheibenfömige, auf einer unermesslich weit in die allumfassende, titelgebende Tiefe reichenden Säule platzierte Welt der Schauplatz einer Handlung, deren feudale Fehden und Intrigen auch jedem Fantasyroman zur Ehre gereichen würden – allerdings ist der wichtigste personale Erzähler ein reichlich mitgenommener Androide mit Erinnerungsproblemen. Der etwas konventionellere, in einer unbestimmten, aber recht nahen Zukunft angesiedelte zweite Roman Beasts (1976; dt. Geschöpfe (1980)) spielt in den in viele miteinander verfeindete Kleinstaaten zerfallenen USA und dreht sich um genetisch veränderte, dem Menschen plötzlich sehr ähnliche Tiere bzw. vor allem darum, wie die Menschen mit ihnen umgehen. Engine Summer (1979; dt. Maschinensommer (1982)), Crowleys dritter Roman, lebt vor allem von der anfangs gewöhnungsbedürftigen, aber faszinierenden Erzählstimme des Ich-Erzählers Rush That Speaks, der sich in einer ferneren Zukunft mit den Lebensumständen in den dieses Mal postapokalyptischen USA herumschlagen muss. Wobei diese Lebensumstände keineswegs von andauernden Kämpfen geprägt sind, im Gegenteil, das Setting hat mehr von einer dem Untergang geweihten ländlichen Idylle mit deutlichen Anklängen an indianische Kulturen und New-Age-Elementen. Dennoch wartet Engine Summer am Schluss mit einer Enthüllung auf, die man (wenn man die Konsequenzen durchdenkt) eigentlich nur als herzzerreißend bezeichnen kann.
Mit Little, Big (1981; dt. Little Big oder Das Parlament der Feen (1984)) verabschiedete sich Crowley zumindest als Romanautor von der SF und wandte sich der Phantastik zu. Für diesen Roman – dessen Titel in gewisser Hinsicht Programm ist, denn “the further in you go, the bigger it gets” (was auf den Bezug zwischen der äußeren, mundanen und der inneren, phantastischen oder spirituellen Welt verweist) – erhielt er 1982 den World Fantasy Award, und er wurde auch sein größter kommerzieller Erfolg. Und das, obwohl die Handlung, in der ein Haus, das innen größer ist als außen und in dem es neben einem Modell des Sonnensystems auch Portale in andere Realitäten zu geben scheint – oder auch nicht – eine ebensogroße Rolle spielt wie Menschen, die vielleicht auch Faeries sind, oder der wiedergeborene Friedrich Barbarossa, und in der sich etliche Anspielungen und Verweise auf Lewis Carrolls Alice’s Adventures in Wonderland finden lassen, alles andere als leicht zugänglich oder verständlich ist. Auch wenn es ein bisschen hilft, sich an der ebenfalls vorhandenen Familiengeschichte und der Suche des vielleicht am ehesten als Hauptfigur zu bezeichnenden Smoky Barnables nach der Welt der Faeries entlangzuhangeln.
Der Erfolg von Little, Big scheint Crowley Mut gemacht zu haben, sein nächstes, noch wesentlich ambitionierteres – und noch weniger leicht zugängliches – Werk anzugehen: einen manchmal als Ægypt Tetralogy bezeichneten Megaroman,  der aus den vier Bänden Ægypt (1987; rev. The Solitudes (2007); dt. Ægypten (1991)), Love & Sleep (1994), Dæmonomania (2000) und Endless Things (2007) besteht. Die komplexe Handlung dreht sich einerseits um die geheime Geschichte der Welt bzw. die Suche der in der nahen Zukunft lebenden Hauptfigur Pierce Moffat nach der “wirklichen” Welt – einer Welt, in der Magie einst tatsächlich Magie und als solche anwendbar war, und die durch ein Ereignis so verändert wurde, dass sich auch die Vergangenheit mit verändert hat –, andererseits um mehrere, durch unterschiedliche Beziehungen miteinander verbundene Personen, aber auch um wirkliche und fiktive Bücher, um Giordano Bruno und John Dee, um Hermes Trismegistos und die auf ihn zurückgehende Hermetik, und ganz generell um die Frage, was die Wirklichkeit ist und wie man sie als solche erkennt. Teilweise wunderbar geschriebener, aber inhaltlich harter Stoff, der noch dazu über einen Zeitraum von 20 Jahren erschienen ist.
der aus den vier Bänden Ægypt (1987; rev. The Solitudes (2007); dt. Ægypten (1991)), Love & Sleep (1994), Dæmonomania (2000) und Endless Things (2007) besteht. Die komplexe Handlung dreht sich einerseits um die geheime Geschichte der Welt bzw. die Suche der in der nahen Zukunft lebenden Hauptfigur Pierce Moffat nach der “wirklichen” Welt – einer Welt, in der Magie einst tatsächlich Magie und als solche anwendbar war, und die durch ein Ereignis so verändert wurde, dass sich auch die Vergangenheit mit verändert hat –, andererseits um mehrere, durch unterschiedliche Beziehungen miteinander verbundene Personen, aber auch um wirkliche und fiktive Bücher, um Giordano Bruno und John Dee, um Hermes Trismegistos und die auf ihn zurückgehende Hermetik, und ganz generell um die Frage, was die Wirklichkeit ist und wie man sie als solche erkennt. Teilweise wunderbar geschriebener, aber inhaltlich harter Stoff, der noch dazu über einen Zeitraum von 20 Jahren erschienen ist.
Neben diesen – und drei neuen, in diesem Jahrtausend erschienenen nicht phantastischen – Romanen hat Crowley auch einige teils phantastische Kurzgeschichten und Erzählungen geschrieben, die in den Sammlungen Novelty (1989), Antiquities (1993) und Novelties & Souvenirs: Collected Short Fiction (2004; diese Sammlung enthält die ersten beiden und ein bisschen neues Material) veröffentlicht wurden. In der ersten (und dann logischerweise auch der letzten) Sammlung ist die Novelle “Great Work of Time” erschienen, für die Crowley 1990 ebenfalls den World Fantasy Award erhalten hat, und die eine der faszinierendsten und zugleich erschreckendsten Umsetzungen der Zeitreisethematik bietet. Wer wissen möchte, was orthogonale Zeit ist, und warum Eingriffe in die Vergangenheit so gefährlich sind, findet hier eine umfassende Antwort. Allerdings muss er oder sie die Geschichte im Original lesen, denn “Great Work of Time” wurde bisher ebensowenig ins Deutsche übersetzt wie die Bände zwei bis vier von Ægypt – und das ist, allen Vorbehalten hinsichtlich der komplexen, bewusst hermetisch und opak erzählten (späten) Romane Crowleys zum Trotz schlicht bedauerlich.
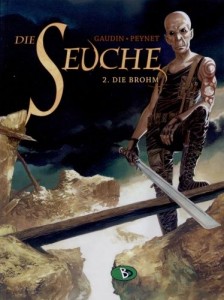 Die Oldis sind ein Volk von Jägern, Sammlern und Handwerkern, das in Frieden leben könnte, wenn nicht die kriegerischen Borun die Nachbarschaft unsicher machen würden – und wenn vor allem die Seuche nicht wäre. Wahllos rafft sie Alte und Junge dahin, und mit keiner Heilmethode ist ihr beizukommen. Der junge Jautry verliert dadurch seinen Bruder, und dessen Mutter Valnes beschließt, der Sache auf den Grund zu gehen. Doch da wird ein toter Borun gefunden, und die Vorurteile und gegenseitigen Schuldzuweisungen kochen über.
Die Oldis sind ein Volk von Jägern, Sammlern und Handwerkern, das in Frieden leben könnte, wenn nicht die kriegerischen Borun die Nachbarschaft unsicher machen würden – und wenn vor allem die Seuche nicht wäre. Wahllos rafft sie Alte und Junge dahin, und mit keiner Heilmethode ist ihr beizukommen. Der junge Jautry verliert dadurch seinen Bruder, und dessen Mutter Valnes beschließt, der Sache auf den Grund zu gehen. Doch da wird ein toter Borun gefunden, und die Vorurteile und gegenseitigen Schuldzuweisungen kochen über.