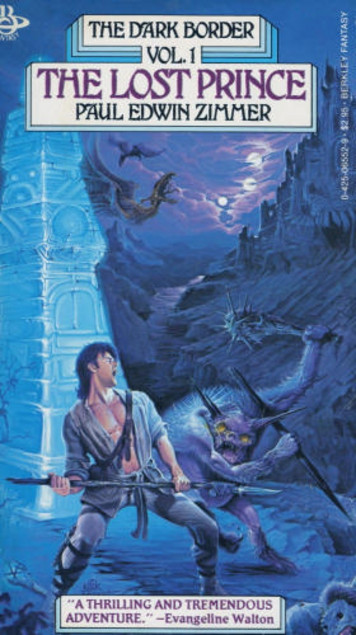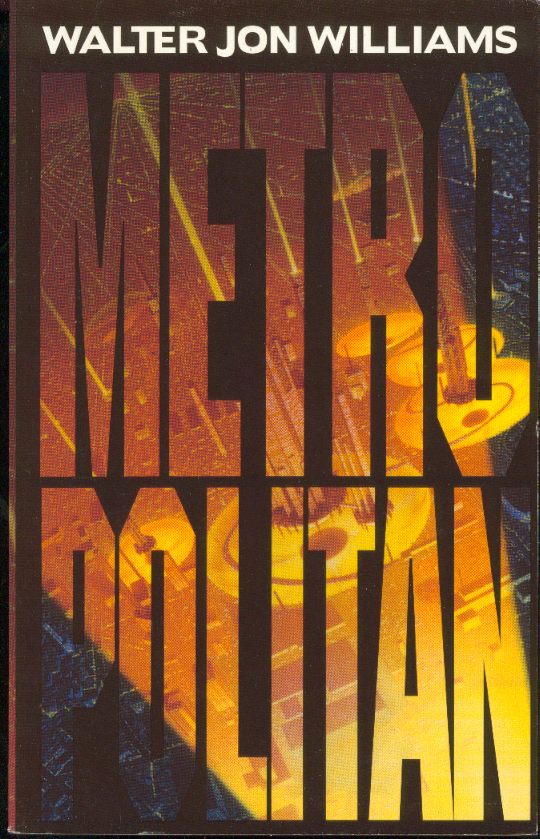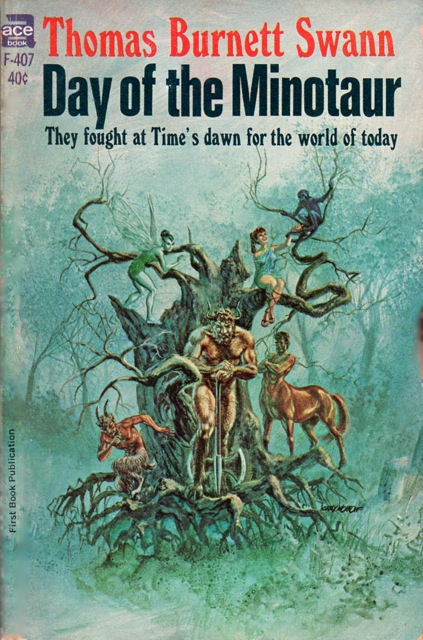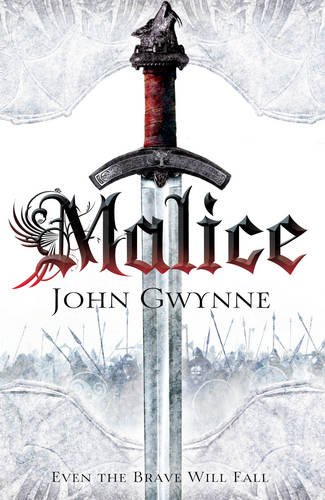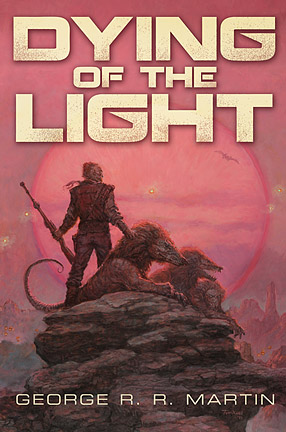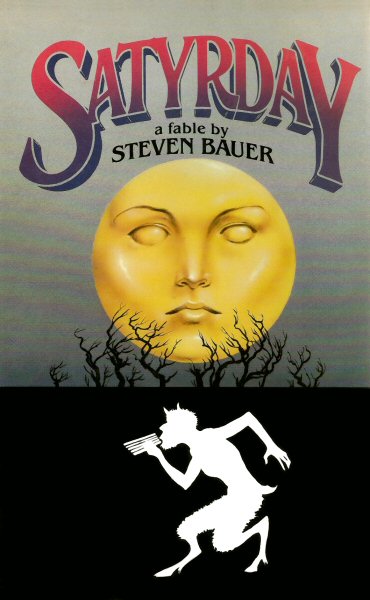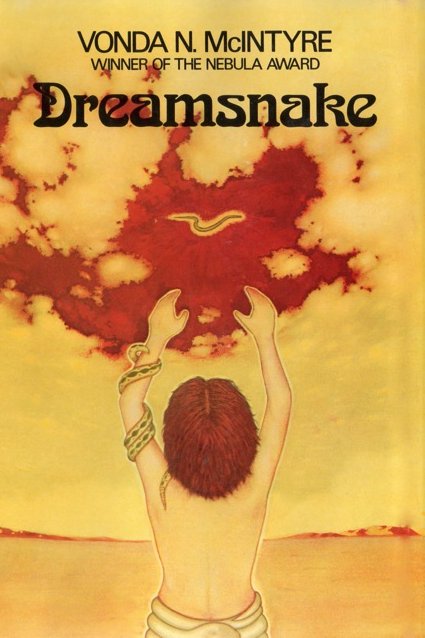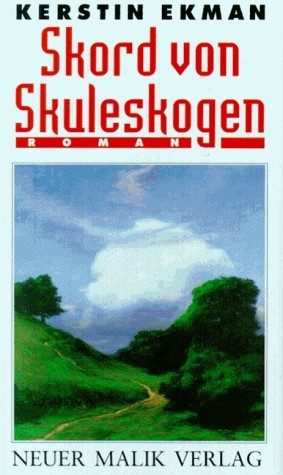Bibliotheka Phantastika erinnert an Paul Edwin Zimmer, der heute 70 Jahre alt geworden wäre. Seine erste professionelle Veröffentlichung erlebte der am 16. Oktober 1943 in Albany, New York, geborene Paul Edwin Zimmer als ungenannter Co-Autor von Hunters of the Red Moon (1973), einem SF-Roman, der jahrelang nur Marion Zimmer Bradley zugeschrieben wurde. Bei der Fortsetzung The Survivors (1979) wurde er dann allerdings als Co-Autor genannt, was möglicherweise eine Konzessionsentscheidung seiner berühmten Schwester war, der er dem Vernehmen nach nicht nur in diesen beiden, sondern auch in mehreren Darkover-Romanen bei der Gestaltung der Kampfszenen geholfen haben soll. Wozu er – als einer der Gründer der Society for Creative Anachronism und fähiger Schwertkämpfer – sozusagen prädestiniert war.
Paul Edwin Zimmers erste eigenständige Veröffentlichung war ein dünnes Bändchen mit dem Titel Woman of the Elfmounds (1980) bei Charles de Lints Triskell Press. Weitaus wichtiger ist allerdings die Sequenz aus vier – bzw. drei – Romanen und einigen Erzählungen, die unter dem Obertitel Dark Border bekannt ist. In den Romanen The Lost Prince (1982), King Chondos’ Ride (1982) – das ist eigentlich ein Roman, der nur aus Umfangsgründen gesplittet wurde –, A Gathering of Heroes (1987) und Ingulf the Mad (1989) sowie größtenteils im Magazin Fantasy Book erschienenen Erzählungen wie “A Swordsman from Carcosa” (1986), “The Shadow of Tugar” (1983), “The Wolves of Sarlow” (1984) oder “The Vision of Aldamir” (1988) entwirft Zimmer eine Welt, in der es einerseits typische 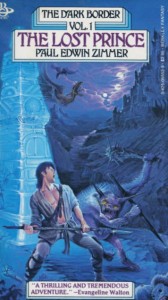 Fantasygeschöpfe wie Elfen und Zwerge und dergleichen mehr gibt, die aber andererseits von wahrhaft alptraumhaften Wesen bedroht wird, die jenseits der titelgebenden “dunklen Grenze” in einem Reich ewiger Dunkelheit leben und alles daransetzen, das zurückzuerobern, was ihnen einst von dem mächtigen Magier Hastur entrissen wurde. Vor allem in The Lost Prince und King Chondos’ Ride (auf Deutsch 1986 unter dem Obertitel Das Schattenreich mit den Titeln Der verschwundene Prinz und König Chondos’ Ritt erschienen) gelingt ihm dabei eine überzeugende Mischung aus Elementen der Sword & Sorcery und der Epic Fantasy, die jedoch wesentlich düsterer ausgefallen ist als die meisten anderen in dieser Zeit entstandenen Werke. Das liegt einerseits am Plot, der sich in erster Linie darum dreht, dass der jenseits der dunklen Grenze aufgewachsene und von den Wesen der Dunkelheit in ihrem Sinn erzogene Prinz Jodos unbemerkt gegen seinen Bruder Chondos, den rechtmäßigen Thronfolger des Königreichs Terencia ausgetauscht wird – mit logischerweise fatalen Folgen für die Reiche der Menschen. Das liegt aber auch am eigentlichen Setting, denn die Wesen, die das Schattenreich bewohnen, sind teilweise wahrhaft monströs, und ihr Auftreten und der bereits jahrtausendealte, von unglaublich mächtigen Entitäten geprägte Konflikt lassen immer wieder einen Hauch Cthulhu-Mythos durchschimmern (wozu auch einige Namen beitragen). Und zu guter Letzt hat es auch mit der Charakterisierung von Jodos und Chondos zu tun, die durch ihre Erziehung geprägt sind und dieser Prägung ebensowenig entkommen können wie jene Männer, die ihnen gegenüber – teilweise aus Unwissenheit bzw. den falschen Gründen – loyal sind.
Fantasygeschöpfe wie Elfen und Zwerge und dergleichen mehr gibt, die aber andererseits von wahrhaft alptraumhaften Wesen bedroht wird, die jenseits der titelgebenden “dunklen Grenze” in einem Reich ewiger Dunkelheit leben und alles daransetzen, das zurückzuerobern, was ihnen einst von dem mächtigen Magier Hastur entrissen wurde. Vor allem in The Lost Prince und King Chondos’ Ride (auf Deutsch 1986 unter dem Obertitel Das Schattenreich mit den Titeln Der verschwundene Prinz und König Chondos’ Ritt erschienen) gelingt ihm dabei eine überzeugende Mischung aus Elementen der Sword & Sorcery und der Epic Fantasy, die jedoch wesentlich düsterer ausgefallen ist als die meisten anderen in dieser Zeit entstandenen Werke. Das liegt einerseits am Plot, der sich in erster Linie darum dreht, dass der jenseits der dunklen Grenze aufgewachsene und von den Wesen der Dunkelheit in ihrem Sinn erzogene Prinz Jodos unbemerkt gegen seinen Bruder Chondos, den rechtmäßigen Thronfolger des Königreichs Terencia ausgetauscht wird – mit logischerweise fatalen Folgen für die Reiche der Menschen. Das liegt aber auch am eigentlichen Setting, denn die Wesen, die das Schattenreich bewohnen, sind teilweise wahrhaft monströs, und ihr Auftreten und der bereits jahrtausendealte, von unglaublich mächtigen Entitäten geprägte Konflikt lassen immer wieder einen Hauch Cthulhu-Mythos durchschimmern (wozu auch einige Namen beitragen). Und zu guter Letzt hat es auch mit der Charakterisierung von Jodos und Chondos zu tun, die durch ihre Erziehung geprägt sind und dieser Prägung ebensowenig entkommen können wie jene Männer, die ihnen gegenüber – teilweise aus Unwissenheit bzw. den falschen Gründen – loyal sind.
Darüber hinaus lebt der Zweiteiler von seiner eigentlichen Hauptfigur, dem berühmten Schwertkämpfer Istvan DiVega, der bereits über 60 und damit über den Zenit seines Lebens hinaus ist und der im gesamten Zyklus eine ähnliche Rolle spielt wie etwa Druss in David Gemmells Drenai-Saga (und der reichlich screen time erhält, um seine Kampfkünste vorzuführen; immerhin muss man Zimmer zubilligen, dass er im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen weiß, wovon er schreibt). Die anderen beiden Dark-Border-Romane – später geschriebene, aber etliche Jahre früher spielende Prequels – bieten ordentliche, durchaus lesbare Sword & Sorcery oder Heroic Fantasy, reichen an die Qualität des Schattenreich-Zweiteilers allerdings nicht heran. Das gilt auch für Paul Edwin Zimmers einzigen außerhalb der Dark-Border-Sequenz erschienenen Roman Blood of the Colyn Muir (1988), den er zusammen mit Jon DeCles verfasst hat.
Die Hintergründe, die in den Romanen und Geschichten um die Dark Border gelegentlich angedeutet werden und immer mal wieder vage durchschimmern, deuten auf ein Universum hin, aus dem es noch viel zu erzählen gegeben hätte. Paul Edwin Zimmer wird über dieses Konzept, an dem er viele Jahre lang gearbeitet haben soll, allerdings nichts mehr erzählen, denn er ist am 18. Oktober 1997 im Alter von 54 Jahren während eines Conbesuchs an einem Herzinfarkt gestorben. Zwar ist immer wieder die Rede davon, dass Zimmer bereits einen fünften Dark-Border-Roman fertig geschrieben haben soll, doch mehr als der Titel – The King who was of Old – und die Tatsache, dass es sich um ein noch früher spielendes Prequel handeln soll, war und ist darüber nicht zu erfahren.
Category: Reaktionen
Bibliotheka Phantastika gratuliert Walter Jon Williams, der heute 60 Jahre alt wird. Der am 15. Oktober 1953 in Duluth, Minnesota, USA geborene Schriftsteller lässt sich nicht leicht eine Genre-Kategorie überstülpen, im Kerngebiet der Fantasy ist er jedoch keinesfalls zu Hause. Allerdings hat er einige Romane geschrieben, die in einer sehr fernen und fremden Zukunft angesiedelt sind und die durchaus Fantasy-Elemente aufweisen oder in ihrer Atmosphäre dem Genre zumindest nahestehen.
Williams’ Karriere begann mit einer Reihe Marinehistorischer Romane (Privateers and Gentlemen, 1981-84). Nach einem Wechsel in die SF tischte er seinen Lesern und Leserinnen die verschiedensten Settings auf, deren kleinster gemeinsamer Nenner vielleicht am ehesten die Tatsache ist, dass Williams gerne mit großen Ideen arbeitet und seine Welten häufig auf bestimmten Prämissen errichtet, deren Implikationen er dann ergründet. Dabei kann sowohl Cyberpunk herauskommen, wie etwa in der Hardwired-Reihe, Space Opera in eher militaristischer Ausprägung (in der Dread Empire’s Fall-Trilogie) oder als Gentleman-Ganovenstück (in der Drake Maijstral-Reihe), oder eben SF, deren Technik sich wie Magie anfühlt und die Williams selbst als Fantasy sieht:
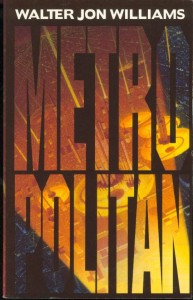 Metropolitan (1995; dt. Plasma City (2002)) und City on Fire (1997) sind dabei genau betrachtet tatsächlich Urban Fantasies im wahrsten Sinne des Wortes, denn der Schauplatz der beiden Romane (zu denen sich nach dem Willen des Autors noch ein dritter gesellen sollte, der aber aufgrund gewisser Umstände bisher nicht erschienen ist) ist eine die ganze Welt umspannende Stadt, die unter einem undurchdringlichen, Licht und Wärme spendenden Schutzschirm liegt. Sonne, Mond und Sterne, Tag und Nacht sind nur noch Legenden; an ihre Stelle ist der gleißende Schutzschirm getreten, den die Götter bei ihrem Aufstieg zurückgelassen haben. Die Weltstadt besteht aus unzähligen metropolises aka Metropolen, die mehr oder weniger Staaten und Nationen entsprechen, und in denen sich alle denkbaren politischen Systeme finden lassen. Dass das ganze Gebilde überhaupt existieren kann, hängt mit einem Stoff namens plasm bzw. Plasma zusammen, der unter bestimmten Voraussetzungen entsteht und mit dem man willentlich buchstäblich alles machen kann: Materie erschaffen und verändern, Verletzungen und Krankheiten heilen, Zellen verjüngen, die Sinne erweitern, Illusionen erzeugen – und Menschen töten. Kein Wunder, dass die Regierungen der einzelnen Metropolen die Plasmaquellen in ihrem Gebiet kontrollieren, denn wer über Plasma gebietet, verfügt über Macht. Als Aiah, eine unbedeutende städtische Angestellte in der Metropole Jaspeer, zufällig über eine enorme Plasmaquelle stolpert, teilt sie diese Entdeckung nicht ihrer Regierung mit, sondern sucht die Hilfe eines erfahrenen Mage (so werden die Menschen genannt, die ungefährdet mit Plasma hantieren können), um selbst den richtigen Umgang mit dem magischen Stoff zu lernen. Doch da Constantine, besagter Magier, schon lange revolutionäre Gedanken wälzt und nun die Mittel vor sich sieht, seine Ideen in die Tat umzusetzen, setzt Aiah damit eine Entwicklung in Gang, von der zunächst nicht klar ist, wohin sie führen wird …
Metropolitan (1995; dt. Plasma City (2002)) und City on Fire (1997) sind dabei genau betrachtet tatsächlich Urban Fantasies im wahrsten Sinne des Wortes, denn der Schauplatz der beiden Romane (zu denen sich nach dem Willen des Autors noch ein dritter gesellen sollte, der aber aufgrund gewisser Umstände bisher nicht erschienen ist) ist eine die ganze Welt umspannende Stadt, die unter einem undurchdringlichen, Licht und Wärme spendenden Schutzschirm liegt. Sonne, Mond und Sterne, Tag und Nacht sind nur noch Legenden; an ihre Stelle ist der gleißende Schutzschirm getreten, den die Götter bei ihrem Aufstieg zurückgelassen haben. Die Weltstadt besteht aus unzähligen metropolises aka Metropolen, die mehr oder weniger Staaten und Nationen entsprechen, und in denen sich alle denkbaren politischen Systeme finden lassen. Dass das ganze Gebilde überhaupt existieren kann, hängt mit einem Stoff namens plasm bzw. Plasma zusammen, der unter bestimmten Voraussetzungen entsteht und mit dem man willentlich buchstäblich alles machen kann: Materie erschaffen und verändern, Verletzungen und Krankheiten heilen, Zellen verjüngen, die Sinne erweitern, Illusionen erzeugen – und Menschen töten. Kein Wunder, dass die Regierungen der einzelnen Metropolen die Plasmaquellen in ihrem Gebiet kontrollieren, denn wer über Plasma gebietet, verfügt über Macht. Als Aiah, eine unbedeutende städtische Angestellte in der Metropole Jaspeer, zufällig über eine enorme Plasmaquelle stolpert, teilt sie diese Entdeckung nicht ihrer Regierung mit, sondern sucht die Hilfe eines erfahrenen Mage (so werden die Menschen genannt, die ungefährdet mit Plasma hantieren können), um selbst den richtigen Umgang mit dem magischen Stoff zu lernen. Doch da Constantine, besagter Magier, schon lange revolutionäre Gedanken wälzt und nun die Mittel vor sich sieht, seine Ideen in die Tat umzusetzen, setzt Aiah damit eine Entwicklung in Gang, von der zunächst nicht klar ist, wohin sie führen wird …
Williams schildert den Moloch Stadt mit all seinen unangenehmen Begleiterscheinungen auf überaus drastische, aber treffende Weise, und die Geschichte Aiahs und ihres Aufstiegs von fast ganz unten in eine Position, in der sie aufgrund ihrer Plasmaquelle das Schicksal einer Metropole zumindest mitbestimmen kann, ist letztlich in mehrfacher Hinsicht die Geschichte einer Emanzipation, was Metropolitan und City on Fire nicht nur zu im Hinblick auf ihr Setting ungewöhnlichen, sondern auch überaus politischen Fantasyromanen macht (und es doppelt bedauerlich erscheinen lässt, dass der dritte Band der Sequenz bis heute nicht erschienen ist).
In anderen sehr weit entwickelten Szenarien geht Walter Jon Williams der Überlegung nach, welche Fragen die Menschheit beantworten muss, wenn ihre drängenden Probleme durch eine positive Technik-Entwicklung gelöst sind. In Aristoi (1992, dt. 1996) sind das die gesellschaftlichen 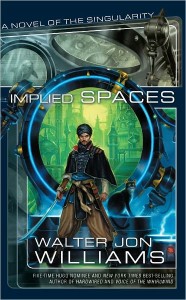 Begleiterscheinungen einer nahezu gottgleichen Herrscherkaste, in der bei aller Allmacht immer noch menschliche Triebe und Regungen schlummern, in Implied Spaces (2008) die Gefahren einer Zivilisation, die ihre Umwelt wie ein Sandkastenmodell gestalten kann, so dass dieser Roman auch mit einigen Fantasy-Szenarios und einer Fülle von Genre-Anspielungen aufwartet.
Begleiterscheinungen einer nahezu gottgleichen Herrscherkaste, in der bei aller Allmacht immer noch menschliche Triebe und Regungen schlummern, in Implied Spaces (2008) die Gefahren einer Zivilisation, die ihre Umwelt wie ein Sandkastenmodell gestalten kann, so dass dieser Roman auch mit einigen Fantasy-Szenarios und einer Fülle von Genre-Anspielungen aufwartet.
Williams’ jüngste Romane rund um die Spiele-Designerin Dagmar Shaw sind deutlich näher an der Gegenwart orientiert und handeln vom Zusammenwirken von Social Media, Online-Games und politischen Machenschaften, was bald nach Erscheinen des ersten Bandes This is Not a Game (2009, dt. Off (2009)) zum Teil von den Ereignissen des Arabischen Frühlings eingeholt wurde.
Der große Erfolg war Walter Jon Williams, der übrigens auch ein versierter Kurzgeschichten-Autor ist, bisher nicht beschieden, was vielleicht auch an der Vielseitigkeit liegen mag, die er an den Tag legt, wenn er munter zwischen den Genres springt, manchmal sogar innerhalb eines Romans, und dabei das ein oder andere stilistische Experiment wagt. Schade ist dabei auch, dass in der deutschen Übersetzung einige seiner Reihen abgebrochen wurden, während im Original inzwischen beinahe Williams’ gesamte Backlist in eBook-Form vorliegt; es bleibt zu hoffen, dass durch diese Möglichkeit auch in Zukunft noch manch große Idee das Licht der Welt erblickt – vielleicht sogar der angedachte dritte Metropolitan-Band mit dem (vorläufigen) Titel Heaven in Flames.
Bibliotheka Phantastika erinnert an Thomas Burnett Swann, der heute 85 Jahre alt geworden wäre. Es hat in der Fantasy immer wieder Autoren und Autorinnen gegeben, deren Werke sich von denen ihrer Zeitgenossen – vom (natürlich immer zeitabhängig) gerade angesagten Fantasy-Mainstream – deutlich unterschieden haben, und der am 12. Oktober 1928 in Tampa, Florida, geborene Thomas Burnett Swann ist ein solcher Autor. Nach seinem Studium schlug Swann zunächst eine Laufbahn als Universitätsdozent ein, veröffentlichte aber in den 50er Jahren bereits etliche Gedichte, auf die 1958 in der Juli-Ausgabe von Fantastic Universe mit “Winged Victory” seine erste Fantasystory folgte. In den 60er Jahren wurde zunächst das englische Magazin Science Fantasy der Hauptabnehmer für seine Geschichten bzw. Swann einer der Stammautoren des Magazins. Beginnend mit “The Dryad Tree” (1960) erschienen hier u.a. “Where is the Bird of Fire?” (1962; 1976 zum handlungschronologisch letzten Band der Latium Trilogy erweitert), “The Dolphin and the Deep” (1963) und “Vashti” (1965).
Auch Swanns erster Roman wurde als dreiteiliges Serial unter dem Titel “The Blue Monkeys” in Science Fantasy vorveröffentlicht (1964/65), ehe er als Day of the Minotaur (1966) als Taschenbuch auf den Markt kam. Day of the Minotaur (dt. Die Stunde des 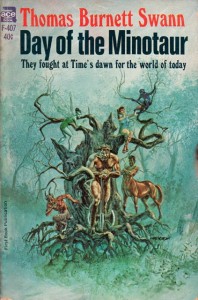 Minotauren (1978)), der als Erstes geschriebene und veröffentlichte, handlungschronologisch aber letzte Teil der Minotaur Trilogy, erzählt die Geschichte von Eunostos, dem letzten Minotauren, dem vielleicht eindruckvollsten Bewohner des kretischen Zauberwalds, in dem allerlei mythologische Geschöpfe – Zentauren, Dryaden, Artemisbären und andere – ein friedliches Leben führen. Eunostos’ Leben wird durch seine scheue Liebe zu Thea, der Tochter des kretischen Königs und einer Dryade, ein bisschen aufregender, aber das ist kein Vergleich zu der Aufregung, die es gibt, als die kriegerischen Achäer die Insel heimsuchen. Die vom Festland übergesetzten Eroberer fühlen sich nicht an die alten Regeln und Tabus gebunden, sondern symbolisieren eine neue Weltordnung, der die Geschöpfe des Zauberwalds nichts entgegenzusetzen haben. Das gilt auch für Eunostos, so beeindruckend sein Erscheinungsbild auch sein mag …
Minotauren (1978)), der als Erstes geschriebene und veröffentlichte, handlungschronologisch aber letzte Teil der Minotaur Trilogy, erzählt die Geschichte von Eunostos, dem letzten Minotauren, dem vielleicht eindruckvollsten Bewohner des kretischen Zauberwalds, in dem allerlei mythologische Geschöpfe – Zentauren, Dryaden, Artemisbären und andere – ein friedliches Leben führen. Eunostos’ Leben wird durch seine scheue Liebe zu Thea, der Tochter des kretischen Königs und einer Dryade, ein bisschen aufregender, aber das ist kein Vergleich zu der Aufregung, die es gibt, als die kriegerischen Achäer die Insel heimsuchen. Die vom Festland übergesetzten Eroberer fühlen sich nicht an die alten Regeln und Tabus gebunden, sondern symbolisieren eine neue Weltordnung, der die Geschöpfe des Zauberwalds nichts entgegenzusetzen haben. Das gilt auch für Eunostos, so beeindruckend sein Erscheinungsbild auch sein mag …
In gewisser Hinsicht steht Day of the Minotaur stellvertretend für Swanns gesamtes Werk, denn seine Romane und Geschichten kreisen letztlich alle auf vielfältige und durchaus unterschiedliche Weise um zwei immer gleiche Themen: den Zusammenprall zweier Konzepte, wie sie gegensätzlicher nicht sein könnten – und um die Liebe. Ob es Sonne und Mond sind, die sich gegenüberstehen, oder Vernunft und Magie, das männliche und das weibliche Prinzip oder Patriarchat und Matriarchat – das Ergebnis des Aufeinandertreffens dieser Konzepte ist klar, und was dabei ebenfalls meist auf der Strecke bleibt, ist die Liebe, denn Swanns (nie aufdringliche) Liebesgeschichten enden fast immer tragisch oder zumindest unglücklich. Genauso klar ist auch, wo die Sympathien des Autors liegen: bei den magischen Wesen und Geschöpfen, die schon lange nicht mehr Teil unserer Geschichte, sondern nur noch Bestandteil unserer Mythen sind. Thomas Burnett Swanns Romane sind vergleichsweise dünn – man müsste mehr als ein halbes Dutzend von ihnen zusammenfassen, um auf den Umfang eines zeitgenössischen epischen Fantasyromans zu kommen –, und sie sind leise und ziemlich unspektakulär; man könnte sie ein bisschen despektierlich auch als Vorgarten-Fantasies bezeichnen. Doch wenn man seine Romane und Geschichten in ihrer Gesamtheit betrachtet, wird erkennbar, dass dieser Autor, der von der Antike fasziniert war und eine Mary Renault einem J.R.R. Tolkien vorgezogen hat, einen elegischen Abgesang auf das Verschwinden der Magie aus unserer Welt und unserem Leben verfasst hat und uns damit einen Blick in eine Vergangenheit gewährt, die für immer dahin ist.
Doch um dieses Gesamtbild zu erkennen, muss man einen Schritt zurücktreten, denn Swann hat keinen Zyklus im engeren Sinn geschrieben. Was seine Romane und Geschichten eint, ist vor allem das Thema; nur in Ausnahmefällen – wie etwa in den beiden Trilogien – sind sie durch die Figuren miteinander verbunden. Außerdem hat er nicht nur besagte Trilogien “rückwärts” verfasst (d.h. Entstehungschronologie und Handlungschronologie verlaufen entgegengesetzt), sondern ist generell nach Lust und Laune kreuz und quer in den Epochen herumgesprungen. Aber wenn man genau hinschaut, lässt sich so etwas wie ein Hauptstrang erkennen, der mit The Minikins of Yam (1976; dt. Die tanzenden Zwerge von Yam (1980)) im alten Ägypten beginnt, über die im minoischen Kreta spielende Minotaur Trilogy – Cry Silver Bells (1977; dt. Der letzte Minotaurus (1980)), The Forest of Forever (1971; dt. Der letzte Minotaur (1977)) und Day of the Minotaur (1966) – zu Moondust (1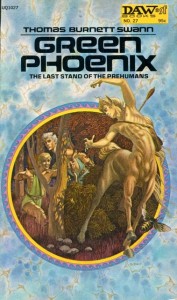 968; hier ist das biblische Jericho der Schauplatz) und weiter zu der an Vergils Aeneis angelehnten Latium Trilogy – Queens Walk in the Dusk (1977; die tragische Geschichte von Dido und Aeneas), Green Phoenix (1972; dt. Der grüne Phönix (1978)) und Lady of the Bees (1976; dt. Die Bienenkönigin (1979)) – führt, und dann weiter zu Wolfwinter (1972; eine Geschichte über Sappho und italische Faune und in gewisser Hinsicht ein Brückenschlag zwischen griechischer und römischer Antike) und The Weirwoods (1965 bzw. 1967; hier droht den Bewohnern der etruskischen Wälder das gleiche Schicksal wie ihren Verwandten auf Kreta), um nur die Romane zu nennen. In The Gods Abide (1976; dt. Die heimlichen Götter (1980)) verlassen die magischen Geschöpfe im vierten nachchristlichen Jahrhundert den Mittelmeerraum, da zu diesem Zeitpunkt das Christentum hier endgültig gesiegt hat, und fliehen auf die britischen Inseln, wo wir sie mehr als tausend Jahre später in Will-O-The-Wisp (1974 bzw. 1976; dt. Der goldene Riese (1978)) und The Not-World (1975; dt. Die Nicht-Welt (1977)) in abgelegenen, versteckten Enklaven – wenn auch nur noch als Schatten ihrer selbst – wiederfinden.
968; hier ist das biblische Jericho der Schauplatz) und weiter zu der an Vergils Aeneis angelehnten Latium Trilogy – Queens Walk in the Dusk (1977; die tragische Geschichte von Dido und Aeneas), Green Phoenix (1972; dt. Der grüne Phönix (1978)) und Lady of the Bees (1976; dt. Die Bienenkönigin (1979)) – führt, und dann weiter zu Wolfwinter (1972; eine Geschichte über Sappho und italische Faune und in gewisser Hinsicht ein Brückenschlag zwischen griechischer und römischer Antike) und The Weirwoods (1965 bzw. 1967; hier droht den Bewohnern der etruskischen Wälder das gleiche Schicksal wie ihren Verwandten auf Kreta), um nur die Romane zu nennen. In The Gods Abide (1976; dt. Die heimlichen Götter (1980)) verlassen die magischen Geschöpfe im vierten nachchristlichen Jahrhundert den Mittelmeerraum, da zu diesem Zeitpunkt das Christentum hier endgültig gesiegt hat, und fliehen auf die britischen Inseln, wo wir sie mehr als tausend Jahre später in Will-O-The-Wisp (1974 bzw. 1976; dt. Der goldene Riese (1978)) und The Not-World (1975; dt. Die Nicht-Welt (1977)) in abgelegenen, versteckten Enklaven – wenn auch nur noch als Schatten ihrer selbst – wiederfinden.
Ein bisschen abseits dieses Hauptstrangs angesiedelt sind How Are the Mighty Fallen (1974; eine Geschichte, die im biblischen Judäa zur Zeit König Sauls spielt und in der es nicht nur um die Auseinandersetzung zwischen Jahwe- und Astarte-Gläubigen, sondern auch um eine homoerotische Liebesbeziehung geht), The Tournament of Thorns (1976; ein aus zwei längeren Erzählungen entstandener, im Mittelalter spielender Roman) und The Goat Without Horns (1970 bzw. 1971; dt. 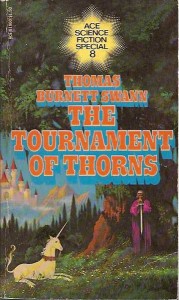 Prinzessin der Haie (1979), eine im 19. Jahrhundert in der Karibik spielende Geschichte um eine nach viktorianischen Maßstäben ziemlich unmögliche Liebe, einen mörderischen, ganz besonderen Hai und einen klugen Delphin).
Prinzessin der Haie (1979), eine im 19. Jahrhundert in der Karibik spielende Geschichte um eine nach viktorianischen Maßstäben ziemlich unmögliche Liebe, einen mörderischen, ganz besonderen Hai und einen klugen Delphin).
Der letztgenannte ist vielleicht Swanns schwächster Roman, wie generell seine “moderneren” (d.h. die im 17., 18. und 19. Jahrhundert angesiedelten) Romane schwächer sind als jene Werke, die die Antike zum Schauplatz haben. Oder, um es positiv auszudrücken: wer Swanns beste Werke lesen will, sollte zur Minotaur oder Latium Trilogy, zu Wolfwinter oder How Are the Mighty Fallen greifen, oder auch zu Geschichten wie “Where is the Bird of Fire?” (sozusagen die Essenz von Lady of the Bees und dem aus ihr entstandenen Roman absolut gleichwertig) oder “The Manor of Roses” (eine für den Hugo Award nominierte Erzählung, die später in The Tournament of Thorns aufgegangen ist), oder auch – wenn er oder sie über eine ähnlich sentimentale Ader verfügt wie der Verfasser dieser Zeilen – zu “Bear” (die vom tragischen Schicksal eines gutherzigen, aber ein bisschen einfältigen Bären erzählt). In all diesen Romanen und Geschichten wird man – so man sich auf sie einlässt – eine ähnliche Atmosphäre finden, eine mal mehr, mal weniger melancholische Grundstimmung, die allerdings fast immer Raum für gelegentliche heitere Momente lässt. Was durchaus ein bisschen erstaunlich ist, denn Thomas Burnett Swann hat in den so überaus produktiven letzten Jahren seines Lebens an einer Krebserkrankung gelitten, der er am 05. Mai 1976 im Alter von gerade einmal 47 Jahren erlegen ist. Queens Walk in the Dusk, seinen letzten Roman, hat er quasi auf dem Totenbett geschrieben. Sein nächstes Projekt wäre ein Roman über die biblische Ruth gewesen, und niemand weiß, was er sonst noch vielleicht alles zu Papier gebracht hätte.
Wie im Text erkennbar, sind von 1977 bis 1980 mehrere von Swanns Romanen auf Deutsch erschienen, ebenso eine seiner beiden Kurzgeschichtensammlungen (Where is the Bird of Fire? (1970) als Der Feuervogel (1979)); was die Freude daran allerdings spürbar mindert, sind die teilweise nicht sonderlich geglückten Übersetzungen, die Swanns poetischem Stil und der trotz aller Melancholie häufig heiteren, Lebensfreude vermittelnden Atmosphäre der Originale nur selten gerecht werden. Doch so wünschenswert adäquate Neuübersetzungen auch wären, so unwahrscheinlich und – mit Blick auf den derzeitigen Publikumsgeschmack bzw. die derzeit angesagten Themen, Motive und erzählerischen Standards – wenig erfolgversprechend dürften sie sein.
Bibliotheka Phantastika gratuliert John Gwynne, der heute 45 Jahre alt wird. Allzuviel lässt sich über den am 21. September 1968 in Singapur geborenen, mittlerweile in Eastbourne in der englischen Grafschaft East Sussex lebenden John Gwynne noch nicht sagen, denn er zählt zur Riege aufstrebender us-amerikanischer und britischer Autoren, die erst vor kurzem – und meistens mit dem Auftaktband eines mehr oder weniger epischen, häufig dem Grim & Gritty oder auch Grimdark genannten Subgenre zuneigenden Fantasyzyklus – auf der Bildfläche erschienen sind. Auch Malice (2012) scheint auf den ersten Blick in diese Kategorie zu gehören, doch bei genauerem Hinsehen ändert sich dieser Eindruck. Denn der umfangreiche Roman ist zwar einerseits der Auftakt eines wohl auf vier Bände angelegten Mehrteilers – The Faithful and the Fallen –, steht aber inhaltlich und von der Figurenkonstellation her deutlich in der Tradition “klassischer” High Fantasy:
Als die Menschen vor langer Zeit nach dem Götterkrieg in die Banished Lands flohen, mussten sie die dort lebenden Riesen niederringen, was ihnen schließlich auch gelang. Doch jetzt rühren sich die besiegten Gegner von einst erneut, Lindwürmer werden gesichtet, und es mehren sich die Zeichen, dass ein neuer Krieg bevorsteht, in dem auch die Götter wieder mitmischen werden. Obwohl eine düstere 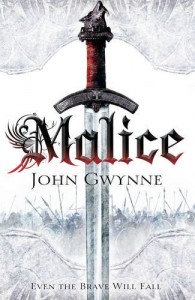 Prophezeiung die Situation noch bedrohlicher macht, gelingt es Hochkönig Aquilus nicht, die ihm nominell unterstehenden Könige zum gemeinsamen Handeln zu bringen. Und so kommt es, dass einfachen Menschen wie Corban, dem jungen Sohn eines Schmiedes, plötzlich unerwartete Aufgaben zufallen …
Prophezeiung die Situation noch bedrohlicher macht, gelingt es Hochkönig Aquilus nicht, die ihm nominell unterstehenden Könige zum gemeinsamen Handeln zu bringen. Und so kommt es, dass einfachen Menschen wie Corban, dem jungen Sohn eines Schmiedes, plötzlich unerwartete Aufgaben zufallen …
Riesen und Drachen, ein junger Held, der mehr ist, als er scheint, Prophezeiungen und archetypische Figuren sowie Elemente und Motive aus keltischen und christlichen Sagen und Legenden sind die Bestandteile von John Gwynnes Erstling, die – neben dem jugendlichen Alter eines Großteils der Hauptfiguren – dafür sorgen, dass Malice sich eher als alles andere wie ein bestimmter Typus 80er-Jahre-Fantasy (und auch ein bisschen wie ein – wenn auch ungewöhnlich dickes – Jugendbuch) anfühlt. Was wiederum zur Folge hat, dass gerade erfahreneren Fantasyafficionados vieles sehr vertraut vorkommen dürfte. Das ist per se nichts Schlechtes und kann vor allem für Leser und Leserinnen, die das Genre erst vor kurzem für sich entdeckt haben, aber nicht unbedingt ihre tägliche Dosis grim & gritty brauchen, durchaus ein Anreiz sein. Um zu beurteilen, inwieweit die Mischung aus klassischen Fantasymotiven und einer modernen Erzählweise bzw. -struktur letztlich trägt, müsste man auf alle Fälle mindestens den zweiten Band des Zyklus – der unter dem Titel Valor für Anfang nächsten Jahres angekündigt ist – noch abwarten, denn in Malice beginnt die Geschichte sich gerade erst zu entfalten.
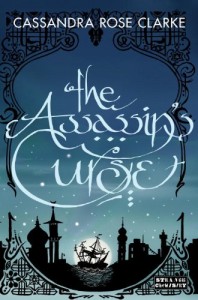 Außerdem gratulieren wir Cassandra Rose Clarke, die heute 30 Jahre alt wird. Die Fantasy- und Science-Fiction-Autorin wurde am 21. September 1983 in Texas geboren und veröffentlichte erst im letzten Jahr ihren Debütroman The Assassin’s Curse, in dem es um Piratenabenteuer, Wüstenwanderungen, Auftragsmord und einen unlösbaren Fluch geht.
Außerdem gratulieren wir Cassandra Rose Clarke, die heute 30 Jahre alt wird. Die Fantasy- und Science-Fiction-Autorin wurde am 21. September 1983 in Texas geboren und veröffentlichte erst im letzten Jahr ihren Debütroman The Assassin’s Curse, in dem es um Piratenabenteuer, Wüstenwanderungen, Auftragsmord und einen unlösbaren Fluch geht.
Da wir für Interessierte auch ein neues Portrait zu dieser Autorin – die sowohl Jugendbücher als auch Romane für Erwachsene schreibt – in der Bibliothek haben, beschränken wir uns hier kurz und knapp auf herzliche Glückwünsche!
Bibliotheka Phantastika gratuliert George R.R. Martin, der heute 65 Jahre alt wird. Im Gegensatz zu so manch anderen Autoren und Autorinnen, denen wir an dieser Stelle zum Geburtstag gratuliert oder an die bzw. deren Werk wir erinnert haben, dürfte der am 20. September 1948 in Bayonne, New Jersey, geborene George Raymond Richard Martin auch hier in Deutschland spätestens seit der Ausstrahlung der TV-Serie Game of Thrones nicht nur der Fantasyleserschaft, sondern auch ansonsten nicht primär an Fantasy interessierten Lesern und Leserinnen ein Begriff sein. Da es außerdem über den der TV-Serie zugrundeliegenden Fantasyzyklus mit dem klangvollen Titel A Song of Ice and Fire bzw. Das Lied von Eis und Feuer mehr als genug Material im Internet zu finden gibt, haben wir uns entgegen unserer sonstigen Vorgehensweise entschlossen, in diesem Fall nicht Martins Fantasy, sondern seine anderen Werke in den Mittelpunkt einer kurzen, zwangsläufig kursorischen Betrachtung zu stellen. Denn schon lange bevor GRRM sich mit A Game of Thrones, dem ersten ASoIaF-Band, ernsthaft der Fantasy zuwandte, hatte er sich mit etlichen hervorragenden, größtenteils der SF zuzurechnenden Erzählungen (und ein paar Romanen) einen Namen gemacht und galt zeitweise als eine der größten Hoffnungen des Genres.
George R.R. Martins erste professionelle Veröffentlichung war “The Hero”* (1971) in der Februar-Ausgabe des SF-Magazins Galaxy. Diese und eine ganze Reihe weiterer kurzer und längerer, teils preisgekrönter Geschichten – wie etwa “With Morning Comes Mistfall” (1973), “A Song for Lya” (1974), “And Seven Times Never Kill Man” (1975), “The Stone City” (1977), “Sandkings” (1979) oder “Nightflyers” (1980), um nur die herausragendsten zu nennen – spielen vor einem gemeinsamen Hintergrund, einer nie genauer definierten, als The Thousand Worlds oder auch The Manrealm bezeichneten Future History. Ebenfalls Teil dieser Future History ist 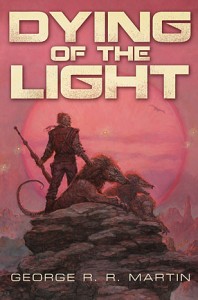 Dying of the Light (1977; dt. Die Flamme erlischt (1978)), Martins erster Roman. Er erzählt die Geschichte Dirk t’Lariens, der eine Nachricht seiner ehemaligen Geliebten Gwen erhält und nach Worlorn reist, einem einsamen Planeten am Rand des besiedelten Bereichs der Galaxis. Worlorn ist ein Irrläufer, der sonnenlos durchs All torkelt; als er kurzfristig in den Einflussbereich einer Sonne gerät, nutzen ihn die Zivilisationen des Randes, um dort ein Festival abzuhalten. Doch als Dirk nach Worlorn kommt, ist der Planet schon längst wieder verlassen. Nur die Städte sind geblieben, die für das Festival gebaut wurden, und sie und der Planet selbst bilden die Kulisse für eine Geschichte, die sich um Liebe und Ehre, um Selbstlügen und kulturelle Zwänge dreht, denn die Gwen von heute ist nicht mehr die Gwen, an die Dirk sich erinnert, und ihre Beziehung zu zwei Männern von High Kavalaar, einer Welt, deren Kultur von einem rigiden Ehrenkodex dominiert wird, ist nur eines der Probleme, denen Dirk t’Larien sich gegenübersieht. Trotz mancher Schwächen ist Dying of the Light ein wunderbarer, atmosphärischer romantischer Roman, in dem das Setting eine beinahe ebenso große (und ebenso überzeugende) Rolle spielt wie die Figuren, und in dem der Einfluss des von Martin bewunderten Jack Vance deutlich spürbar ist.
Dying of the Light (1977; dt. Die Flamme erlischt (1978)), Martins erster Roman. Er erzählt die Geschichte Dirk t’Lariens, der eine Nachricht seiner ehemaligen Geliebten Gwen erhält und nach Worlorn reist, einem einsamen Planeten am Rand des besiedelten Bereichs der Galaxis. Worlorn ist ein Irrläufer, der sonnenlos durchs All torkelt; als er kurzfristig in den Einflussbereich einer Sonne gerät, nutzen ihn die Zivilisationen des Randes, um dort ein Festival abzuhalten. Doch als Dirk nach Worlorn kommt, ist der Planet schon längst wieder verlassen. Nur die Städte sind geblieben, die für das Festival gebaut wurden, und sie und der Planet selbst bilden die Kulisse für eine Geschichte, die sich um Liebe und Ehre, um Selbstlügen und kulturelle Zwänge dreht, denn die Gwen von heute ist nicht mehr die Gwen, an die Dirk sich erinnert, und ihre Beziehung zu zwei Männern von High Kavalaar, einer Welt, deren Kultur von einem rigiden Ehrenkodex dominiert wird, ist nur eines der Probleme, denen Dirk t’Larien sich gegenübersieht. Trotz mancher Schwächen ist Dying of the Light ein wunderbarer, atmosphärischer romantischer Roman, in dem das Setting eine beinahe ebenso große (und ebenso überzeugende) Rolle spielt wie die Figuren, und in dem der Einfluss des von Martin bewunderten Jack Vance deutlich spürbar ist.
Auch die zuerst fast ausschließlich in Analog erschienenen und schließlich unter dem Titel Tuf Voyaging (1986; dt. Planetenwanderer (2013)) gesammelten Geschichten um den exzentrischen kahlköpfigen Albino und Sonderling Haviland Tuf gehören ins Universum der Thousand Worlds und weisen deutliche Jack-Vance-Einflüsse auf. Tuf, der durch Zufall an eine Arche (ein Saatschiff des längst vergessenen und vergangenen Ecological Engineering Corps der alten Erde) gerät, nutzt die schier unglaublichen Möglichkeiten des Schiffs, um ein bisschen Gott zu spielen, wenn man ihn darum bittet. Wobei allerdings immer wieder deutlich wird, dass man sich seine Wünsche – und vor allem die Konsequenzen, die ihre Erfüllung haben können – gut überlegen sollte.
Natürlich hat George R.R. Martin auch Geschichten geschrieben, die nichts mit seiner Future History zu tun haben, erwähnt seien an dieser Stelle nur “The Second Kind of Loneliness” (1972) oder der Hugo und Locus-Award-Gewinner “The Way of Cross and Dragon” (1979) – die man nebenbei bemerkt HIER online lesen kann – oder auch die deutliche Horror-Einflüsse aufweisenden “Meathouse Man” (1976), “Remembering Melody” (1981) oder “The Monkey Treatment” (1983). Und er hat sich bereits zu diesem Zeitpunkt an Fantasy versucht: “The Lonely Songs of Laren Dorr” (1976 – eine Geschichte um ein zwischen den Welten reisendes junges Mädchen, das mit allerlei Widrigkeiten fertig werden muss), “The Ice Dragon” (1980 – eine Geschichte, in der sich bereits viele Elemente von ASoIaF finden lassen) und “In the Lost Lands” (1982 – eine ziemlich böse, märchenhafte Geschichte) beweisen, dass er schon damals ein gutes Händchen für Fantasy hatte.
Doch im Großen und Ganzen ist er in den 70ern und frühen 80ern hauptsächlich der SF treu geblieben und hat zusammen mit Lisa Tuttle seinen zweiten Roman Windhaven (1981; dt. Sturm über Windhaven (1985)) verfasst. Auf Windhaven, einer von gestrandeten Raumfahrern besiedelten, fast vollkommen von Ozeanen bedeckten Welt, wird die Kommunikation von den sogenannten Fliegern – das sind Menschen, die die mit einfachen Gleitflugapparaturen durch die strürmische Atmosphäre Windhavens (nomen es omen) von einem Inselchen zum anderen fliegen – aufrechterhalten. Doch es ist schwierig, in die Gilde dieser Flieger hineinzukommen, wenn man zu den verachteten Muschelsuchern gehört, wie die junge Maris feststellen muss … Windhaven ist ein netter Abenteuerroman, aber von GRRMs längeren Arbeiten sicher sein schwächstes Werk.
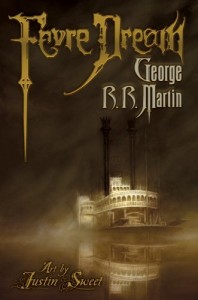 Vor allem verglichen mit Fevre Dream (1982; dt. Fiebertraum (1991) oder auch Dead Man River (2006)) und The Armageddon Rag (1983; dt. Armageddon-Rock (1986)), den beiden Romanen, die er kurz danach veröffentlichte. Fevre Dream ist ein Vampirroman, der im 19. Jahrhundert größtenteils auf dem Mississippi bzw. an Bord des Schaufelraddampfers Fevre Dream spielt und – verkürzt dargestellt – den Kampf zweier rivalisierender Vampirclan-Oberhäupter schildert. Der Roman lebt einerseits von seiner eigentlichen Hauptfigur, dem Raddampferkapitän Abner Marsh, für den sich mit dem Bau der Fevre Dream ein Lebenstraum erfüllt (der leider alsbald zum Alptraum wird), andererseits von der schwülen Südstaatenatmosphäre und der Darstellung des Lebens auf dem Fluss, und last but not least von den beiden sehr gegensätzliche Ziele verfolgendenden und sehr unterschiedlich mit den Menschen umgehenden Obervampiren (die nicht glitzern). All das macht Fevre Dream zu einem der wenigen Vampirromane, die man wirklich gelesen haben sollte.
Vor allem verglichen mit Fevre Dream (1982; dt. Fiebertraum (1991) oder auch Dead Man River (2006)) und The Armageddon Rag (1983; dt. Armageddon-Rock (1986)), den beiden Romanen, die er kurz danach veröffentlichte. Fevre Dream ist ein Vampirroman, der im 19. Jahrhundert größtenteils auf dem Mississippi bzw. an Bord des Schaufelraddampfers Fevre Dream spielt und – verkürzt dargestellt – den Kampf zweier rivalisierender Vampirclan-Oberhäupter schildert. Der Roman lebt einerseits von seiner eigentlichen Hauptfigur, dem Raddampferkapitän Abner Marsh, für den sich mit dem Bau der Fevre Dream ein Lebenstraum erfüllt (der leider alsbald zum Alptraum wird), andererseits von der schwülen Südstaatenatmosphäre und der Darstellung des Lebens auf dem Fluss, und last but not least von den beiden sehr gegensätzliche Ziele verfolgendenden und sehr unterschiedlich mit den Menschen umgehenden Obervampiren (die nicht glitzern). All das macht Fevre Dream zu einem der wenigen Vampirromane, die man wirklich gelesen haben sollte.
The Armageddon Rag schließlich ist vordergründig ein Krimi mit mal mehr, mal weniger starken phantastischen Untertönen, vor allem aber ist er eine Art Meditation über die Rockmusik der 60er und die mit ihr verbundene Ära. Vielleicht muss man – wie der Verfasser dieser Zeilen – in seiner Jugend auch von Konzert zu Konzert gereist sein, muss die Magie gespürt haben, die entstehen konnte, wenn Tausende von Gleichgesinnten von den Tönen und Melodien, die von der Bühne da oben kamen, getragen wurden – wohin auch immer. Wer das jemals erlebt hat, für den wird die Geschichte des ehemaligen Hippie-Journalisten Sandy Blair, der sich anlässlich der Ermordung eines Rockpromoters auf die Suche nach den ehemaligen Mitgliedern der vor zehn Jahren auseinandergegangenen Band Nazgûl begibt, die zu einer Begegnung mit seiner eigenen Vergangenheit (und den mit ihr verbundenen Träumen) wird, eine ganze Menge bereithalten. Und das bezieht sich nicht nur auf den anscheinend auf mysteriöse Weise wiedergeborenen Ex-Leadsänger der Nazgûl, sondern auch auf Konzertbeschreibungen und die Vermittlung eines Lebensgefühls, das inzwischen längst Vergangenheit ist. Bedauerlicherweise war The Armageddon Rag – das Buch, das eigentlich Martins Breakthrough Book werden sollte – ein gigantischer Flop, der seine Karriere als Romanautor mehr oder weniger zerstört hat. Zumindest dreizehn Jahre lang.
Über die bereits genannten Werke hinaus – zu denen noch die bisher nicht erwähnten Kurzgeschichtensammlungen A Song for Lya and Other Stories (1976), Songs of Stars and Shadows (1977), Sandkings (1981), Songs the Dead Men Sing (1983), Nightflyers (1985), Portraits of His Children (1987), Quartet (2001), Dreamsongs (2003, auch in zwei Bänden als Vol. I und II (2006) erschienen) und Starlady and Fast-Friend (2008) zu zählen sind – hat George R.R. Martin noch etliche weitere Stories verfasst sowie ab 1987 (mit Unterbrechungen) mittlerweile mehr als 20 Bände der Shared-World-Serie Wild Cards herausgegeben und Geschichten zu ihr beigesteuert (Wild Cards spielt auf einer Parallelwelt, auf der es Menschen mit Superkräften gibt). Außerdem hat er seine alte Leidenschaft als Herausgeber von Anthologien wiederentdeckt (er war in dieser Hinsicht schon in den 70ern aktiv) und zusammen mit Gardner Dozois mehrere Anthologien herausgegeben. Pars pro toto sei die vielleicht interessanteste der bisher erschienen genannt: Songs of the Dying Earth: Stories in Honor of Jack Vance (2009).
Der George R.R. Martin der 70er und frühen 80er Jahre ist nur begrenzt mit dem Autor von ASoIaF zu vergleichen. Das sollten vor allem die Leser und Leserinnen bedenken, die ihn bisher nur durch seinen Fantasy-Zyklus kennengelernt haben. Trotzdem (oder vielleicht auch gerade deswegen) kann sich ein Blick in die Werke, die GRRM vor dem Lied geschaffen hat, als überaus lohnend erweisen.
* – aus Übersichtlichkeitsgründen wurde bei den Kurzgeschichten und Sammelbänden auf die Nennung der deutschen Titel verzichtet; bei Bedarf kann das in einem Kommentar aber nachgeholt werden
Bibliotheka Phantastika gratuliert Lynn Abbey, die heute 65 Jahre alt wird. Ihre ersten schriftstellerischen Gehversuche machte die am 18. September 1948 in Peekskill im us-amerikanischen Bundesstaat New York geborene Lynn (eigentlich Marilyn Lorraine) Abbey 1979 mit der Kurzgeschichte “The Face of Chaos” in der ersten Thieves’-World-Anthologie (die den gleichen Titel wie die ganze Reihe hatte), und sie ist diesem Shared-World-Projekt auch in den Folgejahren treugeblieben, hat für die Bände II-IV jeweils eine Geschichte beigesteuert und die Reihe ab 1983 schließlich mit herausgegeben. In der Folgezeit hat sie sich ein paar Jahre lang fast ausschließlich mit Thieves’ World und anderen Franchise-Produkten befasst; kurz zuvor hatte sie allerdings noch drei Romane geschrieben, die bis heute zu ihren besten zu zählen sind.
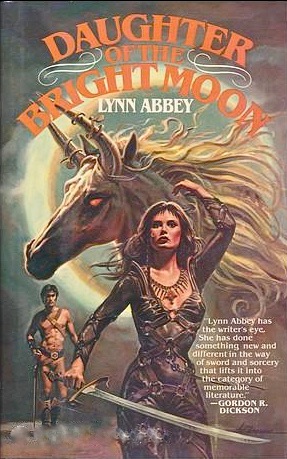 Zwei davon – Daughter of the Bright Moon (1979) und The Black Flame (1980) – sind vor allem wegen ihrer Hauptfigur interessant, denn mit Rifkind hat Lynn Abbey hier eine Heldin geschaffen, wie man sie im Genre weder vorher noch nachher oft gesehen hat. In Daughter of the Bright Moon lernen wir Rifkind kennen, die ihre Heimat, die Wüste von Asheera, verlassen muss, nachdem ihr Stamm getötet wurde. Immerhin besitzt sie hervorragende Voraussetzungen, eine Reise ins ferne Dro Daria zu überleben, denn als Tochter des Stammesoberhaupts hat sie von Kindheit an gelernt, mit Waffen umzugehen; darüber hinaus ist sie eine empathische Heilerin und als Auserwählte der Mondgöttin des Titels auch eine mächtige Magierin. Und dann ist da noch Turin, ihr gehörntes Schlachtross, mit dem sie sich telepathisch verständigen kann. Doch trotz all dieser Vorzüge ist Rifkind alles andere als eine Mary Sue, das verhindern ihr rauer und keineswegs herzlicher Ton und ihr ungehobeltes Verhalten – Eigenschaften, die es ihr im feudalistisch geprägten Dro Daria nicht unbedingt leicht machen. Schon gar nicht, da dort eine Verschwörung im Gange ist und Rifkind auf einen Gegner stößt, mit dem sie ohnehin noch eine Rechnung offen hatte …
Zwei davon – Daughter of the Bright Moon (1979) und The Black Flame (1980) – sind vor allem wegen ihrer Hauptfigur interessant, denn mit Rifkind hat Lynn Abbey hier eine Heldin geschaffen, wie man sie im Genre weder vorher noch nachher oft gesehen hat. In Daughter of the Bright Moon lernen wir Rifkind kennen, die ihre Heimat, die Wüste von Asheera, verlassen muss, nachdem ihr Stamm getötet wurde. Immerhin besitzt sie hervorragende Voraussetzungen, eine Reise ins ferne Dro Daria zu überleben, denn als Tochter des Stammesoberhaupts hat sie von Kindheit an gelernt, mit Waffen umzugehen; darüber hinaus ist sie eine empathische Heilerin und als Auserwählte der Mondgöttin des Titels auch eine mächtige Magierin. Und dann ist da noch Turin, ihr gehörntes Schlachtross, mit dem sie sich telepathisch verständigen kann. Doch trotz all dieser Vorzüge ist Rifkind alles andere als eine Mary Sue, das verhindern ihr rauer und keineswegs herzlicher Ton und ihr ungehobeltes Verhalten – Eigenschaften, die es ihr im feudalistisch geprägten Dro Daria nicht unbedingt leicht machen. Schon gar nicht, da dort eine Verschwörung im Gange ist und Rifkind auf einen Gegner stößt, mit dem sie ohnehin noch eine Rechnung offen hatte …
Daughter of the Bright Moon ist in vielerlei Hinsicht ein recht gelungener Sword-&-Sorcery-Roman mit einer zwar nicht unbedingt sympatischen, aber durchaus glaubhaften Heldin, die zudem den Pluspunkt aufweist, eine der wenigen echten kick-ass heroines zu sein, mit denen das Genre aufwarten kann. Dass die meisten anderen Charaktere neben Rifkind ein bisschen verblassen, fällt dabei nicht sonderlich ins Gewicht – weniger jedenfalls als im Folgeband The Black Flame, wo nicht nur die in Daughter sehr zurückgenommene Liebesgeschichte eine wesentlich prominentere Rolle spielt, sondern auch die Götterwelt stärker ins Geschehen eingreift. Das Ergebnis ist immer noch lesbar, kommt aber an den ersten Band – der immerhin ganz nebenbei auch Genderfragen und Rassismus thematisiert – nicht heran.
Mit The Guardians (1982), ihrem dritten Roman, hat Lynn Abbey dann Neuland betreten, denn bei diesem Roman handelt es sich um Urban Fantasy (in der Form, wie der Begriff vor der Vampir-Invasion verstanden wurde), und er erzählt eine Geschichte über Risse in der Wirklichkeit, die in andere Welten führen, über Wicca-Magie und über eine junge New Yorkerin, die einfach dadurch, dass sie ein günstiges Apartment mietet, in einen großen Schlamassel gerät.
Ab 1983 konzentrierte Lynn Abbey sich wie bereits erwähnt zunächst auf die Arbeit an den Thieves’-World-Anthologien. Ab Mitte der 80er Jahre hat sie darüberhinaus als Autorin und Mitherausgeberin an zwei Anthologien mit Geschichten zur Comicserie Elfquest mitgewirkt, mit Unicorn & Dragon (1987) und Conquest (1988) zwei Artus-Romane geschrieben, sich Anfang der 90er an zwei Romanen zur Ultima Saga versucht und später Romane zu diversen Franchise-Universen verfasst. Eigenständige Werke in dieser Zeit waren der Valensor-Zweiteiler (The Wooden Sword (1991) und Beneath the Web (1994)) und die Einzelromane Siege of Shadows (1996) und JerLayne (1999).
Von 2001 bis 2005 folgte dann die bisher vierteilige Emma-Merrigan- bzw. Orion’s-Children-Reihe, ehe sie sich mit Rifkind’s Challenge (2006) nach mehr als 25 Jahren noch einmal ihrer ersten und immer noch überzeugendsten und interessantesten Heldin zuwandte. Seither sind anscheinend keine neuen Romane mehr von ihr erschienen, aber ob Lynn Abbey ihre Schrifststellerkarriere tatsächlich beendet hat oder nur eine Weile pausiert, wird erst die Zukunft weisen.
Bibliotheka Phantastika gratuliert Steven Bauer, der heute 65 Jahre alt wird. Der am 10. September 1948 in Newark, New Jersey, geborene Steven Bauer hatte bereits etliche Gedichte in Literaturzeitschriften veröffentlicht und sich eine beträchtliche Reputation als Dichter erworben, als mit Satyrday (1980) sein erster und – abgesehen von einer Filmnovelisation und zwei Kinderbüchern – bislang auch einziger Roman auf den Markt kam. Und dass sein Verfasser zuallererst ein Dichter ist, merkt man dem – auf dem Cover treffenderweise mit “a fable” untertitelten – Roman auch an, denn zumindest im Original wartet Satyrday z.B. bei Landschafts- und Szenenbeschreibungen mit einer unglaublich stimmungsvollen, poetischen Sprache auf, die aber auch sehr präzise werden kann, wenn es darum geht, die glaubwürdig gezeichneten Figuren etwa mittels ihrer Dialoge zu charakterisieren.
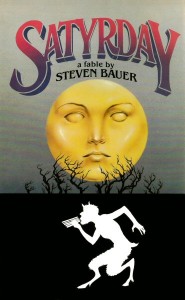 Wer hingegen nach einem ausgefeilten Worldbuilding sucht, wird in dem auf Deutsch als Satyrtag* (1987) erschienenen (und nebenbei bemerkt von Denis Scheck – ja, dem Denis Scheck – übersetzten) Roman ebensowenig fündig werden wie alle diejenigen, die Erklärungen und Begründungen dafür brauchen, warum die Dinge sind, wie sie sind. Und wie sind sie denn nun, die Dinge? Alles beginnt damit, dass ein riesiger Uhu seine Helfer, die Raben, ausschickt, um den Mond gefangenzunehmen, denn ohne ihr nächtliches Gegenstück wird auch die Sonne bald vergehen – und dann hätte der Uhu sein Ziel erreicht, die Welt in ewige Finsternis zu hüllen. Natürlich gelingt der üble Plan, doch als bald darauf das Licht der Sonne – die sich auf eine vergebliche Suche nach ihrer Schwester begeben hat – schwächer wird und die Welt sich zu verändern beginnt, bricht eine kleine Gruppe tapferer Gefährten auf, um die Dinge wieder in Ordnung zu bringen: Matthew, der Faun, dessen Mündel Derin, der Menschenjunge, den er einst auf seiner Schwelle gefunden hat, Deirdre, eine abtrünnige Krähe, und Vera, die meistens eine Silberfüchsin ist, gelegentlich aber auch die Gestalt einer Nymphe annehmen kann. Unterwegs begegnen ihnen viele andere Kreaturen; manche sind ihnen freundlich gesonnen, andere – wie die bereits erwähnten Raben oder auch die Falken, die ebenfalls zu den Helfershelfern des Uhu zählen – feindlich, und bei manchen lässt sich das nicht auf Anhieb sagen …
Wer hingegen nach einem ausgefeilten Worldbuilding sucht, wird in dem auf Deutsch als Satyrtag* (1987) erschienenen (und nebenbei bemerkt von Denis Scheck – ja, dem Denis Scheck – übersetzten) Roman ebensowenig fündig werden wie alle diejenigen, die Erklärungen und Begründungen dafür brauchen, warum die Dinge sind, wie sie sind. Und wie sind sie denn nun, die Dinge? Alles beginnt damit, dass ein riesiger Uhu seine Helfer, die Raben, ausschickt, um den Mond gefangenzunehmen, denn ohne ihr nächtliches Gegenstück wird auch die Sonne bald vergehen – und dann hätte der Uhu sein Ziel erreicht, die Welt in ewige Finsternis zu hüllen. Natürlich gelingt der üble Plan, doch als bald darauf das Licht der Sonne – die sich auf eine vergebliche Suche nach ihrer Schwester begeben hat – schwächer wird und die Welt sich zu verändern beginnt, bricht eine kleine Gruppe tapferer Gefährten auf, um die Dinge wieder in Ordnung zu bringen: Matthew, der Faun, dessen Mündel Derin, der Menschenjunge, den er einst auf seiner Schwelle gefunden hat, Deirdre, eine abtrünnige Krähe, und Vera, die meistens eine Silberfüchsin ist, gelegentlich aber auch die Gestalt einer Nymphe annehmen kann. Unterwegs begegnen ihnen viele andere Kreaturen; manche sind ihnen freundlich gesonnen, andere – wie die bereits erwähnten Raben oder auch die Falken, die ebenfalls zu den Helfershelfern des Uhu zählen – feindlich, und bei manchen lässt sich das nicht auf Anhieb sagen …
Satyrday ist ohne Frage eine “kleine” und “leise” Geschichte und bedient sich einerseits vieler fantasytypischer Motive (die aber nicht immer den Erwartungen gemäß umgesetzt werden – so ist z.B. Matthew längst nicht so lüstern, wie es Seinesgleichen sonst gerne nachgesagt wird), wirkt aber andererseits sprachlich und erzählerisch beinahe wie ein gestaltgewordener Traum. Aber auch Träume können gefährlich sei – und in manchen wird sogar gestorben …
Dem Roman war kein sonderlich großer Erfolg beschieden, doch das allein war sicher nicht der Grund, warum Steven Bauer danach – von der bereits erwähnten Novelisation einmal abgesehen – keinen “richtigen” Roman mehr, sondern nur noch zwei Kinderbücher (und die auch erst 1999 bzw. 2000) veröffentlicht hat. Denn schreiben konnte er immer noch, was man anhand der Geschichten in den beiden 1986 erschienenen Sammelbänden Steven Spielberg’s Amazing Stories (1986; dt. Steven Spielberg’s unglaubliche Geschichten (1987)) und Volume II of Steven Spielberg’s Amazing Stories (1986; dt. Steven Spielberg’s neue unglaubliche Geschichten (1988)) feststellen kann, bei denen es sich um Nacherzählungen von Episoden der TV-Serie Amazing Stories handelt. Natürlich kommen die an Satyrday nicht ran, aber sie sind kompetent und stimmig erzählt. Was auch immer der Grund gewesen sein mag, warum Steven Bauer sich nach seinem durchaus gelungenen Erstling dem Genre nie mehr in Romanform bzw. mit genuinen Stoffen zugewandt hat – vielleicht wird er das Problem ja eines Tages hinter sich lassen. Immerhin soll er sich vor kurzem aus dem universitären Lehrbetrieb zurückgezogen haben und seit einiger Zeit an einem (allerdings anscheinend nicht phantastischen) Roman arbeiten. Von daher bleibt abzuwarten, ob er ein One-Book-Wonder (zumindest im Bereich der phantastischen Literatur) bleiben wird, oder ob vielleicht doch noch etwas kommt.
* – auf dem Cover steht lustigerweise Satyrs Tag
Bibliotheka Phantastika erinnert an Richard Burns, der heute 55 Jahre alt geworden wäre. Über den am 01. September 1958 in Sheffield, England, geborenen Richard Burns lässt sich heutzutage selbst im ansonsten schier allwissenden Internet kaum noch etwas finden, da die Spuren, die er hinterlassen haben mag, größtenteils von anderen Personen mit dem gleichen Namen überdeckt werden. Sicher ist immerhin, dass er mit seinem ersten Roman A Dance for the Moon (1986) – in dem es um die traumatischen Auswirkungen geht, die die Erfahrungen des Ersten Weltkriegs bei seinem Protagonisten hinterlassen haben – den Jonathan Cape First Novel Contest gewonnen hat und 1987 im Sunday Express neben u.a. Jeanette Winterson und Kazuo Ishiguro auf einer Liste mit vielsprechenden jungen Autoren und Autorinnen (aka potentiellen zukünftigen Booker-Prize-Gewinnern) auftauchte.
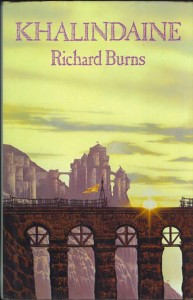 Im gleichen Jahr wie sein literarischer Erstling erschien mit Khalindaine auch der erste Band einer zweiteiligen Fantasysequenz bei Allen & Unwin, einer damals sehr angesehenen Adresse für Fantasy. Khalindaine beginnt mit einer beeindruckenden Szene (die ganz gewiss ein heißer Kandidat für eine der nächsten Ausgaben von Unsere liebsten Anfänge ist), in der die alternde Kaiserin Elsban sich dem Rite of Endyear unterzieht und dabei erkennt, dass es an der Zeit ist, sich um die Thronfolge zu kümmern. Am liebsten würde sie ihren Bastardsohn nach ihr auf dem Thron sitzen sehen, doch sie hat den Jungen als Kleinkind aus Gründen der Staatsräson weggegeben und weiß nur, dass er sich vermutlich irgendwo im gebirgigen Norden Khalindaines befindet. Ihr Wunsch passt allerdings so gar nicht in die Pläne zweier mächtiger Adliger, die ihrerseits Anspruch auf den Thron erheben können, da auch in ihren Adern das Blut Akhbars des Goldenen, des Staatsgründers fließt – und dieses Blut ist erforderlich, um das Rite of Endyear durchführen zu können. Während sich alsbald zwei Gruppierungen mit sehr unterschiedlichen Zielsetzungen auf die Suche nach Elsbans Sohn machen, wird der kaiserliche Palast von Verdre zu einem Hort der Intrigen. Und schließlich gesellt sich auch noch eine äußere Bedrohung zur inneren, als die Agaskan die Grenzen des Reichs angreifen.
Im gleichen Jahr wie sein literarischer Erstling erschien mit Khalindaine auch der erste Band einer zweiteiligen Fantasysequenz bei Allen & Unwin, einer damals sehr angesehenen Adresse für Fantasy. Khalindaine beginnt mit einer beeindruckenden Szene (die ganz gewiss ein heißer Kandidat für eine der nächsten Ausgaben von Unsere liebsten Anfänge ist), in der die alternde Kaiserin Elsban sich dem Rite of Endyear unterzieht und dabei erkennt, dass es an der Zeit ist, sich um die Thronfolge zu kümmern. Am liebsten würde sie ihren Bastardsohn nach ihr auf dem Thron sitzen sehen, doch sie hat den Jungen als Kleinkind aus Gründen der Staatsräson weggegeben und weiß nur, dass er sich vermutlich irgendwo im gebirgigen Norden Khalindaines befindet. Ihr Wunsch passt allerdings so gar nicht in die Pläne zweier mächtiger Adliger, die ihrerseits Anspruch auf den Thron erheben können, da auch in ihren Adern das Blut Akhbars des Goldenen, des Staatsgründers fließt – und dieses Blut ist erforderlich, um das Rite of Endyear durchführen zu können. Während sich alsbald zwei Gruppierungen mit sehr unterschiedlichen Zielsetzungen auf die Suche nach Elsbans Sohn machen, wird der kaiserliche Palast von Verdre zu einem Hort der Intrigen. Und schließlich gesellt sich auch noch eine äußere Bedrohung zur inneren, als die Agaskan die Grenzen des Reichs angreifen.
In Troubadour (1988), dem Nachfolgeband, sitzt dann tatsächlich ein neuer Kaiser auf dem Thron. Doch da er sich – aus nachvollziehbaren Gründen – weigert, sich dem Rite of Endyear zu unterziehen und damit die Legitimität seiner Herrschaft zu bestätigen, gerät er mehr und mehr unter den Einfluss einer fanatischen Bruderschaft, die der Bevölkerung mittels rigider Methoden bis hin zu Autodafés ihre genussfeindliche Doktrin aufzuzwingen versucht – was schließlich zu einem Bürgerkrieg zu führen droht, da sich die einfachen (und auch die nicht ganz so einfachen) Menschen nach und nach aller Vergnügungen beraubt sehen.
Khalindaine und Troubadour sind gelungene Beispiele dafür, was passieren kann, wenn ein Autor mit einem gewissen literarischen Anspruch sich des Genres annimmt. Eher auktorial als personal erzählt (wenn auch mit gelegentlichen Abstechern auf eine personale Erzählebene), entwirft Richard Burns in diesen beiden Romanen eine Welt, die generell eher mit sparsamen Pinselstrichen in Szene gesetzt wird, sich aber gelegentlich als opulentes Gemälde darstellt. Und die vor allem durch ihre allen Gesellschaftsschichten entstammenden Figuren lebt. Wer an Fantasy in erster Linie das Worldbuilding schätzt, dem mag das Setting ein bisschen zu fragmentarisch erscheinen, da es zwar etliche Andeutungen einer langen, reichen Historie gibt, diese aber meist nicht weiter ausgeführt werden. Andererseits erinnern die Szenen am kaiserlichen Hof von Verdre bzw. vor allem die in der Hauptstadt Cythroné mit ihrem krassen Gegensatz zwischen arm und reich und ihren von republikanischen Gedanken erfüllten Studenten an Versailles bzw. Paris am Vorabend der Französischen Revolution – und das war und ist eine angenehme Abwechslung zum weitaus häufigeren Standard-Mittelaltersetting, dessen sich die Fantasy so gerne bedient. Auch was die Magie betrifft, beschreitet Richard Burns eigene Wege, indem er dieses fantasytypische Element zwar recht sparsam einsetzt, aber stimmig und vor allem absolut handlungsrelevant ins Gesamtbild integriert.
Richard Burns war ein überaus vielseitiger Autor: zwischen Khalindaine und Troubadour hatte er bereits The Panda Hunt (1987) – ein in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts spielender Roman über eine Expedition nach China auf der Suche nach “merkwürdigen schwarz-weißen Bären” – veröffentlicht, und nach seinen beiden Fantasyromanen folgten noch Why Diamond Had to Die (1989; ein Thriller), Fond and Foolish Lovers (1990) und Sandro and Simonetta (1992; ein Boticelli-Roman). Möglicherweise ist ihm genau diese Vielseitigkeit zum Verhängnis geworden, denn kommerziell erfolgreich waren seine Romane allesamt nicht. Kommerzielle Erfolglosigkeit, gepaart mit einer eigenen Einschätzung seiner schriftstellerischen Fähigkeiten, die man vielleicht arrogant nennen könnte (die aber aus meiner Sicht – zumindest in Bezug auf seine ersten drei Romane – gerechtfertigt ist), sowie dem Gefühl, als nicht in London oder Oxford lebender Autor vom literarischen Establishment nicht wahr- bzw. ernst genommen zu werden, und – ganz entscheidend – dem anscheinend vorhandenen Drang, unbedingt schreiben zu müssen, ergeben eine gefährliche Mischung. Eine Mischung, die vermutlich jahrelang gebrodelt und sich schließlich in einem Akt der Verzweiflung entladen hat, denn am 31. August 1992, am Vorabend seines 34. Geburtstags, hat Richard Burns sich das Leben genommen.
Ob Richard Burns ansonsten noch einmal zur Fantasy zurückgekehrt wäre, lässt sich nicht sagen. Vermutlich schon, wenn er im Genre Erfolg gehabt hätte. Dass seine Vielseitigkeit ihm kommerziell nicht gut getan hat, kann man sich hingegen schon gut vorstellen. Faszinierend an der ganzen traurigen Geschichte ist allerdings auch, dass seine beiden Fantasyromane im einzigen online zu findenden Nachruf noch nicht einmal erwähnt werden. Und derart vollkommen in Vergessenheit zu geraten, haben Khalindaine und Troubadour ganz gewiss nicht verdient.
Bibliotheka Phantastika gratuliert Vonda N. McIntyre, die heute 65 Jahre alt wird. Die am 28. August in Louisville, Kentucky, geborene Vonda Neel McIntyre studierte Biologie mit dem Schwerpunkt Genetik, ehe sie sich dem Schreiben zuwandte. Sie war eine der ersten Absolventinnen des Clarion Writers Workshop und gründete ein Jahr später den Clarion West Writers Workshop. Ihre erste Story “Breaking Point” erschien 1970 in dem kurzlebigen SF-Magazin Venture, auf die weitere Erzählungen in diversen Anthologien folgten. Ihren großen Durchbruch hatte sie schließlich 1973 mit der Geschichte “Of Mist, and Grass, and Sand” in der Oktober-Ausgabe von Analog (die Geschichte ist mehrfach auf Deutsch erschienen, siehe Anmerkung), für die sie mit dem Nebula Award ausgezeichnet wurde.
McIntyres erster Roman The Exile Waiting (1975; dt. Die Asche der Erde (1981)) spielt in einer der letzten Städte einer postapokalyptischen Erde und ist eindeutig der SF zuzurechnen, wohingegen ihr zweiter Roman Dreamsnake (1978; dt. 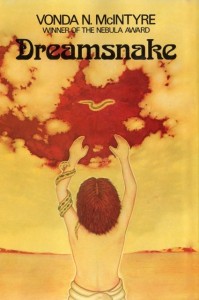 Traumschlange (1979, NA 1999)), der sich des gleichen Hintergrundszenarios bedient und in den die bereits erwähnte Kurzgeschichte “Of Mist, and Grass, and Sand” eingearbeitet wurde, sich über weite Strecken wie Fantasy liest. Dreamsnake erzählt die Geschichte der jungen Heilerin Snake (aka Schlange), die über eine von einem Atomkrieg verwüstete Erde zieht, auf der die Menschen zwar überlebt haben, die meisten aber kulturell und gesellschaftlich auf eine frühere Zivilisationsstufe zurückgefallen sind. Als Snake einen kleinen Jungen bei einem Wüstenstamm heilen will, töten die übrigen Stammesangehörigen aus Angst und Aberglaube Grass, ihre Traumschlange, deren Biss die Kranken beruhigt und ihnen die Schmerzen nimmt bzw. ihnen in aussichtslosen Fällen auch einen schmerzlosen Tod ermöglicht. Eine Heilerin braucht aber eine Traumschlange, denn ihre anderen beiden Schlangen sind Giftschlangen, die dazu dienen, Impfstoffe und Heilmittel herzustellen. Die Traumschlangen stammen allerdings nicht von der Erde und konnten bisher auch nicht gezüchtet werden, sodass Snake nichts anderes übrigbleibt, als sich zur großen Stadt aufzumachen, wo die Außerirdischen leben, die die Traumschlangen mitgebracht haben. Doch die Reise nimmt alsbald einen unerwarteten Verlauf …
Traumschlange (1979, NA 1999)), der sich des gleichen Hintergrundszenarios bedient und in den die bereits erwähnte Kurzgeschichte “Of Mist, and Grass, and Sand” eingearbeitet wurde, sich über weite Strecken wie Fantasy liest. Dreamsnake erzählt die Geschichte der jungen Heilerin Snake (aka Schlange), die über eine von einem Atomkrieg verwüstete Erde zieht, auf der die Menschen zwar überlebt haben, die meisten aber kulturell und gesellschaftlich auf eine frühere Zivilisationsstufe zurückgefallen sind. Als Snake einen kleinen Jungen bei einem Wüstenstamm heilen will, töten die übrigen Stammesangehörigen aus Angst und Aberglaube Grass, ihre Traumschlange, deren Biss die Kranken beruhigt und ihnen die Schmerzen nimmt bzw. ihnen in aussichtslosen Fällen auch einen schmerzlosen Tod ermöglicht. Eine Heilerin braucht aber eine Traumschlange, denn ihre anderen beiden Schlangen sind Giftschlangen, die dazu dienen, Impfstoffe und Heilmittel herzustellen. Die Traumschlangen stammen allerdings nicht von der Erde und konnten bisher auch nicht gezüchtet werden, sodass Snake nichts anderes übrigbleibt, als sich zur großen Stadt aufzumachen, wo die Außerirdischen leben, die die Traumschlangen mitgebracht haben. Doch die Reise nimmt alsbald einen unerwarteten Verlauf …
Der mit dem Nebula, dem Hugo und dem Locus Award ausgezeichnete Roman bietet eine überaus gelungene Synthese aus SF- und Fantasyelementen, ein interessantes, glaubhaftes Setting und eine vielleicht ein kleines bisschen zu kompetente Heldin, schreckt aber auch vor Themen wie dem Missbrauch von Frauen und Kindern nicht zurück (die damals in der SF und der Fantasy größtenteils noch tabu waren) und liefert als Dreingabe noch einen originellen Entwurf zukünftiger menschlicher Beziehungen.
Nach Dreamsnake schrieb Vonda McIntyre ein paar Jahre lang fast ausschließlich Stories und wandte sich dann dem Star-Trek-Universum zu, verfasste beispielsweise die Novelisationen der Star-Trek-Kinofilme II, III und IV. Ein paar weitere SF-Romane folgten, doch 1997 erschien schließlich mit The Moon and the Sun ein Roman, der der (in diesem Fall historischen) Fantasy zuzurechnen ist, wobei das Fantasyelement zugebenermaßen eher gering ist. Am Hofe des Sonnenkönigs (1999) spielt größtenteils genau dort und stellt mit der 20-jährigen Marie-Josèphe de la Croix, der Schwester des Jesuiten und Naturphilosophen Père Yves de la Croix, ein weiteres Mal eine überaus – oder eher ein bisschen zu – kompetente Frauenfigur in den Mittelpunkt der Handlung. Besagte Handlung dreht sich einerseits um ein “Seemonster”, das Père Yves im Auftrag des Sonnenkönigs gefangen hat, und in dem Marie-Josèphe früher als alle anderen ein denkendes, fühlendes Wesen erkennt, andererseits um das Leben und die Ereignisse am Hofe des vielleicht schillerndsten Monarchen des 17. Jahrhunderts, und letztlich auch ein wenig um den Widerstreit zwischen Alchemie und moderner Wissenschaft. Die Szenen, in denen Marie-Josèphe und das “Monster” miteinander zu kommunizieren versuchen, sind zweifellos interessant, und der Hof von Versailles bietet einen glanzvollen Rahmen für kleine und große Gegebenheiten (und natürlich auch für eine Liebesgeschichte), aber insgesamt bewegt sich der ebenfalls mit dem Nebula Award ausgezeichnete Roman – und nebenbei bemerkt der letzte, den Vonda N. McIntyre bislang geschrieben hat – doch sehr gemächlich voran.
Anmerkung: “Of Mist, and Grass, and Sand” ist mehrfach auf Deutsch erschienen: als “Die Schlange” im Science Fiction Story Reader 11 (1979) und in der Anthologie Von Lem bis Varley (1993), als “Dunst und Gras und Sand” in der Kurzgeschichtensammlung Feuerflut (1981), und als “Von Nebel, Gras und Sand” in der Anthologie Der Plan ist Liebe und Tod (1982); die (unterschiedliche) Betitelung ist ein wunderbares Beispiel dafür, warum es für Übersetzer bzw. Übersetzerinnen manchmal sinnvoll sein kann, nicht einfach zu übersetzen, “was dasteht”, wie es manche Leser und Leserinnen immer mal wieder fordern.
Bibliotheka Phantastika gratuliert Kerstin Ekman, die heute 80 Jahre alt wird. Manche Leser und Leserinnen mag es überraschen, diesen Namen hier zu lesen, denn die am 27. August 1933 in Risinge in der schwedischen Provinz Östergötland geborene Kerstin Lillemor Ekman ist anfangs durch Krimis, vor allem aber durch ihre literarischen Werke bekannt geworden, die sich um die mit der Industrialisierung bzw. dem Einzug der Moderne einhergehenden gesellschaftlichen Veränderungen drehen. Mit Rövarna i Skuleskogen (1988) hat sie allerdings auch einen Roman geschrieben, den man durchaus der Fantasy zurechnen kann.
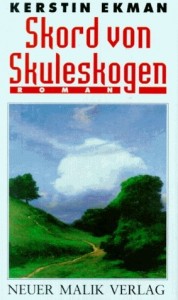 Besagter – unter dem Titel Skord von Skuleskogen (1995) auch auf Deutsch erschienener – Roman erzählt die Geschichte des Trolls Skord, der irgendwann im 14. Jahrhundert im heimatlichen Skulewald zum ersten Mal mit Menschen in Kontakt kommt. Fasziniert von diesen ihm so fremden Wesen, mischt er sich unerkannt unter sie, lebt mit Bettelkindern und Räubern, bringt es – da ein Troll viel, viel länger lebt als ein Mensch – u.a. zum Famulus eines Alchimisten, nimmt als Feldscher am 30-jährigen Krieg teil und lebt schließlich als alter Mann im 19. Jahrhundert als Medikus und Hypnotiseur in Stockholm. In all diesen Jahren ist Skord den Menschen immer ähnlicher geworden, hat lesen und schreiben und mehrere Sprachen gelernt, ohne wirklich ganz zum Menschen geworden zu sein, und sich dabei mehr und mehr von seinem ursprünglichen Selbst entfremdet. Doch ganz am Ende weist ihm eine Begegnung den Weg zurück in seine eigentliche Heimat, den Skulewald …
Besagter – unter dem Titel Skord von Skuleskogen (1995) auch auf Deutsch erschienener – Roman erzählt die Geschichte des Trolls Skord, der irgendwann im 14. Jahrhundert im heimatlichen Skulewald zum ersten Mal mit Menschen in Kontakt kommt. Fasziniert von diesen ihm so fremden Wesen, mischt er sich unerkannt unter sie, lebt mit Bettelkindern und Räubern, bringt es – da ein Troll viel, viel länger lebt als ein Mensch – u.a. zum Famulus eines Alchimisten, nimmt als Feldscher am 30-jährigen Krieg teil und lebt schließlich als alter Mann im 19. Jahrhundert als Medikus und Hypnotiseur in Stockholm. In all diesen Jahren ist Skord den Menschen immer ähnlicher geworden, hat lesen und schreiben und mehrere Sprachen gelernt, ohne wirklich ganz zum Menschen geworden zu sein, und sich dabei mehr und mehr von seinem ursprünglichen Selbst entfremdet. Doch ganz am Ende weist ihm eine Begegnung den Weg zurück in seine eigentliche Heimat, den Skulewald …
Kerstin Ekmans Roman besticht nicht nur durch die Geschichte Skords, durch dessen Augen wir einen Blick auf die unterschiedlichsten Menschen aus mehreren Jahrhunderten werfen können, oder durch die Auseinandersetzung mit der immer wieder gestellten und schwer zu beantwortenden Frage, was es bedeutet, ein Mensch zu sein, sondern nicht zuletzt durch die beeindruckenden Naturschilderungen, die fast schon eine Liebeserklärung an die unberührte Natur von Ekmans nordschwedischer Heimat darstellen. Skord von Skuleskogen – der unter dem Titel The Forest of Hours (1998) auch in England veröffentlicht wurde – mag am Rande des Genres angesiedelt sein, doch der Roman ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass die europäische Folklore eine Fülle von Motiven bietet, aus denen zu schöpfen sich lohnen kann.