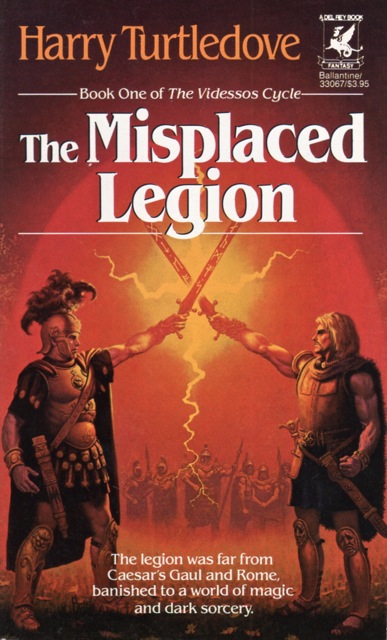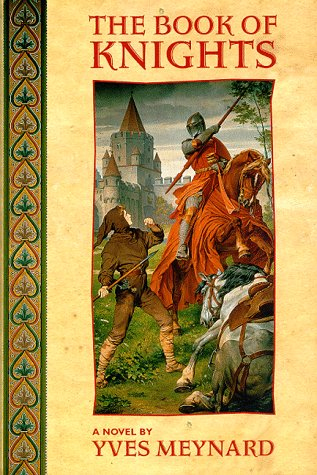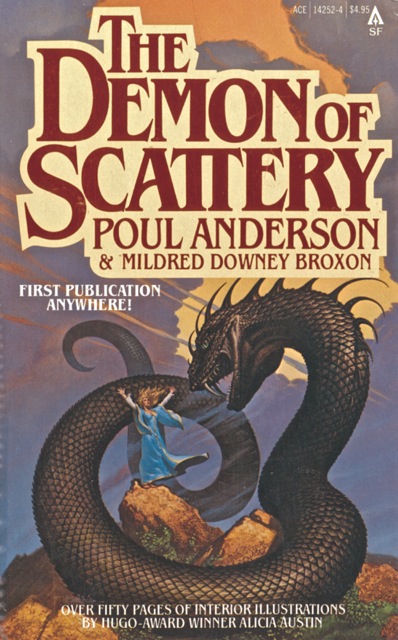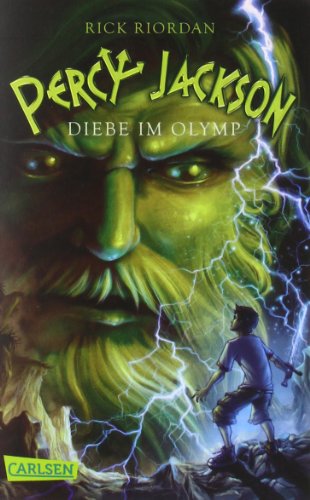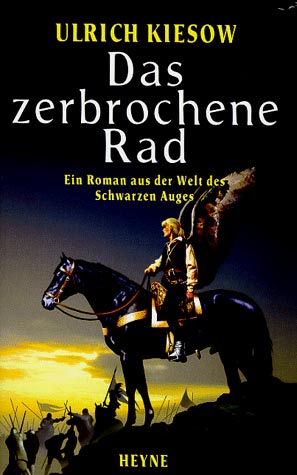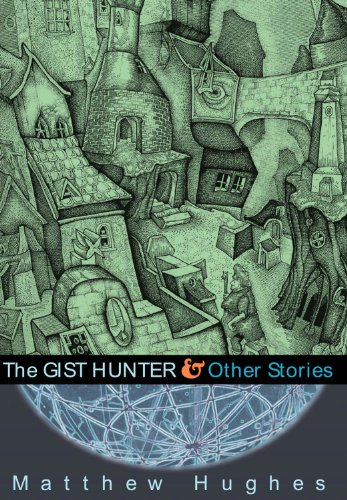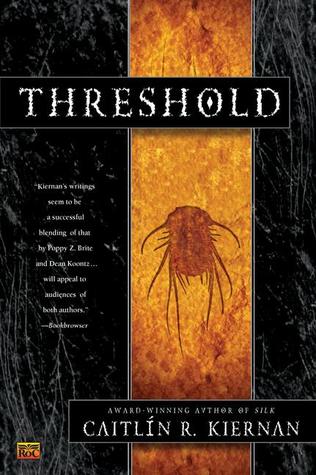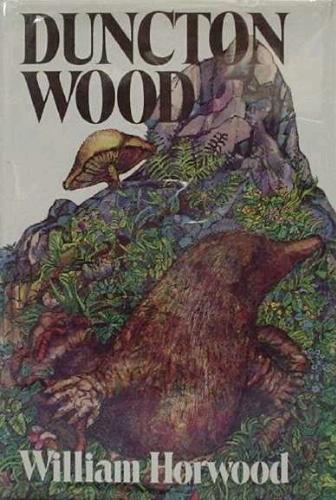Bibliotheka Phantastika gratuliert Harry Turtledove, der heute 65 Jahre alt wird. Heutzutage gilt der am 14. Juni 1949 in Los Angeles, Kalifornien, geborene Harry Norman Turtledove zumindest im angloamerikanischen Sprachraum als unumstrittener Großmeister der Alternate History oder Alternativwelt-Literatur, der er sich in mehreren Zyklen auf sehr unterschiedliche Weise gewidmet hat bzw. immer noch widmet, doch am Anfang seiner Autorenkarriere standen ein Pseudonym und zwei Fantasyromane. Bei Wereblood (1978) und Werenight (1979), die unter dem Pseudonym Eric Iverson erschienen sind, handelt es sich um typische Fantasy der ausgehenden 70er Jahre – das heißt: um Sword & Sorcery. In ihnen kämpft Gerin, der auch the Fox genannt wird, in den mehr oder minder vergessenen und sich selbst überlassenen nördlichen Marschen eines (ein bisschen an das Römische Reich erinnernden) Imperiums gegen Barbarenhorden, Gestaltwandler und machthungrige Barone. Zwar ist Gerin – der nicht nur der Sohn eines Barons ist, sondern u.a. auch Geschichte studiert hat, sich für Literatur interessiert, in dem hünenhaften Van of the Strong Arm einen weitgereisten, gebildeten Freund besitzt und recht bald die Frau fürs Leben findet und heiratet – ein für die Sword & Sorcery ziemlich untypischer Held, doch der Rest der Romane bietet nichts, was man nicht schon in anderen Werken dieses Typus ähnlich oder besser gemacht gelesen hätte.
Vielleicht sind Turtledove seine Schwächen selbst aufgefallen, denn er verlegte sich zunächst einige Jahre auf das Schreiben von Geschichten – bis Mitte der 80er Jahre noch unter dem (um die Mittelinitiale “G.” ergänzten) Iverson-Pseudonym, ab 1985 unter seinem richtigen Namen –, und Agent of Byzantium (1987, erw. 1994), sein nächstes Buch, war dann auch ein “Fix-up” aus einigen dieser Geschichten, in deren Mittelpunkt Basil Argyros, ein byzantinischer Soldat und Geheimagent steht. Argyros’ Welt unterscheidet sich in einigen signifikanten Details von unserer – z.B. war Justinians Wirken erfolgreicher, und Mohammed war ein christlicher Erzbischof und Heiliger – und stellt somit das erste der vielen Werke aus dem Bereich der Alternativwelt-Literatur dar, die Turtledove von nun an in Form von Romanen und Erzählungen schaffen sollte.
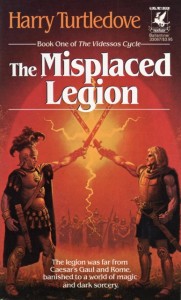 Mit The Misplaced Legion (1987), dem ersten Band des Videssos Cycle, wandte er sich der Military Fantasy zu, doch eigentlich handelt es sich auch hierbei um Alternate History, denn das Empire of Videssos, in das es drei römische Kohorten verschlägt, als ihr Anführer Marcus Aemilius Scaurus mit dem Keltenfürsten Viridovix die Klinge kreuzt, ist sowohl kulturell als auch von den geschichtlichen Ereignissen her stark an das Byzantinische Reich (des 7. Jahrhunderts) angelehnt. Die Unterschiede liegen in der Geographie, den Namen – und in der Tatsache, dass auf der Welt von Videssos Magie funktioniert. Doch abgesehen davon lassen sich die Realwelt-Vorbilder der Feinde von Videssos ebenso erkennen wie die byzantinischen Pendants der Herrscher des Kaiserreichs. Dass Turtledove Byzanz schon zum zweiten Mal als Blaupause benutzt, ist übrigens kein Wunder, denn er hat einen Doktortitel in byzantinischer Geschichte. Was dazu führt, dass Videssos (das gilt für das Kaiserreich ebenso wie für die gleichnamige Hauptstadt) als Setting ungemein stimmig und authentisch wirkt. Wobei man dieses Setting mitsamt seiner Besonderheiten erst nach und nach in The Misplaced Legion und den Folgebänden An Emperor for the Legion, The Legion of Videssos und Swords of the Legion (alle 1987) kennelernt; anfangs durch die Augen von Marcus Aemilius Scaurus, später auch durch die des (ebenfalls mit auf die fremde Welt gelangten) Kelten Viridovix und anderer Figuren. Und natürlich sind Marcus Scaurus und seine Soldaten, die Kaiser Mavrikios Gavras ihre Dienste als Söldner angeboten haben, immer mittendrin im Geschehen – egal, ob es gegen den sich zum Erzfeind entwickelnden Magier Avshar aus Yezd oder um Intrigen am kaiserlichen Hof geht.
Mit The Misplaced Legion (1987), dem ersten Band des Videssos Cycle, wandte er sich der Military Fantasy zu, doch eigentlich handelt es sich auch hierbei um Alternate History, denn das Empire of Videssos, in das es drei römische Kohorten verschlägt, als ihr Anführer Marcus Aemilius Scaurus mit dem Keltenfürsten Viridovix die Klinge kreuzt, ist sowohl kulturell als auch von den geschichtlichen Ereignissen her stark an das Byzantinische Reich (des 7. Jahrhunderts) angelehnt. Die Unterschiede liegen in der Geographie, den Namen – und in der Tatsache, dass auf der Welt von Videssos Magie funktioniert. Doch abgesehen davon lassen sich die Realwelt-Vorbilder der Feinde von Videssos ebenso erkennen wie die byzantinischen Pendants der Herrscher des Kaiserreichs. Dass Turtledove Byzanz schon zum zweiten Mal als Blaupause benutzt, ist übrigens kein Wunder, denn er hat einen Doktortitel in byzantinischer Geschichte. Was dazu führt, dass Videssos (das gilt für das Kaiserreich ebenso wie für die gleichnamige Hauptstadt) als Setting ungemein stimmig und authentisch wirkt. Wobei man dieses Setting mitsamt seiner Besonderheiten erst nach und nach in The Misplaced Legion und den Folgebänden An Emperor for the Legion, The Legion of Videssos und Swords of the Legion (alle 1987) kennelernt; anfangs durch die Augen von Marcus Aemilius Scaurus, später auch durch die des (ebenfalls mit auf die fremde Welt gelangten) Kelten Viridovix und anderer Figuren. Und natürlich sind Marcus Scaurus und seine Soldaten, die Kaiser Mavrikios Gavras ihre Dienste als Söldner angeboten haben, immer mittendrin im Geschehen – egal, ob es gegen den sich zum Erzfeind entwickelnden Magier Avshar aus Yezd oder um Intrigen am kaiserlichen Hof geht.
Der Videssos Cycle war so erfolgreich, dass Harry Turtledove ihm wenige Jahre später The Tale of Krispos folgen ließ, ein aus den Romanen Krispos Rising, Krispos of Videssos (beide 1991) und Krispos the Emperor (1994) bestehendes Prequel, das den Aufstieg eines legendären Herrschers von Videssos schildert. Kurz darauf folgte mit The Time of Troubles ein noch weiter in der Vergangenheit angesiedeltes, die Romane The Stolen Throne (1995), Hammer and Anvil (1996), The Thousand Cities (1997) und Videssos Besieged (1998) umfassendes Prequel.
Parallel zu den Arbeiten am Krispos-Dreiteiler hatte Turtledove sich den Helden seiner ersten beiden Romane noch einmal vorgenommen, sodass 1994 mit Werenight eine überarbeitete Version besagter Romane und zugleich der Auftakt einer von nun an Gerin the Fox betitelten Reihe erschien, die mit Prince of the North (1994), King of the North (1996) und Fox and Empire (1998) fortgesetzt wurde und sich als deutlich verbessert erwies. Darüberhinaus veröffentlichte der überaus fleißige Turtledove in diesen Jahren mehrere der SF zuzuzählende Einzelromane und die ersten Bände von Worldwar und The Great War, seinen beiden großen Alternativwelt-Zyklen, in denen sich der Verlauf des Zweiten Weltkriegs durch das Eingreifen von Aliens ändert bzw. durch den Sieg der Konföderierten im amerikanischen Bürgerkrieg ein anderer Geschichtsverlauf entsteht.
Die sechsbändige Zyklus The Darkness – Into the Darkness (1999), Darkness Descending (2000), Through the Darkness (2001), Rulers of 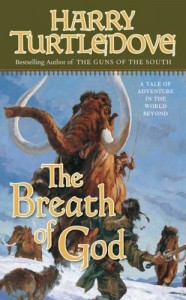 the Darkness (2002), Jaws of Darkness (2003) und Out of the Darkness (2004) – wartet mit einer merkwürdigen Melange aus einem an Geschehnisse im Ersten und Zweiten Weltkrieg angelehnten Krieg in einer feudalistischen Welt, in der Magie funktioniert (und in der dann auch logischerweise mit magischen Waffen und Wesen gekämpft wird) auf, während für die unter dem Pseudonym Dan Chernenko erschienene Trilogie The Scepter of Mercy (The Bastard King (2003), The Chernagor Pirates (2004) und The Scepter’s Return (2005)) einmal mehr das Byzantinische Reich bzw. dessen Geschichte Pate stand.
the Darkness (2002), Jaws of Darkness (2003) und Out of the Darkness (2004) – wartet mit einer merkwürdigen Melange aus einem an Geschehnisse im Ersten und Zweiten Weltkrieg angelehnten Krieg in einer feudalistischen Welt, in der Magie funktioniert (und in der dann auch logischerweise mit magischen Waffen und Wesen gekämpft wird) auf, während für die unter dem Pseudonym Dan Chernenko erschienene Trilogie The Scepter of Mercy (The Bastard King (2003), The Chernagor Pirates (2004) und The Scepter’s Return (2005)) einmal mehr das Byzantinische Reich bzw. dessen Geschichte Pate stand.
Recht originell ist hingegen die Idee, die dem aus den drei Romanen Beyond the Gap (2007), The Breath of God (2008) und The Golden Shrine (2009) bestehenden Zyklus Opening of the World zugrundeliegt: in einem mehr als tausend Jahre auf dem Gebiet nördlich des Raumsdalian Empire lastenden Gletscher öffnet sich plötzlich ein Spalt und macht den Weg zu all dem frei, was auf der anderen Seite liegt – allerdings gilt das in beide Richtungen …
Die bisher genannten Romane machen nur einen Teil – nämlich den, der der Fantasy zuzurechnen ist – von Harry Turtledoves Gesamtwerk aus, denn der ist wie schon erwähnt ein überaus fleißiger Autor und hat von 2000 bis 2013 fast 50 Romane veröffentlicht. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass von einigen Kritikern bei etlichen seiner neueren Romane stilistische Nachlässigkeiten ebenso moniert werden wie zunehmend repetetiver werdende Plots und Schwächen in der Figurenzeichnung. Unabhängig davon, wie gut oder schlecht Turtledoves neue(re) Romane sein mögen, kann man dem Videssos Cycle in seiner Gesamtheit – also einschließlich der Prequels, zu denen sich 2005 mit Bridge of the Separator noch ein Einzelroman gesellte – zubilligen, dass er solide Abenteuerfantasy (die manchmal sogar über die rein abenteuerliche Ebene hinausgeht) in einem sehr überzeugend gestalteten und authentisch wirkenden Setting bietet und der neben Glen Cooks Black Company vielleicht wichtigste Military-Fantasy-Zyklus ist (auch wenn die beiden Zyklen weder vorder- noch hintergründig viel miteinander gemein haben!). Die Romane aus den 90ern liegen inzwischen auch in Sammelbänden als Videssos Cycle: Volume One und Videssos Cycle: Volume Two (beide 2013), The Tale of Krispos (2007) und The Time of Troubles I und II (2005) vor, sollten im Zweifelsfall aber unbedingt in der Reihenfolge ihrer Entstehung und nicht in der ihrer inneren Chronologie gelesen werden.
Category: Reaktionen
Bibliotheka Phantastika gratuliert Yves Meynard, der heute 50 Jahre alt wird. Der am 13. Juni 1964 in Québec, der Haupstadt der gleichnamigen kanadischen Provinz geborene Yves Meynard gilt als einer der wichtigsten Vertreter der neuen Generation frankokanadischer SF- und Fantasy-Autoren und wurde für seine Erzählungen und Romane in französischer Sprache bereits mehrfach mit den Preisen der frankokanadischen SF- und Fantasy-Szene wie dem Prix Aurora, dem Prix Boréal und 1994 auch einmal mit dem Grand Prix de la Science-Fiction et du Fantastique Québécois ausgezeichnet. Im Gegensatz zu den meisten seiner Kolleginnen und Kollegen schreibt Meynard allerdings nicht ausschließlich auf Französisch, sondern verfasst gelegentlich – oder, wie viele Leser meinen: viel zu selten – auch Geschichten und Romane auf Englisch. Der Löwenanteil seines Schaffens liegt jedoch nur in französischer Sprache vor: knapp drei Dutzend Geschichten auf Französisch stehen ein gutes Dutzend auf Englisch gegenüber, und bei den Romanen sieht das Verhältnis mit dreizehn zu zwei noch extremer aus. Während sich unter den dreizehn Romanen in französischer Sprache mehrere Jugendbücher finden lassen, richten sich The Book of Knights und Chrysanthe eindeutig an ein erwachsenes Publikum.
The Book of Knights (1998) ist nicht nur der Titel von Yves Meynards erstem Roman auf Englisch, sondern auch der eines Buches, das in diesem Roman eine bedeutende Rolle spielt. Denn als der junge Adelrune – ein Findelkind – es auf 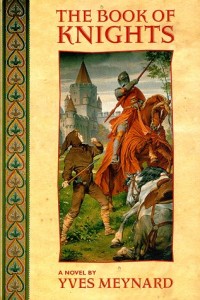 dem staubigen Dachboden des Hauses seiner Stiefeltern findet, ist es für ihn wie ein Fenster zu einer anderen Welt – einer Welt, die sehr viel großartiger und bunter zu sein verspricht als seine unmittelbare Umgebung, das Dorf Faudace, in dem er genau wie alle anderen nach den strengen Regeln der Rule – eines rigiden Glaubenssystems – lebt. Fast zwangsläufig fasst Adelrune den Entschluss, der Enge von Faudace zu entfliehen und selbst ein Ritter zu werden, Ruhm und Ehre zu gewinnen und fantastische Abenteuer zu erleben. Und nach einem denkwürdigen Erlebnis im einzigen Spielwarenladen des Dorfes setzt er seinen Entschluss in die Tat um und macht sich auf die Suche nach Riander, der laut dem Book of Knights Ritter ausbildet. Adelrunes Suche erweist sich als erfolgreich – doch so richtig beginnen seine Abenteuer erst, als er seine Ausbildung beendet hat und sich in die weite Welt aufmacht … Oberflächlich betrachtet, ist The Book of Knights ein Entwicklungsroman im Gewand eines märchenhaften Fantasyromans, dessen Sprach- und Erzählduktus mehr an die europäische Märchen- und Sagentradition erinnert als an zeitgenössische Fantasy. Doch unter der schlichten Oberfläche geht es um einige zentrale Fragen unserer menschlichen Existenz, etwa darum, was aus unseren jugendlichen Träumen wird, wenn wir erwachsen werden, oder auch darum, ob es sinnvoll ist, sein Leben nach gewissen Regeln zu führen – und ob man diese Regeln hinterfragen darf. Unabhängig davon ist The Book of Knights mit seinem anfangs blauäugigen jugendlichen Helden, den großen und kleinen Abenteuern, die er erlebt und an denen er wächst, und seinem die Geschichte perfekt abrundenden Ende einfach ein wundervolles Buch, das eigentlich all denen, die z.B. die Werke einer Patricia McKillip lieben, gefallen müsste.
dem staubigen Dachboden des Hauses seiner Stiefeltern findet, ist es für ihn wie ein Fenster zu einer anderen Welt – einer Welt, die sehr viel großartiger und bunter zu sein verspricht als seine unmittelbare Umgebung, das Dorf Faudace, in dem er genau wie alle anderen nach den strengen Regeln der Rule – eines rigiden Glaubenssystems – lebt. Fast zwangsläufig fasst Adelrune den Entschluss, der Enge von Faudace zu entfliehen und selbst ein Ritter zu werden, Ruhm und Ehre zu gewinnen und fantastische Abenteuer zu erleben. Und nach einem denkwürdigen Erlebnis im einzigen Spielwarenladen des Dorfes setzt er seinen Entschluss in die Tat um und macht sich auf die Suche nach Riander, der laut dem Book of Knights Ritter ausbildet. Adelrunes Suche erweist sich als erfolgreich – doch so richtig beginnen seine Abenteuer erst, als er seine Ausbildung beendet hat und sich in die weite Welt aufmacht … Oberflächlich betrachtet, ist The Book of Knights ein Entwicklungsroman im Gewand eines märchenhaften Fantasyromans, dessen Sprach- und Erzählduktus mehr an die europäische Märchen- und Sagentradition erinnert als an zeitgenössische Fantasy. Doch unter der schlichten Oberfläche geht es um einige zentrale Fragen unserer menschlichen Existenz, etwa darum, was aus unseren jugendlichen Träumen wird, wenn wir erwachsen werden, oder auch darum, ob es sinnvoll ist, sein Leben nach gewissen Regeln zu führen – und ob man diese Regeln hinterfragen darf. Unabhängig davon ist The Book of Knights mit seinem anfangs blauäugigen jugendlichen Helden, den großen und kleinen Abenteuern, die er erlebt und an denen er wächst, und seinem die Geschichte perfekt abrundenden Ende einfach ein wundervolles Buch, das eigentlich all denen, die z.B. die Werke einer Patricia McKillip lieben, gefallen müsste.
Es dauerte vierzehn Jahre, bis Yves Meynard mit Chrysanthe (2012) seinen zweiten Roman auf Englisch vorlegte. Wesentlich umfangreicher als sein Vorgänger (der Roman war dem Vernehmen nach ursprünglich als Trilogie geplant) beginnt Chrysanthe im Hier und Heute – allerdings einem Hier und Heute, das sich auf subtile Weise von unserer Gegenwart unterscheidet. Was kein Wunder ist, denn Christine, die Hauptfigur des Romans, lebt in einer “gemachten” Welt; in Wirklichkeit ist sie die Tochter von Edisthen, dem – zumindest seiner Meinung nach (und er hat gute Gründe für seine Meinung) – rechtmäßigen Herrscher der einzig wahren titelgebenden Welt. Ist es ein Wunder, dass Christine, ein ganz normaler Teenager mit für ein Mädchen im Teenageralter ganz normalen Wünschen und Sehnsüchten, diese Geschichte, die ihr ein schwarz gekleideter junger Mann namens Quentin erzählt, der noch nicht einmal mit einem Telefon umgehen kann, anfangs nicht glaubt? Vor allem, da 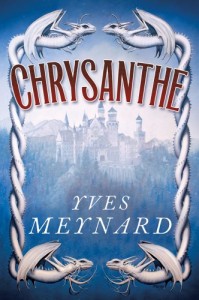 Chrysanthe eine “magische” Welt sein soll, auf der Magie funktioniert und das Wirken von God the Mother spürbar und erlebbar ist? Doch nachdem Christine mit Quentin durch ein Portal gegangen und auf Chrysanthe – einer wirklich und im wahrsten Sinne des Wortes magischen Welt – angekommen ist, bleibt ihr nicht mehr viel Zeit für Skepsis, denn sie wird in den Konflikt zwischen ihrem Vater und den Söhnen des vorherigen Königs hineingezogen – den gleichen Konflikt, der vor zehn Jahren dazu geführt hat, dass sie von den Feinden ihres Vaters entführt und auf einer gemachten Welt versteckt wurde … Das Konzept von Parallel- oder Alternativwelten ist in SF & Fantasy weit verbreitet, Meynards Konzept in Chrysanthe ähnelt aber vor allem dem in Roger Zelaznys Amber-Zyklus. Davon einmal abgesehen hat er mit Chrysanthe, der einzig wahren Welt, ein faszinierendes Setting geschaffen, das die phantastischen Möglichkeiten der Fantasy ziemlich weit auslotet und eine beeindruckende Bühne für interessante, durchweg gelungene Figuren und ihren Kampf um die Macht bietet. (Es bliebe allerdings anzumerken, dass Meynards auch stilistisch überzeugender Roman mit einem wichtigen Plotelement aufwartet, das vor allem in dieser Hinsicht sensibilisierten Leserinnen Bauchschmerzen oder Schlimmeres bereiten könnte. Um niemanden zu spoilern, soll der Hinweis genügen, dass es dabei um sich als falsch erweisende Erinnerungen darüber geht, was der Hauptfigur in ihrer Kindheit angetan wurde bzw. um die Schlüsse, die man aus dem Umgang mit diesem Thema im Roman für den Umgang damit in unserer Realität zieht.)
Chrysanthe eine “magische” Welt sein soll, auf der Magie funktioniert und das Wirken von God the Mother spürbar und erlebbar ist? Doch nachdem Christine mit Quentin durch ein Portal gegangen und auf Chrysanthe – einer wirklich und im wahrsten Sinne des Wortes magischen Welt – angekommen ist, bleibt ihr nicht mehr viel Zeit für Skepsis, denn sie wird in den Konflikt zwischen ihrem Vater und den Söhnen des vorherigen Königs hineingezogen – den gleichen Konflikt, der vor zehn Jahren dazu geführt hat, dass sie von den Feinden ihres Vaters entführt und auf einer gemachten Welt versteckt wurde … Das Konzept von Parallel- oder Alternativwelten ist in SF & Fantasy weit verbreitet, Meynards Konzept in Chrysanthe ähnelt aber vor allem dem in Roger Zelaznys Amber-Zyklus. Davon einmal abgesehen hat er mit Chrysanthe, der einzig wahren Welt, ein faszinierendes Setting geschaffen, das die phantastischen Möglichkeiten der Fantasy ziemlich weit auslotet und eine beeindruckende Bühne für interessante, durchweg gelungene Figuren und ihren Kampf um die Macht bietet. (Es bliebe allerdings anzumerken, dass Meynards auch stilistisch überzeugender Roman mit einem wichtigen Plotelement aufwartet, das vor allem in dieser Hinsicht sensibilisierten Leserinnen Bauchschmerzen oder Schlimmeres bereiten könnte. Um niemanden zu spoilern, soll der Hinweis genügen, dass es dabei um sich als falsch erweisende Erinnerungen darüber geht, was der Hauptfigur in ihrer Kindheit angetan wurde bzw. um die Schlüsse, die man aus dem Umgang mit diesem Thema im Roman für den Umgang damit in unserer Realität zieht.)
Yves Meynards bisher zwei in englischer Sprache verfassten Romane sind einerseits so unterschiedlich, andererseits jeder für sich so interessant und originell, dass man wirklich bedauern kann, dass er nicht öfters auf Englisch schreibt. Immerhin hat die englischsprachige SF&F-Community diese beiden Romane (und ein gutes Dutzend Geschichten) und ist damit viel besser dran als rein deutschsprachige Leser und Leserinnen. Die dürften allenfalls über den Namen Yves Meynard gestolpert sein, wenn sie Gene Wolfes Mythgarthr-Zweiteiler gelesen haben, denn dessen erster Band Der Ritter ist Yves Meynard und seinem Book of Knights gewidmet. Warum wohl?
Bibliotheka Phantastika gratuliert Melanie Rawn, die heute 60 Jahre alt wird. In den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts hat es ganz danach ausgesehen, dass die am 12. Juni 1954 in Santa Monica, Kalifornien, geborene Melanie Robin Rawn einer der neuen Stars des Genres werden würde. Bereits mit ihrer aus den Romanen Dragon Prince (1988), The Star Scroll (1989) und Sunrunner’s Fire (1990) bestehenden ersten Trilogie – die genauso hieß wie der Auftaktband – war sie recht erfolgreich. Die Dragon Prince Trilogy erreichte nicht nur in den USA sehr gute Verkaufszahlen, sondern 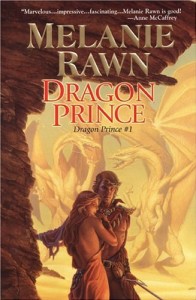 wurde u.a. auch nach Deutschland verkauft, wo sie als Drachenprinz-Saga in sechs Bänden (Das Gesicht im Feuer, Die Braut des Lichts (beide 1992), Das Band der Sterne, Der Schatten des Bruders, Die Flammen des Himmels und Der Brand der Wüste (alle 1993)) auf den Markt kam. Die Geschichte spielt in einem typischen pseudo-mittelalterlichen Setting und dreht sich um Prinz Rohan, den neuen Herrscher der Wüste, der zusammen mit seiner Braut, der Sonnenläuferin Sioned, nicht nur die umliegenden zerstrittenen Reiche einen, sondern auch die Drachen schützen will, die gemeinhin als gefährliche Raubtiere gelten und gejagt werden. Es geht (wenn auch mit deutlichen Zeitsprüngen) in aller Ausführlichkeit um Magie, politische Winkelzüge, Intrigen und die Liebe, was die Drachenprinz-Saga – die in Deutschland vor kurzem noch einmal in drei Bänden als Sonnenläufer, Mondläufer und Sternenläufer (2011-2012) neu aufgelegt wurde – zu einer dynastischen Fantasy mit Soap-Opera-Anleihen macht, wie man sie auch heute noch (allerdings meist grimmer & grittier) auf den Bestsellerlisten findet.
wurde u.a. auch nach Deutschland verkauft, wo sie als Drachenprinz-Saga in sechs Bänden (Das Gesicht im Feuer, Die Braut des Lichts (beide 1992), Das Band der Sterne, Der Schatten des Bruders, Die Flammen des Himmels und Der Brand der Wüste (alle 1993)) auf den Markt kam. Die Geschichte spielt in einem typischen pseudo-mittelalterlichen Setting und dreht sich um Prinz Rohan, den neuen Herrscher der Wüste, der zusammen mit seiner Braut, der Sonnenläuferin Sioned, nicht nur die umliegenden zerstrittenen Reiche einen, sondern auch die Drachen schützen will, die gemeinhin als gefährliche Raubtiere gelten und gejagt werden. Es geht (wenn auch mit deutlichen Zeitsprüngen) in aller Ausführlichkeit um Magie, politische Winkelzüge, Intrigen und die Liebe, was die Drachenprinz-Saga – die in Deutschland vor kurzem noch einmal in drei Bänden als Sonnenläufer, Mondläufer und Sternenläufer (2011-2012) neu aufgelegt wurde – zu einer dynastischen Fantasy mit Soap-Opera-Anleihen macht, wie man sie auch heute noch (allerdings meist grimmer & grittier) auf den Bestsellerlisten findet.
In der daran anschließenden, eine Generation später handelnden Dragon Star Trilogy – Stronghold (1990), The Dragon Token (1992) und Skybowl (1993) – sehen sich Rohan und sein Sohn Pol gefährlichen, ein bisschen an Wikinger erinnernden Invasoren gegenüber, die die Wüstenvölker und die Sonnenläufer auszulöschen drohen. Obwohl wesentlich düsterer als die erste Trilogie, gelang Melanie Rawn mit der Dragon Star Trilogy in den USA der Sprung ins prestigeträchtige Hardcover. Darüberhinaus konnte sie mehrere Projekte (sprich: noch ungeschriebene Romane) zu jeweils sehr ordentlichen Vorschüssen verkaufen; dabei handelte es sich neben einer Trilogie mit dem Titel Exiles noch um ein Gemeinschaftswerk mit Kate Elliott und Jennifer Roberson und um Keftiu, einen historischen Roman, der im minoischen Kreta spielt. Wie gesagt – ein neuer Star des Genres schien geboren.
Auf The Ruins of Ambrai (1994), den ersten Band der Exiles Trilogy, die auf einer Welt 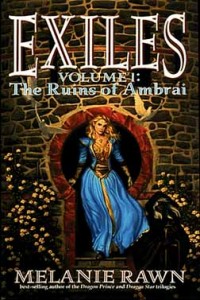 spielt, auf der es vor langer Zeit infolge eines Magierkriegs zu einer magischen Katastrophe gekommen ist, und mit einem inversen Gesellschaftssystem – einem strengen Matriarchat, in dem die Männer völlig unterdrückt werden – aufwartet, folgte mit The Golden Key (1996) das o.e. Gemeinschaftswerk (zu dem sich im Text anlässlich von Kate Elliotts Geburtstag ein paar Zeilen finden), ehe die Exiles Trilogy mit The Mageborn Traitor (1997) fortgesetzt wurde. Und dann kam … nichts mehr. Weder The Captal’s Tower, der dritte Exiles-Band, noch Keftiu noch The Diviner, das ebenfalls angekündigte Prequel zu The Golden Key, erschien in den folgenden Jahren.
spielt, auf der es vor langer Zeit infolge eines Magierkriegs zu einer magischen Katastrophe gekommen ist, und mit einem inversen Gesellschaftssystem – einem strengen Matriarchat, in dem die Männer völlig unterdrückt werden – aufwartet, folgte mit The Golden Key (1996) das o.e. Gemeinschaftswerk (zu dem sich im Text anlässlich von Kate Elliotts Geburtstag ein paar Zeilen finden), ehe die Exiles Trilogy mit The Mageborn Traitor (1997) fortgesetzt wurde. Und dann kam … nichts mehr. Weder The Captal’s Tower, der dritte Exiles-Band, noch Keftiu noch The Diviner, das ebenfalls angekündigte Prequel zu The Golden Key, erschien in den folgenden Jahren.
Logischerweise begann die Gerüchteküche zu brodeln, und aus den Informationsfetzen, die sich hier und da finden ließen, lässt sich wohl ableiten, dass Melanie Rawn gegen Ende der 90er Jahre mit einer Reihe persönlicher Probleme und Krisen (so ist u.a. von Depressionen die Rede) zu kämpfen hatte.
Erst 2006 erschien schließlich wieder ein neuer Roman von ihr, doch dabei handelte es sich um keines der lange zuvor angekündigten Werke. Stattdessen legte sie mit Spellbinder den Auftakt einer Urban-Fantasy-Triloge mit Hexen vor, von der aber nur noch der zweite Band – Fire Raiser (2009) – erschienen ist, ehe die Reihe aufgrund schlechter Verkaufszahlen vom Verlag eingestellt wurde. Anscheinend wollte die an ihrer High Fantasy interessierte Leserschaft ihr nicht in dieses neue Subgenre folgen. In die Welt von Exiles scheint Melanie Rawn aber nicht zurückkehren zu wollen oder zu können, was ihr böse Kommentare in ihrem Forum eingebracht hat – vor allem, als mit Touchstone (2012) der erste Band eines vollkommen neuen High-Fantasy-Zyklus erschienen ist, in dem es um eine magische Theatergruppe geht. Glass Thorns – so der Titel des Zyklus – wurde mittlerweile mit Elsewhens (2013) und Thornlost (2014) fortgesetzt, und mindestens ein weiterer Band soll noch folgen.
Immerhin gibt es für all jene, die auf The Captal’s Tower warten, einen Hoffnungsschimmer: mit The Diviner ist 2011 das ebenfalls schon in den 90er Jahren zum ersten Mal erwähnte Prequel zu The Golden Key erschienen, und vielleicht schafft Melanie Rawn es ja irgendwann doch noch, die Exiles Trilogy abzuschließen. Ganz unabhängig davon wäre es ihr zu wünschen, dass sie die Probleme, die sie jahrelang am Schreiben gehindert haben, dauerhaft überwindet und wieder die Bücher schreiben kann, die sie schreiben will.
Bibliotheka Phantastika gratuliert Mildred Downey Broxon, die heute 70 Jahre alt wird. Die am 07. Juni 1944 in Atlanta, Georgia, geborene Mildred Downey Broxon gehört zu der gar nicht einmal so seltenen Kategorie von Autoren oder Autorinnen, die für ein paar Jahre auf der Bildfläche erscheinen und dann schlagartig wieder von ihr verschwinden. Immerhin ist es erstaunlich, dass ein knappes Drittel ihrer Geschichten und alle drei Romane, die sie geschrieben hat bzw. an denen sie beteiligt war, auch ins Deutsche übersetzt wurden.
M. D. Broxons erste Veröffentlichung war die Story “Asclepius Has Paws” in der Anthologie Clarion III (1973), auf die in den nächsten Jahren ein knappes Dutzend weitere – teils in anderen Anthologien, teils in SF-Magazinen wie Vertex – folgen sollten. 1979 kam dann ihr erster Roman auf den Markt, allerdings ist Eric Brighteyes #2: A Witch’s Welcome nicht unter ihrem richtigen Namen, sondern unter dem Pseudonym Sigfriour Skaldaspillir erschienen, dessen Vorname sich bei der deutschen Ausgabe (Die Hexe von Orkney (1986)) lustigerweise in Sigfridur verwandelt hat. Da A Witch’s Welcome als Fortsetzung von Henry Rider Haggards Eric Brighteyes vermarktet wurde und sich stilistisch eng an diesen Roman anlehnt (in dem Haggard seinerseits versucht hat, den Sprach- und Erzählduktus der altisländischen Sagas nachzuempfinden), passt das isländisch klingende Pseudonym sogar irgendwie. Nur ist der Roman keine Fortsetzung von Eric Brighteyes (was aus bestimmten Gründen eh schwierig wäre); stattdessen erzählt er praktisch die gleiche Geschichte, dieses Mal jedoch aus der Sicht von Erics Gegenspielerin, der Zauberin Swanhild the Fatherless (aka Schwanhild die Vaterlose). Das Ergebnis ist besser, als man erwarten würde, und vor allem für diejenigen, die Haggards Roman gern gelesen haben, könnte es interessant sein, Swanhild dieses Mal nicht als böse Hexe, sondern als Frau mit nachvollziehbaren Motiven und Absichten zu erleben. Man sollte allerdings bereit sein, sich mit einem Stil und einer Sprache auseinanderzusetzen, die heutzutage vermutlich sehr merkwürdig und fremdartig wirken.
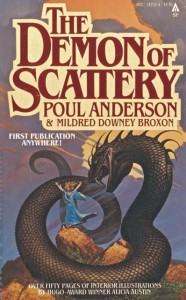 Im gleichen Jahr wie A Witch’s Welcome erschien Mildred Downey Broxons zweiter Roman The Demon of Scattery (1979), und hier stand tatsächlich ihr Name auf dem Cover – wenn auch nur als Co-Autorin, denn der Roman ist in Zusammenarbeit mit Poul Anderson entstanden. Die Schlange von Scattery (1983) – so der deutsche Titel – ist ein solider historischer Fantasy-Abenteuerroman mit Wikingern, die genau das tun, was die Wikinger im 9. Jahrhundert auf ihren Raubzügen eben so getan haben, mit christlichen Mönchen und vor allem einer Nonne namens Birgit, deren Glaube schwer geprüft wird, und einer alten Gottheit, die Birgit die Hilfe gewähren kann, die sie so dringend braucht. Und natürlich gibt es auch eine Liebesgeschichte, wie überhaupt in diesem Roman nicht viel passiert, das man nicht in etwa so erwartet hätte.
Im gleichen Jahr wie A Witch’s Welcome erschien Mildred Downey Broxons zweiter Roman The Demon of Scattery (1979), und hier stand tatsächlich ihr Name auf dem Cover – wenn auch nur als Co-Autorin, denn der Roman ist in Zusammenarbeit mit Poul Anderson entstanden. Die Schlange von Scattery (1983) – so der deutsche Titel – ist ein solider historischer Fantasy-Abenteuerroman mit Wikingern, die genau das tun, was die Wikinger im 9. Jahrhundert auf ihren Raubzügen eben so getan haben, mit christlichen Mönchen und vor allem einer Nonne namens Birgit, deren Glaube schwer geprüft wird, und einer alten Gottheit, die Birgit die Hilfe gewähren kann, die sie so dringend braucht. Und natürlich gibt es auch eine Liebesgeschichte, wie überhaupt in diesem Roman nicht viel passiert, das man nicht in etwa so erwartet hätte.
Too Long a Sacrifice (1981), Mildred Downey Broxons dritter Roman, auf dessen Cover nur ihr richtiger Name stand, war wesentlich ambitionierter als die beiden vorangegangenen Werke. Darin geraten im Irland des 6. Jahrhunderts zwei Menschen, der Barde Tadgh MacNiall und dessen Frau, die Heilerin Maire ni Donnall, in Kontakt mit den Sidhe und verschlafen in deren Königreich die Jahrhunderte. Als sie in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts in Belfast wieder in die Welt der Menschen zurückkehren, geraten sie mitten in die heiße Phase des Nordirlandkonflikts. Mehr noch, sie stehen auf verschiedenen Seiten, denn sie sind nicht nur getrennt voneinander zurückgekehrt, sondern außerdem die Avatare alter Gottheiten, die genau wie die Menschen des Landes, aus dem sie kommen, miteinander in ewigem Streit liegen … Too Long a Sacrifice (dt. Im Bann der Grünen Insel (1983)) ist ambitioniert und bemüht sich um eine ausgewogene Darstellung der Konfliktparteien; auch die Vermischung von keltischer Mythologie bzw. romantisierendem Keltentum und der Welt des 20. Jahrhunderts (die in diesem Fall von Terroranschlägen, Bomben und automatischen Waffen geprägt wird) funktioniert recht ordentlich. Trotzdem ist der Roman nicht rundum gelungen, wirkt eher wie ein Versprechen auf Werke, die vielleicht noch erscheinen werden. Doch dazu ist es – abgesehen von einer Handvoll Kurzgeschichten – nie gekommen, denn in der zweiten Hälfte der 80er Jahre ist Mildred Downey Broxon zumindest als Autorin phantastischer Literatur verstummt.
Heute wäre Jay Lake 50 Jahre alt geworden. Die Aussichten, dass der am 06. Juni 1964 in Taipeh (oder Taipei), Taiwan, als Sohn eines US-Diplomaten geborene Joseph Edward Lake, Jr. diesen Tag noch erleben wird, waren schon seit einiger Zeit mehr als schlecht. Dass er allerdings gerade mal fünf Tage vor seinem Geburtstag an der Krebserkrankung, gegen die er seit 2008 gekämpft hat, gestorben ist, macht einen Text im Stil unserer üblichen Jubiläumstexte fast unmöglich. Ist es sinnvoll, an einen Autor zu “erinnern”, dessen Name im Internet zur Zeit präsenter ist als je zuvor? Ist es sinnvoll, in diesem Rahmen einen Text zu verfassen, der sich aufgrund der Umstände unausweichlich mehr oder weniger wie ein Nachruf lesen wird?
Jay Lake hat in seiner gerade mal dreizehn Jahre dauernden schriftstellerischen Karriere mehr als 300 Stories und elf Romane veröffentlicht; mindestens zwei weitere Romane (und etliche Stories) werden oder sollen in absehbarer Zukunft noch erscheinen. Er wurde 2004 allein auf der Grundlage seiner Stories mit dem John W. Campbell Award als bester Nachwuchsautor ausgezeichnet. Während von seinen vielen Geschichten erst eine übersetzt wurde, sieht es bei seinen Romanen besser aus: die mit Mainspring (2007) begonnene gleichnamige Sequenz um ein “Uhrwerkuniversum”, die mit Escapement (2008) und Pinion (2010) fortgesetzt wurde, ist als Die Räder der Welt, Die Räder des Lebens (beide 2012) und Die Räder der Zeit (2013) auf Deutsch erschienen; mit Der verborgene Hof (2013) und Der stumme Gott (2014) liegen auch die Übersetzungen der ersten beiden Romane aus dem Green Universe – Green (2009) und Endurance (2011) – vor, und man darf davon ausgehen, dass auch Kalimpura (2013), der dritte Roman, noch übersetzt werden wird. Spätestens wenn das der Fall sein wird, wird es bei uns auch ein Portrait von Jay Lake geben, in dem wir uns mit ein bisschen mehr Abstand eingehender mit diesem Autor, der immer für eine originelle Idee und ein stimmungsvolles Szenario gut war, beschäftigen werden.
Bis dahin empfehlen wir einen Besuch auf seinem Blog, das nicht nur sein Schreiben begleitet hat, sondern auf dem er auch sehr offen, humorvoll und eindringlich über seine Krankheit schrieb, und das genauso zu seinem Renommee im Genre beigetragen hat wie seine Romane und Geschichten.
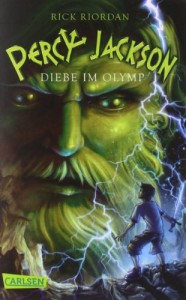 Bibliotheka Phantastika gratuliert Rick Riordan, der heute 50 Jahre alt wird. Der am 05. Juni 1964 in Texas geborene Autor ist vor allem durch seine Jugendbuchreihe um den Halbgott Percy Jackson bekannt geworden, von denen die ersten beiden Bände inzwischen auch die Kinoleinwand erobert haben.
Bibliotheka Phantastika gratuliert Rick Riordan, der heute 50 Jahre alt wird. Der am 05. Juni 1964 in Texas geborene Autor ist vor allem durch seine Jugendbuchreihe um den Halbgott Percy Jackson bekannt geworden, von denen die ersten beiden Bände inzwischen auch die Kinoleinwand erobert haben.
Anlässlich von Rick Riordans Geburtstag haben wir sein Portrait und die schnell wachsende Bibliografie noch einmal für euch aktualisiert.
Bibliotheka Phantastika erinnert an Ulrich Kiesow, der heute 65 Jahre alt geworden wäre. Der am 03. Juni 1949 geborene Ulrich Kiesow arbeitete zunächst hauptberuflich als Kunsterzieher und übersetzte ab Ende der 70er Jahre nebenbei SF und Fantasy, ehe er 1983 zusammen mit Werner Fuchs und Hans Joachim Alpers die Firma Fantasy Productions gründete, die anfangs haupsächlich als Versandhaus für Zinnfiguren und Tabletop-Spiele fungierte. Im gleichen Jahr gaben Kiesow und Fuchs mit Schwerter und Dämonen – einer Übersetzung von Tunnels & Trolls – das erste professionelle deutschsprachige Rollenspiel heraus, doch der große Wurf sollte erst ein Jahr später erfolgen.
1984 erschien nämlich Das Schwarze Auge, ein völlig eigenständig entwickeltes Rollenspiel, das in erster Linie von Ulrich Kiesow konzipiert worden war und auf der von ihm, Fuchs und Alpers entworfenen Welt Aventurien angesiedelt war. Kiesow war Zeit seines Lebens der Mastermind hinter DSA und hat nicht nur Regelwerke und Abenteuer verfasst, sondern war auch jahrelang Chefredakteur des Aventurischen Boten (wo ebenso wie in der Rollenspiel-Zeitschrift Wunderwelten etliche Artikel von ihm – teilweise unter dem Pseudonym Andreas Blumenkamp – erschienen sind).
Last but not least hat er außerdem auch noch drei Romane zum DSA-Kosmos beigesteuert und eine Anthologie mit DSA-Stories herausgegeben. Sein Erstling Die Gabe der Amazonen (1987) war einer der ersten DSA-Romane überhaupt und erschien noch bei Fantasy Productions, genauso wie die von ihm herausgegebene Anthologie Mond über Phexcaer (1990), die in einer leicht veränderten Zusammenstellung und mit überarbeiteten Geschichten 1995 noch einmal unter dem Titel Der Göttergleiche veröffentlicht wurde. Im gleichen Jahr erschien mit Der Scharlatan Kiesows zweiter Roman – und im gleichen Jahr erlitt er einen Herzinfarkt, an dessen Folgen er knapp anderthalb Jahre später sterben sollte.
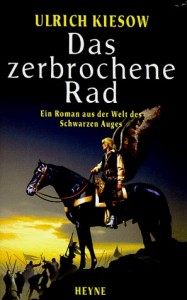 Während seiner Krankheit schrieb er an einem weiteren Roman mit dem Arbeitstitel Wenn das Rad zerbricht, dessen Veröffentlichung er allerdings nicht mehr erleben sollte, denn nur zwei Tage nach Fertigstellung des Manuskripts ist Ulrich Kiesow am 30. Januar 1997 im Alter von 47 Jahren gestorben. Der Roman, der schließlich unter dem Titel Das zerbrochene Rad (1997; TB-Ausgabe in zwei Bänden als Das zerbrochene Rad: Dämmerung und Das zerbrochene Rad: Nacht (beide 2001)) als umfangreiches Hardcover auf den Markt kam, gilt bei vielen DSA-Anhängern als der definitive DSA-Roman, und das nicht nur, weil seine Handlung sich um ein entscheidendes Ereignis in der Geschichte Aventuriens dreht, sondern auch und gerade weil Kiesow die von ihm erdachte Welt vor allem in den Details und in den kleinen Szenen überzeugend schildert und lebendig werden lässt. Somit kann man Das zerbrochene Rad als das ungeplante und trotz einiger Schwächen beeindruckende Vermächtnis eines Mannes bertrachten, dessen Wirken die deutsche Rollenspielszene nachhaltig geprägt und beeinflusst hat.
Während seiner Krankheit schrieb er an einem weiteren Roman mit dem Arbeitstitel Wenn das Rad zerbricht, dessen Veröffentlichung er allerdings nicht mehr erleben sollte, denn nur zwei Tage nach Fertigstellung des Manuskripts ist Ulrich Kiesow am 30. Januar 1997 im Alter von 47 Jahren gestorben. Der Roman, der schließlich unter dem Titel Das zerbrochene Rad (1997; TB-Ausgabe in zwei Bänden als Das zerbrochene Rad: Dämmerung und Das zerbrochene Rad: Nacht (beide 2001)) als umfangreiches Hardcover auf den Markt kam, gilt bei vielen DSA-Anhängern als der definitive DSA-Roman, und das nicht nur, weil seine Handlung sich um ein entscheidendes Ereignis in der Geschichte Aventuriens dreht, sondern auch und gerade weil Kiesow die von ihm erdachte Welt vor allem in den Details und in den kleinen Szenen überzeugend schildert und lebendig werden lässt. Somit kann man Das zerbrochene Rad als das ungeplante und trotz einiger Schwächen beeindruckende Vermächtnis eines Mannes bertrachten, dessen Wirken die deutsche Rollenspielszene nachhaltig geprägt und beeinflusst hat.
Bibliotheka Phantastika gratuliert Matthew Hughes, der heute 65 Jahre alt wird. Den meisten unserer Leser und Leserinnen wird dieser Name unbekannt sein, denn von dem am 27. Mai 1949 in Liverpool, England, geborenen Matthew Hughes, der bereits im Alter von fünf Jahren mit seiner Familie nach Kanada übersiedelte, wurde bislang weder ein Roman noch eine Story ins Deutsche übersetzt. Was bedauerlich ist, da die deutschsprachige Leserschaft auf diese Weise niemals die Bekanntschaft mit den Werken eines originellen SF- und Fantasy-Autors machen wird, der im angloamerikanischen Sprachraum gerne als legitimer Nachfolger von Jack Vance bezeichnet wird.
Hughes hat nach eigener Aussage sein ganzes Leben lang vom Schreiben gelebt, anfangs als Journalist, dann als Mitglied des Stabs der Redenschreiber für die kanadischen Justiz- und Umweltminister und schließlich als freiberuflicher Redenschreiber für Firmen und politische Organisationen in British Columbia. In den 90er Jahren begann er dann, Krimis und SF (bzw. Fantasy – so ganz eindeutig lässt sich das bei ihm nicht sagen) zu schreiben, wobei er – von einer Ausnahme ganz zu Beginn seiner literarischen Karriere abgesehen – die Langform seines Namens für SF&F benutzt (die den Löwenanteil seines Schaffens ausmachen), während er seine Krimis (und einen Mainstream-Roman) als Matt Hughes veröffentlicht und als Hugh Matthews in fremden Universen schreibt.
Gleich sein erster phantastischer Roman Fools Errant (1994, noch unter dem Autorennamen Matt Hughes) bildet den Auftakt einer Reihe von Romanen und Erzählungen, die vor einem gemeinsamen Hintergrund – dem Archonate Universe – spielen, sich dabei aber mehrerer verschiedener Protagonisten bedienen. In Fools Errant (2001 in den USA erneut veröffentlicht – dieses Mal unter Matthew Hughes) und dessen Fortsetzung Fool Me Twice (2001) spielt Filidor Vesh die Hauptrolle, ein Neffe des Archon von Old Earth, der in einer fernen Zukunft – einer Zukunft, die so fern ist, dass sie das letzte wissenschaftliche Zeitalter ist, in dem bereits die Magie des kommenden, magischen Zeitalters heraufdämmert (das dann mehr oder weniger Jack Vances Dying Earth entsprechen wird) – ein recht entspanntes Leben als nichtsnutziger Playboy führt, bis ein Auftrag seines Onkels ihn zwingt, die Hauptstadt mit all ihren Annehmlichkeiten zu verlassen und in Begleitung des Zwergs Gaskarth in reichlich rückständige Ecken der Welt zu reisen. Natürlich ist Filidor Vesh alles andere als bereit für die Abenteuer, die auf ihn warten, doch er wächst allmählich an seinen Aufgaben, was die gesamte Sequenz – die unter dem Titel Gullible’s Travels (2001) auch als Sammelband erschienen ist – nicht nur zu einer Hommage an Jack Vance, sondern auch zu einem Entwicklungsroman macht. Und sie zeigt bereits einen Autor mit großem Potential, auch wenn Hughes dieses Potential vor allem im ersten, allzu episodenhaft erzählten Band noch nicht ganz nutzen konnte.
Letzteres sollte sich allerdings mit den Auftritten von Henghis Hapthorn – die dieser ab März 2004 im Magazine of Fantasy and Science Fiction erlebte – unübersehbar ändern. Henghis Hapthorn ist ein “Discriminator”, ein Ermittler, der über einen ähnlich messerscharfen deduktiven Verstand verfügt wie sein (vermutliches) Vorbild Sherlock Holmes (und auch ein paar von dessen weniger angenehmen Eigenheiten besitzt). Hapthorns Tragik ist, dass er, ein Mann der Wissenschaft, dem die ratio über alles geht, in einem Zeitalter lebt, das immer “magischer” und damit unwissenschaftlicher wird. Das hat auch für ihn selbst weitgehende Konsequenzen, denn in einem seiner Fälle wird aus seinem “Integrator” (seinem Computer) eine Art reichlich vorlauter persönlicher Dämon, und der intuitive Teil von Hapthorns Persönlichkeit spaltet sich von 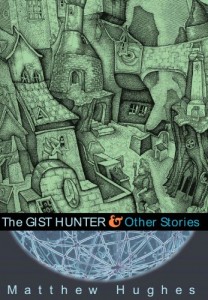 seinem restlichen Verstand ab und teilt sich nun als vollständige Persönlichkeit mit ihm den Körper. Nachdem Henghis Hapthorn in sechs Stories seine ersten Fälle gelöst hatte (die – zusammen mit anderen Geschichten – in The Gist Hunter and Other Stories (2005) gesammelt erschienen sind), durfte er in den Romanen Majestrum (2006), The Spiral Labyrinth (2007) und Hespira (2010) weitere Abenteuer – und weitere persönliche Veränderungen – überstehen. Die Henghis-Hapthorn-Abenteuer sind in ihrer Gesamtheit vielleicht die gelungensten Arbeiten des gesamten Archonate Universe, weil in ihnen die Mischung aus spannenden Inhalten, einer spröden, nicht unbedingt so richtig liebenswerten Hauptfigur und Hughes’ immer leicht humoristischem Erzählduktus am besten funktioniert.
seinem restlichen Verstand ab und teilt sich nun als vollständige Persönlichkeit mit ihm den Körper. Nachdem Henghis Hapthorn in sechs Stories seine ersten Fälle gelöst hatte (die – zusammen mit anderen Geschichten – in The Gist Hunter and Other Stories (2005) gesammelt erschienen sind), durfte er in den Romanen Majestrum (2006), The Spiral Labyrinth (2007) und Hespira (2010) weitere Abenteuer – und weitere persönliche Veränderungen – überstehen. Die Henghis-Hapthorn-Abenteuer sind in ihrer Gesamtheit vielleicht die gelungensten Arbeiten des gesamten Archonate Universe, weil in ihnen die Mischung aus spannenden Inhalten, einer spröden, nicht unbedingt so richtig liebenswerten Hauptfigur und Hughes’ immer leicht humoristischem Erzählduktus am besten funktioniert.
Mit Guth Bandar betritt in Black Brillion (2004) ein weiterer wichtiger Akteur die Bühne des Archonate Universe, auch wenn er in diesem Roman nicht die Hauptrolle spielt. Bandar ist ein “Nöonaut”, der “the Commons”, die Manifestation des kollektiven Unterbewusstseins der Menschheit, betreten kann. Über diese Begabung verfügt auch Baro Harkless, ein junger “Scrutinizer” oder “Scroot” (sprich: Polizist) und die eigentliche Hauptfigur des Romans. Er soll gemeinsam mit dem ehemaligen Betrüger Luff Imbry (der seinerseits die Hauptfigur in einem Roman und mehreren Stories ist) einen anderen Betrüger namens Horslan Gebbling – einen ehemaligen Partner Imbrys – dingfest machen und greift dabei auf die Manifestation des kollektiven Unterbewusstseins zurück, was wiederum Guth Bandar auf den Plan ruft, der nur zu genau weiß, welche Gefahren in “the Commons” drohen. Der Plot, bei dem aus einem gewöhnlichen Kriminalfall alsbald eine Bedrohung von ganz Old Earth wird, ist ganz nett, tritt aber hinter der Interaktion der sehr unterschiedlichen Akteure zurück.
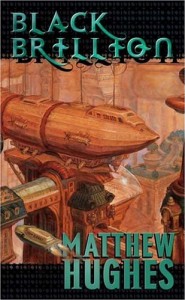 In The Commons (2007) hat Guth Bandar dann seinen großen Soloauftritt. Der aus einer Reihe von Kurzgeschichten entstandene Roman – der vermutlich aus diesem Grund wieder recht episodenhaft ist – erzählt Teile von Guth Bandars Lebensgeschichte und einige seiner Abenteuer im Reich des kollektiven Unterbewusstseins (mit Überschneidungen zu Black Brillion – wobei das Ganze dieses Mal aus Bandars Sicht geschildert wird). Außerdem wartet The Commons mit einigen der absurdesten Szenen und Sequenzen des ganzen Archonate Universe auf, die für sich betrachtet eine Menge Spaß machen, auch wenn Guth Bandar als Hauptfigur ein bisschen langweiliger als z.B. Henghis Hapthorn ist.
In The Commons (2007) hat Guth Bandar dann seinen großen Soloauftritt. Der aus einer Reihe von Kurzgeschichten entstandene Roman – der vermutlich aus diesem Grund wieder recht episodenhaft ist – erzählt Teile von Guth Bandars Lebensgeschichte und einige seiner Abenteuer im Reich des kollektiven Unterbewusstseins (mit Überschneidungen zu Black Brillion – wobei das Ganze dieses Mal aus Bandars Sicht geschildert wird). Außerdem wartet The Commons mit einigen der absurdesten Szenen und Sequenzen des ganzen Archonate Universe auf, die für sich betrachtet eine Menge Spaß machen, auch wenn Guth Bandar als Hauptfigur ein bisschen langweiliger als z.B. Henghis Hapthorn ist.
Während die bisherigen Romane ihren Ausgangspunkt alle auf Old Earth hatten, beginnt Template (2008) auf Thrais, einer Welt, auf der buchstäblich alles und jeder käuflich ist. Conn Labro ist ein professioneller und überaus erfolgreicher Duellant – und ein Schuldknecht. Als sein Besitzer getötet wird, soll Labro an ein außerweltliches Konsortium verkauft werden, ein Schicksal, dem er nur entgeht, weil ihm ein ehemaliger Spielpartner, der ebenfalls ermordet wurde, genug Geld hinterlassen hat, um sich freizukaufen. Außerdem erbt er noch einen Chip, hinter dem die Mörder her zu sein scheinen, was wiederum Conn Labro dazu veranlasst, sich auf die Jagd nach den Hintergründen der ganzen Geschichte zu machen, selbst wenn das bedeutet, dass er seine Heimatwelt dafür verlassen muss. Begleitet von Jenore Mordene, einer Frau von Old Earth – oder genauer: von einem Archipel, auf dem kein Geld existiert – reist Labro durch das Archonate und gelangt auf Welten, deren Kulturen ihm vollkommen fremd sind. Template ist ein rundum gelungener Roman, den so ähnlich auch Jack Vance verfasst haben könnte.
In The Other (2011) hat dann schließlich noch der Schwindler und Trickbetrüger Luff Imbry seinen Soloauftritt, dem darin einerseits so übel mitgespielt wird, dass man eigentlich Mitleid mit ihm haben muss, der aber andererseits so viel auf dem Kerbholz hat, dass das nicht ganz leicht fällt. Imbrys Ambivalenz macht ihn zu einer schwer fassbaren Figur, deren Abenteuer – es gibt noch einen von Matthew Hughes selbst publizierten Band mit Kurzgeschichten unter dem Titel The Meaning of Luff and Other Stories (2013) – nichtsdestotrotz lesenswert sind.
Abgesehen von seinen Romanen und Geschichten aus dem Archonate Universe hat Matthew Hughes noch einen Wolverine-Roman mit dem Titel Lifeblood (2007) und einen Beitrag zu den Pathfinder Tales (Song of the Serpent (2012), beide als Hugh Matthews) verfasst; Letzterer, in dessen Mittelpunkt der Dieb Krunzle the Quick (aka Krunzle the Incorrigible oder auch Krunzle the Corruptible) steht, der nach einem missglückten Diebstahlversuch mit einer magischen Schlange um den Hals die mit einem Soldaten durchgebrannte Tochter des Kaufmanns zurückholen soll, den er ursprünglich bestehlen wollte, ist eine Jack-Vance-Hommage erster Güte, die allen Fans von Cugel the Clever sehr zu empfehlen ist.
Schließlich wäre noch die aus den Einzelbänden The Damned Busters (2011), Costume Not Included (2012) und Hell to Pay (2013) bestehende Trilogie To Hell and Back zu erwähnen, in der es auf gewohnt humoristische Weise um Superhelden geht.
Obwohl seine Romane und Kurzgeschichten von Kritikern (und natürlich auch seinen Lesern) hochgelobt werden und er vollkommen zu recht als der legitime Nachfolger von Jack Vance bezeichnet wird, ist Matthew Hughes auch im angloamerikanischen Sprachraum nie der große Erfolg beschieden gewesen. Den Band mit Luff-Imbry-Geschichten musste er ebenso selbst publizieren, wie einen Band mit sämtlichen Henghis-Hapthorne-Geschichten (9 Tales of Henghis Hapthorn (2013)), und um weiter schreiben zu können, hat er bereits seit einiger Zeit einen Nebenjob als unbezahlter Housesitter. Auf Tantiemen aus Deutschland konnte er bis jetzt auch noch nicht hoffen, da – wie bereits erwähnt – nicht eine seiner Geschichten, geschweige denn einer seiner Romane übersetzt wurde. Was in beiderlei Hinsicht mehr als schade ist.
Bibliotheka Phantastika gratuliert Caitlín R. Kiernan, die heute 50 Jahre alt wird. Die am 26. Mai 1964 in Skerries, County Dublin, Irland, geborene, aber bereits in jungen Jahren mit ihrer Mutter in die USA umgezogene Caitlín Rebekah Kiernan gilt als eine der herausragendsten neuen Stimmen der Weird Fiction oder Dark Fantasy, deren Arbeiten beispielsweise von dem bekannten Kritiker S.T. Joshi sehr geschätzt werden. Ihre literarische Karriere begann im März 1995 mit der Veröffentlichung der Kurzgeschichte “Persephone” (in Aberrations # 27), der ersten von mittlerweile rund 150 Stories, die in diversen Magazinen und Anthologien erschienen sind und häufig auch in den entsprechenden Best-of-Auswahlbänden auftauchen.
Nachdem sie einige Episoden der Comicserie The Dreaming (einem Spin-Off von Neil Gaimans Sandman) gescripted hatte, kam 1998 mit Silk ihr erster Roman auf den Markt, der inhaltlich und stilistisch tief in der Gothic-Szene verwurzelt ist, die – zumindest damals – eine wichtige Rolle in ihrem Leben wie in ihrem Schaffen spielte. Doch bereits ihr zweiter Roman Threshold (2001; dt. Fossil (2009)) hat nichts mehr mit der Gothic-Szene zu tun; statt dessen wird in ihm der Einfluss eines Autors deutlich, der zu den Portalfiguren der Weird Fiction zählt: H.P. Lovecraft. Allerdings schreibt Caitlín R. Kiernan noch nicht einmal ansatzweise so etwas wie Lovecraft-Pastiches – was sie von Lovecraft übernimmt, ist sein Konzept des kosmischen Horrors, die Vorstellung eines im besten Falle gleichgültigen, von für Menschen unbegreiflichen und wahrhaft unfassbaren Entitäten bewohnten Universums, wobei besagte Entitäten auch durchaus in einem Höhlensystem irgendwo unter Alabama hausen können.
 Threshold ist der Auftakt einer locker zusammenhängenden Reihe von Romanen und Stories, die in erster Linie durch einen gemeinsamen Hintergrund und das Albinomädchen Dancy Flammarion – eine wandernde Monsterjägerin – miteinander verbunden sind, und zu der u.a. In the Garden of Poisonous Flowers (2002), Low Red Moon (2003; dt. Kreatur (2009)), Alabaster (2006, eine Storysammlung) und Daughter of Hounds (2007) sowie die (ursprünglich als Miniserie bzw. in Dark Horse Presents erschienenen) Comics Alabaster: Wolves (2013) und Alabaster: Grimmer Tales (2014) gehören.
Threshold ist der Auftakt einer locker zusammenhängenden Reihe von Romanen und Stories, die in erster Linie durch einen gemeinsamen Hintergrund und das Albinomädchen Dancy Flammarion – eine wandernde Monsterjägerin – miteinander verbunden sind, und zu der u.a. In the Garden of Poisonous Flowers (2002), Low Red Moon (2003; dt. Kreatur (2009)), Alabaster (2006, eine Storysammlung) und Daughter of Hounds (2007) sowie die (ursprünglich als Miniserie bzw. in Dark Horse Presents erschienenen) Comics Alabaster: Wolves (2013) und Alabaster: Grimmer Tales (2014) gehören.
The Five of Cups (2003) ist ein reichlich blutiger Vampirroman und eigentlich Kiernans echter Erstling aus den frühen 90ern, der nur deutlich später veröffentlicht wurde, während Murder of Angels (2004) eine Quasi-Fortsetzung von Silk ist. Auf Vermittlung von Neil Gaiman verfasste sie Beowulf (2007), die Novelisation des gleichnamigen Films, ehe sie mit The Red Tree (2009) und vor allem The Drowning Girl (2012) eine etwas andere Richtung einschlug.
Schon in Silk war einer ihrer Protagonisten durch traumatische Kindheitserlebnisse schwer gezeichnet, und auch die Hauptfiguren ihrer weiteren Romane litten aus ähnlichen Gründen unter mehr oder weniger ausgeprägten psychischen Störungen, so dass man sich nie ganz sicher sein kann, ob das, was sie erleben, der Wirklichkeit entspricht oder nur Einbildung ist; allerdings gibt es in den Dancy-Flammarion-Bänden unübersehbare Hinweise, dass das Grauen wirklich ist. In The Red Tree hingegen wird die Ungewissheit, was wirklich und was eingebildet ist, endgültig zum Prinzip erhoben, und The Drowning Girl ist der Versuch, eine Geschichte aus der Sicht einer Schizophrenen, die um ihre Schizophrenie weiß, zu schreiben.
Wesentlich leichter zugänglich dürften im Vergleich dazu Blood Oranges (2013) und Red Delicious (2014) sein, zwei Romane, die unter dem Pseudonym Kathleen Tierney erschienen sind und in denen Caitlín Kiernan mit Hilfe ihrer ein bisschen an Buffy angelehnten Heldin Siobhan Quinn der Urban Fantasy etwas von dem zurückgeben will, was sie früher einmal ausgezeichnet hat.
Caitlín R. Kiernan ist gewiss keine leicht zugängliche Autorin. In ihren Romanen und Geschichten spielen Sex und (vor allem auch psychische) Gewalt eine wesentliche Rolle, sie sind häufig verstörend – sollen verstörend sein – und ihre Figuren sind oft von traumatischen Erlebnissen gezeichnete, nicht unbedingt angenehme Zeitgenossen. Außerdem bedient sie sich einer an Metaphern fast schon überreichen Sprache – und sie bietet ihren Leserinnen und Lesern nur selten eine Auflösung im klassischen Sinn an. Dies alles könnte mit dazu beigetragen haben, dass sie im angloamerikanischen Sprachraum eine z.B. auch von Jeff VanderMeer hochgelobte, mehrfach mit Preisen ausgezeichnete Kultautorin ist und als eine der wichtigsten neuen Stimmen der Weird Fiction gilt, während ihre beiden auf Deutsch erschienenen Romane hierzulande sehr gemischt aufgenommen wurden.
Seit Dezember 2005 gibt sie unter dem Titel Sirenia Digest “a monthly journal of the weirdly erotic” im PDF-Format heraus, in dem sie Kurzgeschichten und Vignetten veröffentlicht und das von Comic-Künstlern wie Vince Locke illustriert wird. Etliche ihrer anderen Geschichten sind in mittlerweile dreizehn, häufig thematisch bzw. im Hinblick auf die Genrezugehörigkeit passend zusammengestellten Sammelbänden erschienen.
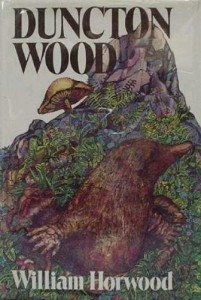 Bibliotheka Phantastika gratuliert William Horwood, der heute seinen 70. Geburtstag feiert. Die Karriere des am 12. Mai 1944 in Oxford, England, geborenen Horwood fokussiert sich auf ein Randgebiet der Fantasy, die Tierfabel, in der sein Erstling Duncton Wood (1980, dt. Der Stein von Duncton (1984)) heute als Klassiker betrachtet werden kann. Im Fahrwasser des einige Jahre zuvor erschienenen Watership Down baut William Horwood in der später mit Duncton Quest (1988), Duncton Found (1989), Duncton Tales (1991), Duncton Rising (1992) und Duncton Stone (1993) fortgesetzten Reihe eine einerseits authentische und andererseits mythologisch aufgeladene Maulwurfswelt auf, durch die sich seine kurzsichtigen Protagonisten schlagen müssen. Die ohnehin schon dynastische Züge tragende Questengeschichte um die Maulwürfe Bracken und Rebecca und den sakral anmutenden titelgebenden Stein wird in den weiteren Bänden von Maulfwurfshelden der jeweils nächsten Generation weitergeführt; eine Übersetzung ins Deutsche liegt davon jedoch nicht mehr vor.
Bibliotheka Phantastika gratuliert William Horwood, der heute seinen 70. Geburtstag feiert. Die Karriere des am 12. Mai 1944 in Oxford, England, geborenen Horwood fokussiert sich auf ein Randgebiet der Fantasy, die Tierfabel, in der sein Erstling Duncton Wood (1980, dt. Der Stein von Duncton (1984)) heute als Klassiker betrachtet werden kann. Im Fahrwasser des einige Jahre zuvor erschienenen Watership Down baut William Horwood in der später mit Duncton Quest (1988), Duncton Found (1989), Duncton Tales (1991), Duncton Rising (1992) und Duncton Stone (1993) fortgesetzten Reihe eine einerseits authentische und andererseits mythologisch aufgeladene Maulwurfswelt auf, durch die sich seine kurzsichtigen Protagonisten schlagen müssen. Die ohnehin schon dynastische Züge tragende Questengeschichte um die Maulwürfe Bracken und Rebecca und den sakral anmutenden titelgebenden Stein wird in den weiteren Bänden von Maulfwurfshelden der jeweils nächsten Generation weitergeführt; eine Übersetzung ins Deutsche liegt davon jedoch nicht mehr vor.
Mit den Wolves of Time blieb Horwood der Tierfantasy treu und erzählte die Geschichte eines besonderen Wolfsrudels, das sich im Osten eines zerstörten, postapokalyptischen Europa aus allen Regionen des Kontinents zusammenfindet, um die Wölfe in dieser chaotischen Welt zu alter Stärke zurückzuführen. Eine etwas unglückliche Veröffentlichungsgeschichte – und wohl auch mangelnder Erfolg – sorgten dafür, dass die Reihe nicht wie geplant in drei Bänden erzählt werden konnte, sondern der Mittelband zwischen Journeys to the Heartland (1995, dt. Die Reise ins Herzland (1996)) und Seekers at the Wulfrock (1997, dt. Der Kampf um das Herzland (1999)) ausfallen musste, wodurch einige Erzählstränge etwas ins Leere liefen. Beeindruckend an der Reihe bleibt dabei vor allem der relativ teilnahmslose Blick auf den Untergang der Menschheit durch die Augen der Wölfe.
In jüngster Zeit hat Horwood, der auch in seinen Fortsetzungen von Kenneth Grahames The Wind in the Willows Tieren die Hauptrolle überließ, seinem Leib- und Magengenre vordergründig den Rücken gekehrt, denn mit Hyddenworld (Spring (2010), Awakening (2011), Harvest (2012) und Winter (2014), dt. bisher Der Frühling (2012), Das Erwachen (2013), Die Ernte (2014)) veröffentlichte er eine Questenfantasy mit uraltem Übel, Prophezeiung und einem vom Schicksal erwählten Außenseiter. Doch so weit ist Hyddenworld von seinen schriftstellerischen Anfängen in der Maulwurfswelt vielleicht gar nicht weg, denn die bedrängten Hydden sind sehr klein und leben verborgen vor den Menschen unter der Erde …