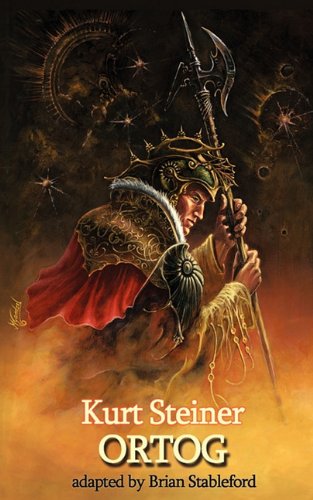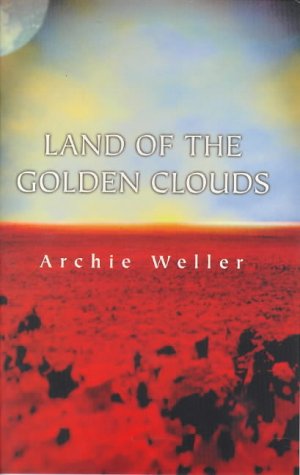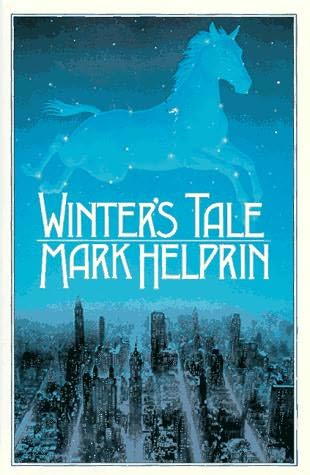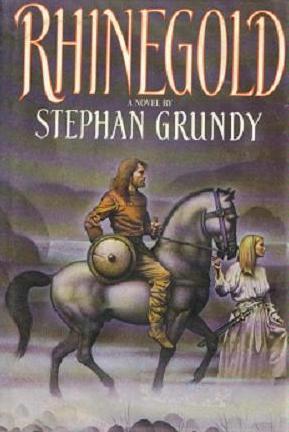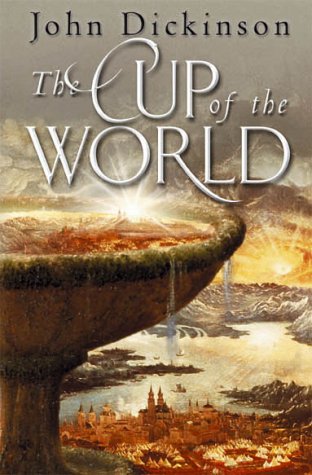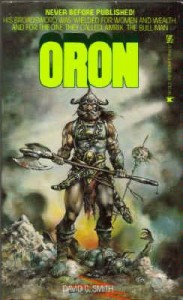 Bibliotheka Phantastika gratuliert David C. Smith, der heute 60 Jahre alt wird. Der am 10. August 1952 in Youngstown, Ohio, geborene David Claude Smith ist einer der Autoren, die – vergleichbar etwa mit seinem nur wenige Jahre älteren Kollegen Charles R. Saunders – im Kielwasser der durch die Conan-Ausgabe bei Lancer Books entfachten Begeisterung für Sword & Sorcery ihre ersten Stories um schwertschwingende, aber nicht zwangsläufig barbarische Helden in Amateur- und semiprofessionellen Magazinen veröffentlichten und schließlich zu ersten Romanveröffentlichungen kamen.
Bibliotheka Phantastika gratuliert David C. Smith, der heute 60 Jahre alt wird. Der am 10. August 1952 in Youngstown, Ohio, geborene David Claude Smith ist einer der Autoren, die – vergleichbar etwa mit seinem nur wenige Jahre älteren Kollegen Charles R. Saunders – im Kielwasser der durch die Conan-Ausgabe bei Lancer Books entfachten Begeisterung für Sword & Sorcery ihre ersten Stories um schwertschwingende, aber nicht zwangsläufig barbarische Helden in Amateur- und semiprofessionellen Magazinen veröffentlichten und schließlich zu ersten Romanveröffentlichungen kamen.
Wobei der erste Roman, der von Smith erschien, keine Sword & Sorcery war, sondern ein nur spärlich mit übernatürlichen Elementen versehenes Howard-Pastiche um den Piraten Black Vulmea (The Witch of the Indies, 1977), auf den ein Jahr später ein zweites, dieses Mal zusammen mit Richard L. Tierney verfasstes Howard-Pastiche folgte; in For the Witch of the Mists (1978; dt. Die Nebelhexe (1985)) steht allerdings mit Bran Mak Morn eine von Howards eindeutig der S&S zuzurechnenden Figuren im Mittelpunkt (und die Pastiches zählen beide zu den besseren Hervorbringungen ihrer Art).
Parallel dazu kamen auch die ersten Romane auf den Markt, in denen Smith sich seinen auf dem Inselkontinent Attluma (im Prinzip einer Atlantis-Version ohne High-Tech) agierenden eigenen Helden zuwenden konnte, die teilweise bereits in einigen seiner Kurzgeschichten aufgetreten waren. Oron (1978) bildet dabei den Auftakt zu einer vierbändigen Reihe – die Folgebände bzw. genauer gesagt Prequels sind Mosutha’s Magic, The Valley of Ogrum (beide 1982) und The Ghost Army (1983) – um den barbarischen Krieger Oron, der seinen Vater tötet, von seinem Stamm ausgestoßen wird und sich daraufhin seinen Lebensunterhalt als Söldner verdient. The Sorcerer’s Shadow (1978) spielt mehrere Jahrhunderte nach den Oron-Romanen ebenfalls auf Attluma, hat aber mit dem von einem Magier zur Unsterblichkeit verfluchten Krieger Akram eine anders geartete Hauptfigur, die eine gewisse Ähnlichkeit mit Karl Edward Wagners unsterblichem Helden Kane nicht ganz leugnen kann.
Von 1981 bis 1983 verfasste Smith – wieder in Zusammenarbeit mit Tierney – außerdem eine sechsteilige Reihe um die (in diesem Fall aus dem Mittelalter ins Hyborische Zeitalter versetzte) Howard-Heroine Red Sonja und schien sich als Autor etabliert zu haben. Doch da in den 80ern eine Art Wachablösung in der Fantasy stattfand und die Sword & Sorcery verglichen mit der High Fantasy tolkienesker Prägung endgültig ins Hintertreffen geriet, kam auch Smiths Autorenkarriere ins Stocken – und das, obwohl er auf Wunsch seines Verlags mit Fall of the First World eine aus den Einzelbänden The Master of Evil, Sorrowing Vengeance und The Passing of the Gods (alle 1983) bestehende Trilogie vorlegte, die sich deutlich an den komplexeren Epen etwa eines Stephen R. Donaldson orientierte und vom Autor selbst als Fantasy-Äquivalent von Krieg und Frieden gedacht war. Dem letztgenannten Anspruch kann Fall of the First World zwar sicher nicht gerecht werden, aber die Trilogie, die in einem vorgeschichtlichen Zeitalter spielt und deren archetypische Figuren ihren Nachhall in etlichen Personen unserer Legenden gefunden haben, ist deutlich origineller als viele der halbgaren Tolkien-Aufgüsse oder in Romanform nacherzählten Rollenspielrunden, die in den 80ern einen Großteil des Genres ausmachten.
1989 und 1991 veröffentlichte Smith noch zwei okkulte Horrorromane um den vom Priester zum Magier gewordenen David Trevisan (The Fair Rules of Evil und The Eyes of Night), doch seither ist er als Autor phantastischer Literatur verstummt. Smiths S&S-Romane oder auch seine epische Fantasy-Trilogie zählen gewiss nicht zu den Spitzenwerken des Genres, bieten aber den Freunden dieser Untergattung deutlich mehr als manch anderes Werk, das es zu einer deutschen Übersetzung gebracht hat.
Tag: Jubiläen
Bibliotheka Phantastika gratuliert André Ruellan, der heute 90 Jahre alt wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass deutschsprachige Leser oder Leserinnen mit dem Namen des am 07. August 1922 in Courbevoie im Département Hauts-de-Seine geborenen Ruellan auf Anhieb etwas anfangen können, dürfte eher gering sein, denn hierzulande sind nur zwei SF-Romane aus seiner späteren Schreibperiode (in der er unter seinem eigenen Namen veröffentlicht hat) erschienen: Tunnel (1973) als Paris 2020 (1981; ein Near-Future-Roman, in dem ein junger Arzt seine komatöse, hochschwangere Frau ins Krankenhaus zu bringen versucht und dabei ein in jeder Hinsicht kaputtes, von Gewalt und Chaos beherrschtes Paris durchqueren muss) und Mémo (1984) als Memo (1987; ein Roman, in dem es um eine Substanz geht, die Erinnerungen – auch künstliche – derart intensiviert, dass sie sich praktisch nicht mehr von der erlebten Gegenwart unterscheiden).
Dabei war Ruellan, der Medizin studiert und auch einige Jahre als Arzt gearbeitet hat, vor allem zu Beginn seiner Schriftstellerkarriere recht fleißig und in den 50er und frühen 60er Jahren unter dem Pseudonym Kurt Steiner (gelegentlich auch Kurt Wargar) regelmäßig in Fleuve Noirs Genrereihen Angoisse (Horror bzw. Phantastik) und Anticipation (SF) vertreten. Und in der Reihe Anticipation sind auch die beiden Romane erschienen, denen Ruellan seinen heutigen Eintrag in unserem Blog verdankt.
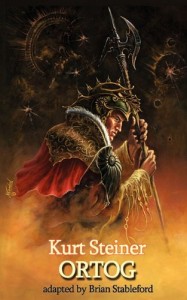 In Aux Armes d’Ortog (1960) lernen wir den Ritter-Navigator (oder Navigator-Ritter) Dal Ortog of Galankar kennen, der im 50. Jahrhundert auf einer Erde lebt, auf der High-Tech neben Magie existiert. Außerdem war sie kurz zuvor in einen verheerenden interplanetaren Krieg verwickelt, und die Bevölkerung siecht an einer unbekannten Krankheit dahin. Kein Wunder, dass Sopharch Karella seinen besten Mann losschickt, um ein Mittel gegen die Krankheit zu finden. Natürlich hat Ortog Erfolg – doch zu spät, denn seine große Liebe, Karellas Tochter Kalla, ist bereits tot. Und deshalb müssen sich Ortog und sein Freund Zoltan Charles Henderson de Nancy in Ortog et les Ténèbres (1969) in die Dimensionen des Todes aufmachen, um Kallas Seele zurückzuholen …
In Aux Armes d’Ortog (1960) lernen wir den Ritter-Navigator (oder Navigator-Ritter) Dal Ortog of Galankar kennen, der im 50. Jahrhundert auf einer Erde lebt, auf der High-Tech neben Magie existiert. Außerdem war sie kurz zuvor in einen verheerenden interplanetaren Krieg verwickelt, und die Bevölkerung siecht an einer unbekannten Krankheit dahin. Kein Wunder, dass Sopharch Karella seinen besten Mann losschickt, um ein Mittel gegen die Krankheit zu finden. Natürlich hat Ortog Erfolg – doch zu spät, denn seine große Liebe, Karellas Tochter Kalla, ist bereits tot. Und deshalb müssen sich Ortog und sein Freund Zoltan Charles Henderson de Nancy in Ortog et les Ténèbres (1969) in die Dimensionen des Todes aufmachen, um Kallas Seele zurückzuholen …
Das Ganze hat natürlich einen gewissen Trash-Faktor, vor allem im Vergleich zu den o.e., thematisch deutlich anspruchsvolleren SF-Romanen, doch das Setting – für das der britische SF-Kritiker John Clute den treffenden Begriff Medieval Futurism geprägt hat –, ein paar nette kleine Ideen und die Gelegenheit, einen Blick in nicht angloamerikanische Science Fantasy zu werfen, haben durchaus ihren Reiz. Letzteres ist tatsächlich auch Lesern und Leserinnen möglich, die kein Französisch können, denn die beiden recht dünnen Romane sind 2010 in der Übersetzung von Brian M. Stableford unter dem Titel Ortog als Sammelband in den USA erschienen. André Ruellan selbst hat sich seit Mitte der 90er Jahre aufs Drehbuchschreiben konzentriert, mit dem er bereits in den 70ern angefangen hatte, und war in diesem Bereich noch bis vor kurzem aktiv.
Bibliotheka Phantastika gratuliert Tobias O. Meißner, der heute 45 Jahre alt wird. Der am 04. August 1967 in Oberndorf am Neckar geborene Meißner ist einer der experimentierfreudigsten deutschen Fantasy-Autoren, der es mit seinem dem Spiel-Konzept verpflichteten Roman Das Paradies der Schwerter sogar geschafft hat, vom Feuilleton wahrgenommen zu werden, aber durchaus auch klassischere Fantasy-Stoffe und moderne Phantastik im Repertoire hat. Mehr erfahrt ihr in unserem ausführlichen Portrait – und alle Interessierten & Fans sollten außerdem in den nächsten Tagen auch in unserem Blog die Augen offenhalten …
Bibliotheka Phantastika erinnert an Rosemary Sutcliff, die heute vor 20 Jahren starb. Obwohl die 1920 in Surrey geborene Sutcliff schon sehr früh an Arthritis erkrankte und dadurch zeitlebens starken Beeinträchtigungen ausgesetzt war, entwickelt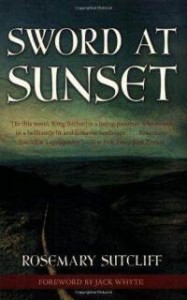 e sie sich zu einer ungeheuer produktiven Autorin vor allem historischer Romane, die überwiegend als Jugendbücher kategorisiert werden, aber dank der darin behandelten durchaus anspruchsvollen Themen und der genauen Recherche der geschichtlichen Hintergründe auch für erwachsene Leser reizvoll sind. Die größte Popularität genießen dabei wohl drei Bände ihrer Reihe um Angehörige der Familie Aquila im römischen Britannien, The Eagle of the Ninth (1954, dt. Der Adler der neunten Legion, 2011 unter demselben Titel mit abgewandelter Handlung verfilmt), The Silver Branch (1957, dt. Der silberne Zweig) und The Lantern Bearers (1959, dt. Die Fackelträger bzw. Drachenschiffe drohen am Horizont).
e sie sich zu einer ungeheuer produktiven Autorin vor allem historischer Romane, die überwiegend als Jugendbücher kategorisiert werden, aber dank der darin behandelten durchaus anspruchsvollen Themen und der genauen Recherche der geschichtlichen Hintergründe auch für erwachsene Leser reizvoll sind. Die größte Popularität genießen dabei wohl drei Bände ihrer Reihe um Angehörige der Familie Aquila im römischen Britannien, The Eagle of the Ninth (1954, dt. Der Adler der neunten Legion, 2011 unter demselben Titel mit abgewandelter Handlung verfilmt), The Silver Branch (1957, dt. Der silberne Zweig) und The Lantern Bearers (1959, dt. Die Fackelträger bzw. Drachenschiffe drohen am Horizont).
Doch Sutcliffs Romane stehen trotz ihrer festen Verwurzelung in tatsächlichen historischen Epochen in vielerlei Hinsicht der Fantasy näher, als man auf den ersten Blick vermuten könnte, und das nicht nur, weil sie durch ihre Schilderung fremdartiger, aber sehr authentisch und glaubwürdig erscheinender Lebenswelten etwas leisten, das man sich auch von guter Phantastik erhofft. So treten z.B. immer wieder Figuren auf, bei denen man zumindest vermuten kann, dass sie über magische oder hellseherische Fähigkeiten verfügen, wie etwa die eindrucksvoll geschilderte weise Frau Ancret in Knight’s Fee (1960, dt. Randal der Ritter). Darüber hinaus gewinnt man den Eindruck, dass bestimmte Deutungsmuster, die gerade in Sutcliffs Romanen zur Vor- und Frühgeschichte Großbritanniens immer wieder aufscheinen, stark der Mythenforschung des 19. und frühen 20. Jahrhunderts verpflichtet sind. Zu denken wäre hier etwa an James Frazers The Golden Bough. A Study in Magic and Religion (1890; dt. Der Goldene Zweig. Eine Studie über Magie und Religion), aus dem insbesondere das Motiv der sakral aufgeladenen (Selbst-)Opferung des Herrschers für das Gemeinwohl in Sutcliffs Geschichten eingeflossen sein könnte.
Auch vom Stoff her fantasynah sind schließlich Sutcliffs Sagennacherzählungen, von denen ihre mehrbändige Variante der Artussage, The Sword and the Circle (1981), The Light Beyond the Forest (1979) und The Road to Camlann (1981; auch als Sammelband The King Arthur Trilogy, dt. König Artus und die Abenteuer der Ritter von der Tafelrunde) am Bekanntesten sein dürfte. Mit dem charmanten Bilderbuch The Minstrel and the Dragon Pup (1993) liegt aus ihrer Feder auch noch eine echte Fantasygeschichte für Kinder vor.
Sutcliffs entscheidender Beitrag zum Genre kann jedoch in ihrer Gestaltung des Artusstoffs für erwachsene Leser, Sword at Sunset (1963, bisher keine deutsche Übersetzung), gesehen werden. Vordergründig handelt es sich auch bei der Geschichte des romano-britischen Kriegsherrn Artos, der als Ich-Erzähler im Angesicht des Todes auf sein Leben zurückblickt, um einen historischen Roman, der zudem als direkte Fortsetzung von The Lantern Bearers gelesen werden kann. Doch während die Artussage hier abseits jeder Tafelrundenromantik auf einen durchaus realistisch erscheinenden Kern um den Abwehrkampf der überwiegend keltisch und römisch geprägten Bevölkerung gegen die angelsächsischen Eroberer zurückgeführt wird, lässt Sutcliff zugleich mehrfach offen, ob nicht doch Übernatürliches im Spiel ist. Dem Leser steht es frei, selbst zu entscheiden, ob er die geschilderten Vorzeichen, Flüche und Prophezeiungen nur als Teil des Weltbilds einer spätantiken Gesellschaft sehen oder ihnen tatsächlich ein Eigenleben zubilligen möchte. Gesteigert wird das Verwirrspiel noch durch die Tatsache, dass der Ich-Erzähler durchaus reflektiert mit solchen Deutungen umzugehen weiß und spätestens im letzten Kapitel, das mit seinem Titel The Corn King die Mythen um Opferung und Wiederkehr des sakralen Königs evoziert, selbst gehörig dazu beiträgt, die eigene Legende erst zu schaffen.
Für alle Leser, die Freude daran haben, sich auch mit den der klassischen Fantasy benachbarten Gebieten zu befassen, hat Sutcliff also nach wie vor einiges zu bieten und sollte nicht in Vergessenheit geraten.
Bibliotheka Phantastika gratuliert Archie Weller, der heute 55 Jahre alt wird. Nachdem der erste, im Jahre 1981 veröffentlichte Roman The Day of the Dog des am 13. Juli 1957 in Subiaco im australischen Bundesstaat Westaustralien geborenen Archie Irving Kirkwood Weller noch autobiographische Bezüge aufwies und tief in die Lebenswelt der von ihrer ursprünglichen Lebensweise entfremdeten und an und in der Kultur des Weißen Mannes scheiternden Aborigines und Aborigine-Mischlinge eintauchte (und unter dem Titel Blackfellas auch verfilmt wurde), wandte er sich mit Land of the Golden Clouds (1998) einem postapokalyptischen Setting zu.
Schauplatz des unter dem Titel Der Mondredner (2000) auch auf Deutsch erschienenen Romans ist ein von den Verheerungen eines 3000 Jahre zurückliegenden Atomkriegs gezeichnetes Australien, in dem die wenigen Überlebenden 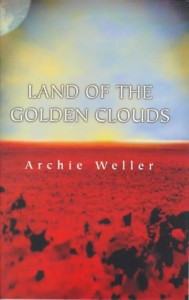 unterschiedliche Möglichkeiten gefunden haben, sich an die harten Lebensbedingungen anzupassen. Dabei leiden die an der Oberfläche lebenden, einander nicht unbedingt freundlich gesinnten Stämme, die sich in die wenigen nicht verstrahlten oder zur Wüste gewordenen Landstriche zurückgezogen haben, unter den nächtlichen Überfällen der unterirdisch lebenden, hellhäutigen und kannibalischen Nightstalkers. Und zwar so sehr, dass Red Mond Star Light, der Anführer des den Mond anbetenden kriegerischen Stammes der Ilkari, die Chance nutzt, die sich ihm durch die Begegnung mit der abtrünnigen Nightstalkerin S’shony bietet, und zusammen mit einer rasch wachsenden Schar von Gefährten aufbricht, den als King of the Bats bezeichneten Herrscher der Nightstalker zu töten.
unterschiedliche Möglichkeiten gefunden haben, sich an die harten Lebensbedingungen anzupassen. Dabei leiden die an der Oberfläche lebenden, einander nicht unbedingt freundlich gesinnten Stämme, die sich in die wenigen nicht verstrahlten oder zur Wüste gewordenen Landstriche zurückgezogen haben, unter den nächtlichen Überfällen der unterirdisch lebenden, hellhäutigen und kannibalischen Nightstalkers. Und zwar so sehr, dass Red Mond Star Light, der Anführer des den Mond anbetenden kriegerischen Stammes der Ilkari, die Chance nutzt, die sich ihm durch die Begegnung mit der abtrünnigen Nightstalkerin S’shony bietet, und zusammen mit einer rasch wachsenden Schar von Gefährten aufbricht, den als King of the Bats bezeichneten Herrscher der Nightstalker zu töten.
Auch wenn es zunächst so klingt, als wären Plot und Setting des Romans dem Handbuch für Genre-Autoren entnommen, besitzt Land of the Golden Clouds einen eigentümlichen Reiz – und geht letztlich über einen typischen Unterhaltungsroman deutlich hinaus. Denn die größte Aufgabe, die Red Mond Star Light und seine Mitstreiter und Mitstreiterinnen zu bewältigen haben, liegt nicht in der Durchquerung eines verwüsteten Kontinents oder der Vernichtung eines bösen, dunklen Herrschers, sondern darin, sich gegenseitig in ihrem Anderssein zu akzeptieren. Was in Anbetracht der sehr unterschiedlichen Gruppen, die sich nach und nach an der Queste beteiligen (darunter beispielsweise eine Gruppe Jamaikaner, die per Flugzeug gekommen sind – andernorts scheint der Atomkrieg nicht stattgefunden oder deutlich geringere Spuren zurückgelassen zu haben – und immer mal wieder Robert Nesta Marley zitieren, einen in ihrem Land hoch geachteteten Propheten; oder auch die Cricketeers), alles andere als leicht ist. Darüber hinaus ist auch eine über den zwischenmenschlichen Aspekt hinausgehende politische Lesart des Romans nicht nur möglich, sondern angesichts vieler Anspielungen auf die Gegenwart recht naheliegend (wobei manche dieser Anspielungen in Anbetracht der verstrichenen Zeitspanne schon etwas gezwungen wirken). Letztlich sollte man tatsächlich vor allem an solchen Themen und Fragestellungen oder Anspielungen Interesse haben, denn was vordergründige Spannung angeht, hat Land of the Golden Clouds deutlich weniger zu bieten als die meisten anderen Post-Doomsday-Romane, und zwar bis zum in dieser Hinsicht folgerichtig antiklimaktischen Ende.
Bibliotheka Phantastika erinnert an Fred Saberhagen, der heute vor fünf Jahren gestorben ist. Im Bereich der phantastischen Literatur ist Fred Thomas Saberhagen (geboren am 18. Mai 1930 in Chicago, Illinois), der mit der SF-Story “Volume PAA-PYX” im Februar 1961 in Galaxy debütierte und 1964 mit The Golden People den ersten einer Vielzahl von SF- und anderen Romanen vorlegte, vor allem durch drei Serien bzw. Zyklen bekannt geworden. Seine Reputation verdankt er dabei in erster Linie Berserker, einer insgesamt 17 Bände umfassenden SF-Reihe über eine Maschinenzivilisation, die alles Leben im Universum vernichten will (in etwa vergleichbar mit den Posbis aus den Anfangstagen von Perry Rhodan). 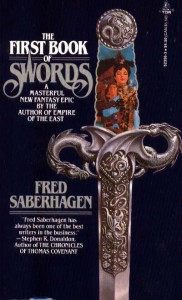 Für Fantasyleser und -leserinnen interessanter sind die Romane, die im Nachhinein unter dem Titel Earth’s End zusammengefasst wurden. Beginnend mit der Trilogie Empire of the East (The Broken Lands (1968), The Black Mountains (1971) und Changeling Earth (1973)) – die unter eben diesem Titel deutlich überarbeitet 1979 noch einmal als Sammelband aufgelegt wurde – entwirft Saberhagen hier eine Welt nach einer atomaren Katastrophe, in der besagte Katastrophe erhebliche Veränderungen bewirkt hat. So ist die Technologie der Vergangenheit entweder größtenteils vergessen oder “magisch” transformiert, wie überhaupt Magie in dieser neuen Welt einen besonderen Stellenwert einnimmt. Dieser Trilogie, die in zwei Bänden auch auf Deutsch erschienen ist (Reich des Ostens – Das gespaltene Land und Reich des Ostens – Die schwarzen Berge (beide 1984, wobei der zweite Band die Bände zwei und drei des Originals enthält)), folgt mit The First Book of Swords, The Second Book of Swords (beide 1983) und The Third Book of Swords (1984) der nächste Zyklus. Darin hat sich Jahrzehntausende später das Weltverständnis der handelnden Figuren zu einem rein magisch-mystischen entwickelt (was nicht zuletzt damit zusammenhängen dürfte, dass mittlerweile Götter auf den Plan getreten sind, die die Ereignisse um die magischen Schwerter überhaupt erst in Gang bringen), während die Leser in dem einen oder anderen Dämon durchaus noch eine beseelte, lebendig gewordene radioaktive Wolke erkennen können. In der Schwerter-Sequenz geht es – wie der Titel schon nahelegt – um Schwerter, magische Schwerter, von denen der Gott Vulcan zwölf geschmiedet hat und sie unter den Sterblichen verstreut. Doch was als Spiel gedacht war, um den Göttern die Langeweile zu vertreiben, wird auch für sie schnell tödlicher Ernst, denn mit den magischen Schwertern lassen sich selbst Götter töten. Die erste Schwerter-Sequenz war so erfolgreich, dass Saberhagen nachlegte und sich in acht unter dem Obertitel Book of Lost Swords subsummierten Bänden den Schwertern widmete, die in der ersten Trilogie zu kurz gekommen waren: Woundhealer’s Story (1986), Sightblinder’s Story (1987), Stonecutter’s Story (1988), Farslayer’s Story, Coinspinner’s Story (beide 1989), Mindsword’s Story (1990), Wayfinder’s Story (1992) und Shieldbreaker’s Story (1994). Den endgültigen Schlusspunkt unter Earth’s End setzte schließlich die 1995 erschiene Anthologie An Armory of Swords (u.a. mit Stories von Walter Jon Williams und Michael A. Stackpole), auch wenn Saberhagen 2006 mit Ardneh’s Sword noch einmal in die Epoche von Empire of the East zurückgekehrt ist.
Für Fantasyleser und -leserinnen interessanter sind die Romane, die im Nachhinein unter dem Titel Earth’s End zusammengefasst wurden. Beginnend mit der Trilogie Empire of the East (The Broken Lands (1968), The Black Mountains (1971) und Changeling Earth (1973)) – die unter eben diesem Titel deutlich überarbeitet 1979 noch einmal als Sammelband aufgelegt wurde – entwirft Saberhagen hier eine Welt nach einer atomaren Katastrophe, in der besagte Katastrophe erhebliche Veränderungen bewirkt hat. So ist die Technologie der Vergangenheit entweder größtenteils vergessen oder “magisch” transformiert, wie überhaupt Magie in dieser neuen Welt einen besonderen Stellenwert einnimmt. Dieser Trilogie, die in zwei Bänden auch auf Deutsch erschienen ist (Reich des Ostens – Das gespaltene Land und Reich des Ostens – Die schwarzen Berge (beide 1984, wobei der zweite Band die Bände zwei und drei des Originals enthält)), folgt mit The First Book of Swords, The Second Book of Swords (beide 1983) und The Third Book of Swords (1984) der nächste Zyklus. Darin hat sich Jahrzehntausende später das Weltverständnis der handelnden Figuren zu einem rein magisch-mystischen entwickelt (was nicht zuletzt damit zusammenhängen dürfte, dass mittlerweile Götter auf den Plan getreten sind, die die Ereignisse um die magischen Schwerter überhaupt erst in Gang bringen), während die Leser in dem einen oder anderen Dämon durchaus noch eine beseelte, lebendig gewordene radioaktive Wolke erkennen können. In der Schwerter-Sequenz geht es – wie der Titel schon nahelegt – um Schwerter, magische Schwerter, von denen der Gott Vulcan zwölf geschmiedet hat und sie unter den Sterblichen verstreut. Doch was als Spiel gedacht war, um den Göttern die Langeweile zu vertreiben, wird auch für sie schnell tödlicher Ernst, denn mit den magischen Schwertern lassen sich selbst Götter töten. Die erste Schwerter-Sequenz war so erfolgreich, dass Saberhagen nachlegte und sich in acht unter dem Obertitel Book of Lost Swords subsummierten Bänden den Schwertern widmete, die in der ersten Trilogie zu kurz gekommen waren: Woundhealer’s Story (1986), Sightblinder’s Story (1987), Stonecutter’s Story (1988), Farslayer’s Story, Coinspinner’s Story (beide 1989), Mindsword’s Story (1990), Wayfinder’s Story (1992) und Shieldbreaker’s Story (1994). Den endgültigen Schlusspunkt unter Earth’s End setzte schließlich die 1995 erschiene Anthologie An Armory of Swords (u.a. mit Stories von Walter Jon Williams und Michael A. Stackpole), auch wenn Saberhagen 2006 mit Ardneh’s Sword noch einmal in die Epoche von Empire of the East zurückgekehrt ist.
Fred Saberhagens dritter großer Zyklus dreht sich um Dracula, den er in zehn Bänden – von The Dracula Tape (1975; dt. Die Geständnisse des Grafen 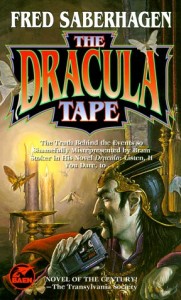 Dracula (2006)) bis A Coldness in the Blood (2002) – als intelligentes, charmantes und humorvolles Wesen schildert. Einzelne Bände der Sequenz (etwa der bereits erwähnte The Dracula Tape, der sich explizit auf Stokers Roman bezieht und die Geschichte – dieses Mal wahr und richtig – aus Draculas Sicht erzählt, oder The Holmes-Dracula File (1978) oder Séance for a Vampire (1994), in dem Sherlock Holmes ebenfalls eine Rolle spielt) warten dabei durchaus mit interessanten Ideen und Entwicklungen auf und können als gelungen betrachtet werden, auch wenn Saberhagens Dracula im Vergleich mit Chelsea Quinn Yarbros ähnlich angelegtem Saint-Germain letztlich doch verblasst. Einmal mehr um Götter bzw. um mehr oder weniger verfremdet nacherzählte Sagen aus der griechischen und – in Band fünf – nordischen Mythologie geht es im letzten Mehrteiler, den Fred Saberhagen verfasst hat, dem fünfbändigen Book of the Gods (The Face of Apollo (1998), Ariadne’s Web, The Arms of Hercules (beide 2000), God of the Golden Fleece (2001) und Gods of Fire and Thunder (2002)). Fred Saberhagen war sicher nie der große Stilist, und in (dem durchaus farbig und spannend erzählten) Empire of the East schimmert der Kalte Krieg vielleicht ein bisschen zu sehr durch, während die letzten Books of Lost Swords darunter leiden, dass die Sequenz schlicht zu lang ist. Andererseits funktionieren vor allem die ersten drei (auch auf Deutsch als Das erste Buch der Schwerter (1984), Das zweite Buch der Schwerter (1985) und Das dritte Buch der Schwerter (1986) sowie als Sammelband Das Buch der Schwerter (1987)) erschienenen) Romane um die magischen Schwerter als vordergründig abenteuerliche Fantasy vor einem – immer mal wieder dezent durchschimmernden – SF-Hintergrund sehr gut. Und in ihnen kann man auf Ideen stoßen – wie etwa die, dass die Macht der Götter auf ganz bestimmte Weise von ihren Gläubigen abhängt –, die inzwischen in der Fantasy weit verbreitet sind, die jedoch zu dem Zeitpunkt, da die Bücher geschrieben wurden, durchaus originell waren.
Dracula (2006)) bis A Coldness in the Blood (2002) – als intelligentes, charmantes und humorvolles Wesen schildert. Einzelne Bände der Sequenz (etwa der bereits erwähnte The Dracula Tape, der sich explizit auf Stokers Roman bezieht und die Geschichte – dieses Mal wahr und richtig – aus Draculas Sicht erzählt, oder The Holmes-Dracula File (1978) oder Séance for a Vampire (1994), in dem Sherlock Holmes ebenfalls eine Rolle spielt) warten dabei durchaus mit interessanten Ideen und Entwicklungen auf und können als gelungen betrachtet werden, auch wenn Saberhagens Dracula im Vergleich mit Chelsea Quinn Yarbros ähnlich angelegtem Saint-Germain letztlich doch verblasst. Einmal mehr um Götter bzw. um mehr oder weniger verfremdet nacherzählte Sagen aus der griechischen und – in Band fünf – nordischen Mythologie geht es im letzten Mehrteiler, den Fred Saberhagen verfasst hat, dem fünfbändigen Book of the Gods (The Face of Apollo (1998), Ariadne’s Web, The Arms of Hercules (beide 2000), God of the Golden Fleece (2001) und Gods of Fire and Thunder (2002)). Fred Saberhagen war sicher nie der große Stilist, und in (dem durchaus farbig und spannend erzählten) Empire of the East schimmert der Kalte Krieg vielleicht ein bisschen zu sehr durch, während die letzten Books of Lost Swords darunter leiden, dass die Sequenz schlicht zu lang ist. Andererseits funktionieren vor allem die ersten drei (auch auf Deutsch als Das erste Buch der Schwerter (1984), Das zweite Buch der Schwerter (1985) und Das dritte Buch der Schwerter (1986) sowie als Sammelband Das Buch der Schwerter (1987)) erschienenen) Romane um die magischen Schwerter als vordergründig abenteuerliche Fantasy vor einem – immer mal wieder dezent durchschimmernden – SF-Hintergrund sehr gut. Und in ihnen kann man auf Ideen stoßen – wie etwa die, dass die Macht der Götter auf ganz bestimmte Weise von ihren Gläubigen abhängt –, die inzwischen in der Fantasy weit verbreitet sind, die jedoch zu dem Zeitpunkt, da die Bücher geschrieben wurden, durchaus originell waren.
Bibliotheka Phantastika gratuliert Mark Helprin, der heute 65 Jahre alt wird. Der am 28.06.1947 in New York geborene Helprin tat sich in den letzten Jahren vor allem als konservativer Kommentator hervor, unter anderem in der New York Times zum Thema Internet und Urheberrecht. Neben seinem Roman-Debut Refiner’s Fire: The Life and Adventures of Marshall Pearl, a Foundling (1977, dt. Es wird sie läutern wie Gold bzw. Der Findling (1979)) und einigen weiteren Kurzgeschichtensammlungen und Romanen sticht vor allem sein 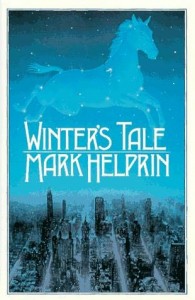 Epos Winter’s Tale (1983, dt. Wintermärchen (1984)) aus seinem Oeuvre hervor: Die Geschichte des Waisenjungen Peter Lake, der auf verschlungenen Pfaden (und auf dem Rücken des weißen Hengstes Athansor) bis in die High Society des New York kurz nach der Jahrhundertwende gelangt und eng mit der Geschichte der aufrichtigen Verlegerfamilie Penn verknüpft ist, den Herausgebern der Zeitung Sun, erinnert im Erzählduktus – auch wenn sich Helprin dagegen stets verwahrte – stark an den südamerikanischen magischen Realismus. Eigentlich ohne offene Magie dargestellt, strahlt doch jedes Detail der Stadt einen eigenen Zauber aus, der durch den Fokus der Erzählung auf die klirrend kalten Winter während der Übergangszeit in die Moderne noch erhöht wird: Unverständlich schöne Maschinen, die gleichsam das Getriebe der Stadt sein könnten, Brücken, die nicht nur über New Yorks Wasserwege, sondern viel weiter hinaus führen, finstere Gangs und leuchtend-entrückte Menschen, die die allerorten aufregenden, aber auch schrecklichen Straßen der Stadt bevölkern, und der kalte Winterhauch, der einem aus den Seiten entgegenweht. Die schwelgerische Pracht der alternativen Stadtchronik von Winter’s Tale setzt heute noch Maßstäbe in Sachen phantastisch-verfremdete Metropolen, und auch wenn Helprin sich später nur noch in der dreibändigen Jugendbuchreihe Swan Lake, A City in Winter und The Veil of Snows (1989, 1996, 1997) eindeutig der Phantastik zuwandte (und einem winterlichen Setting, in dem er diesmal eine phantastische Version der Ereignisse rund um die Russische Revolution erzählte), lohnt es sich auch heute noch, Helprins magischem Manhattan einen Besuch abzustatten.
Epos Winter’s Tale (1983, dt. Wintermärchen (1984)) aus seinem Oeuvre hervor: Die Geschichte des Waisenjungen Peter Lake, der auf verschlungenen Pfaden (und auf dem Rücken des weißen Hengstes Athansor) bis in die High Society des New York kurz nach der Jahrhundertwende gelangt und eng mit der Geschichte der aufrichtigen Verlegerfamilie Penn verknüpft ist, den Herausgebern der Zeitung Sun, erinnert im Erzählduktus – auch wenn sich Helprin dagegen stets verwahrte – stark an den südamerikanischen magischen Realismus. Eigentlich ohne offene Magie dargestellt, strahlt doch jedes Detail der Stadt einen eigenen Zauber aus, der durch den Fokus der Erzählung auf die klirrend kalten Winter während der Übergangszeit in die Moderne noch erhöht wird: Unverständlich schöne Maschinen, die gleichsam das Getriebe der Stadt sein könnten, Brücken, die nicht nur über New Yorks Wasserwege, sondern viel weiter hinaus führen, finstere Gangs und leuchtend-entrückte Menschen, die die allerorten aufregenden, aber auch schrecklichen Straßen der Stadt bevölkern, und der kalte Winterhauch, der einem aus den Seiten entgegenweht. Die schwelgerische Pracht der alternativen Stadtchronik von Winter’s Tale setzt heute noch Maßstäbe in Sachen phantastisch-verfremdete Metropolen, und auch wenn Helprin sich später nur noch in der dreibändigen Jugendbuchreihe Swan Lake, A City in Winter und The Veil of Snows (1989, 1996, 1997) eindeutig der Phantastik zuwandte (und einem winterlichen Setting, in dem er diesmal eine phantastische Version der Ereignisse rund um die Russische Revolution erzählte), lohnt es sich auch heute noch, Helprins magischem Manhattan einen Besuch abzustatten.
Bibliotheka Phantastika gratuliert Stephan Grundy, der am 28. Juni 1967 in New York geboren wurde. Deutschen Lesern und Leserinnen dürfte Grundy, der seine Dissertation über Wotan an der Universität Cambridge einreichte und außerdem Sachbücher über germanische Mythologie und Neopaganismus (dem er auch selbst angehört) schreibt, besonders durch seinen Debütroman Rhinegold (1994; dt. 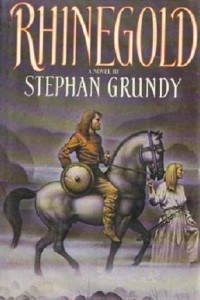 Rheingold (1992)) ein Begriff sein. Der Roman sollte eine (sehr freie) Nacherzählung der Völsungen-Saga sein und wurde Anfang der 1990er gerade in der deutschsprachigen Verlagswelt stark gehypt. Auch seine folgenden beiden Werke bauten auf Sagenstoffe auf. Attila’s Treasure (dt. Wodans Fluch, beide 1996) dient als Fortsetzung zu Rheingold, beschäftigt sich Grundy darin doch intensiver mit der Figur Hagen von Tronjes als mit dem (im Original titelgebenden) Hunnenkönig. In Gilgamesh (Gilgamesch, Herr des Zweistromlandes, beide 1999) wird das sumerische Gilgamesch-Epos frei nacherzählt.
Rheingold (1992)) ein Begriff sein. Der Roman sollte eine (sehr freie) Nacherzählung der Völsungen-Saga sein und wurde Anfang der 1990er gerade in der deutschsprachigen Verlagswelt stark gehypt. Auch seine folgenden beiden Werke bauten auf Sagenstoffe auf. Attila’s Treasure (dt. Wodans Fluch, beide 1996) dient als Fortsetzung zu Rheingold, beschäftigt sich Grundy darin doch intensiver mit der Figur Hagen von Tronjes als mit dem (im Original titelgebenden) Hunnenkönig. In Gilgamesh (Gilgamesch, Herr des Zweistromlandes, beide 1999) wird das sumerische Gilgamesch-Epos frei nacherzählt.
Gemeinsam mit seiner Frau verfasste er danach die Falcon Dreams Series (dt. Falken-Trilogie, 2000-2002), die – wie kann es anders sein – im Heiligen Römischen Reich spielt, allerdings im 14. Jahrhundert. Darin wird Margerite von Hirschenberg nicht nur in eine Verschwörung böser Satanisten hineingezogen und muss diese abwenden, sondern muss auch noch ihre Liebe vor Fährnissen bewahren.
Das Beowulf-Lied wollte Grundy eigentlich schon in seinem ersten Roman verarbeiten, erst auf Anraten seines damaligen Professors wählte er stattdessen die Völsungen-Saga als Vorlage. Nach der Falken-Trilogie widmete er sich jedoch diesem lang gehegten Projekt und verfasste den Roman Beowulf, der 2010 via Self-publishing veröffentlicht wurde. Der Auftakt eines weiteren Zyklus Emperor’s Ghost ist dagegen noch nicht in Druck gegangen.
Bibliotheka Phantastika gratuliert John Maddox Roberts, der heute 65 Jahre alt wird. Der am 25. Juni 1947 in Ohio geborene Roberts, dessen Karriere mit der Veröffentlichung seines Erstlings – des SF-Romans The Strayed Sheep of Charum – im Jahre 1977 begann, hat sich seither als überaus produktiver Autor erwiesen, dessen Schwerpunkte im Bereich der SF, der Fantasy und des (historischen) Krimis liegen. In der Fantasy ist er vor allem durch seine insgesamt acht Conan-Pastiches – Conan the Valorous (1985), Conan the Champion (1987), Conan the Marauder (1988), Conan the Bold (1989), Conan the Rogue (1991), Conan and the Treasure of Python (1993), Conan and the Manhunters (1994) und Conan and the Amazon (1995) – bekannt geworden, die gemeinhin zu den besseren Hervorbringungen ihrer Art gezählt werden, auch wenn die Titelfigur mit dem von Robert E. Howard erfundenen Helden nur den Namen und das Aussehen gemeinsam hat. Zum Teil liegt das sicher an den Vorgaben, die der Verlag den Autoren der Pastiches gemacht hat, zum Teil aber auch daran – wie Roberts selbst freimütig zugibt –, dass actionzentrierte, sich um eine einzelne Hauptfigur drehende Sword & Sorcery sich am besten in kürzeren Erzählungen umsetzen lässt. Aber all diesen Vorbehalten zum Trotz funktionieren Roberts’ Conan-Pastiches (im Gegensatz zu denen mancher seiner Kollegen) als Fantasy-Abenteuerromane mit einem im Vergleich zum Vorbild nicht ganz so gewalttätigen und dafür etwas gewitzteren Helden recht ordentlich.
Den Conan-Romanen stilistisch am ähnlichsten dürften die vier historischen Romane um The Falcon sein, die Roberts Anfang der 80er Jahre unter dem Pseudonym Mark Ramsay verfasst hat. Der Titelheld ist ein heimkehrender Kreuzritter, der den Tod seines Vaters rächen will und dazu eine Gruppe von Söldnern zusammentrommelt, die fürderhin gemeinsam reiten und streiten.
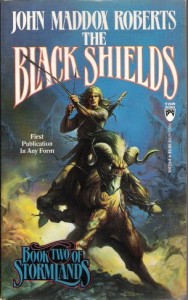 Problemlos als Fantasy (mit einem zugegebenermaßen geringen bzw. im eigentlichen Sinne nicht vorhandenen Magie-Anteil) lassen sich der Roman King of the Wood und die fünfteilige Saga um die Stormlands lesen. Während King of the Wood ein Alternativweltroman ist, in dem Nordamerika deutlich früher als in unserer Realität von Flüchtlingen aus Europa entdeckt und besiedelt wurde, spielen die fünf Romane der Stormland-Sequenz (The Islander (1990), The Black Shields (1991), The Poisoned Lands (1992), The Steel Kings (1993) und Queens of Land and Sea (1994)) auf einer einst hochzivilisierten Welt, die in die Barbarei zurükgefallen ist, nachdem die Rohstoffe verbraucht waren, die für den Erhalt einer Hochzivilisation erforderlich sind. Allerdings nutzt Roberst diesen nicht uninteressanten (und nicht unkritischen) Ansatz letztlich nur, um eine mehr oder weniger belanglose Abenteuerhandlung zu erzählen, bei der es auch um die Wiederentdeckung verlorengegangener Technik und Technologie geht.
Problemlos als Fantasy (mit einem zugegebenermaßen geringen bzw. im eigentlichen Sinne nicht vorhandenen Magie-Anteil) lassen sich der Roman King of the Wood und die fünfteilige Saga um die Stormlands lesen. Während King of the Wood ein Alternativweltroman ist, in dem Nordamerika deutlich früher als in unserer Realität von Flüchtlingen aus Europa entdeckt und besiedelt wurde, spielen die fünf Romane der Stormland-Sequenz (The Islander (1990), The Black Shields (1991), The Poisoned Lands (1992), The Steel Kings (1993) und Queens of Land and Sea (1994)) auf einer einst hochzivilisierten Welt, die in die Barbarei zurükgefallen ist, nachdem die Rohstoffe verbraucht waren, die für den Erhalt einer Hochzivilisation erforderlich sind. Allerdings nutzt Roberst diesen nicht uninteressanten (und nicht unkritischen) Ansatz letztlich nur, um eine mehr oder weniger belanglose Abenteuerhandlung zu erzählen, bei der es auch um die Wiederentdeckung verlorengegangener Technik und Technologie geht.
Deutlich besser ist da zweifellos die Serie, die vor allem die Nicht-Fantasyleser vermutlich mit dem Namen John Maddox Roberts verbinden: die unter dem Obertitel SPQR laufende inzwischen aus 13 Bänden bestehende, im Rom der ausgehenden Republik und der Bürgerkriege angesiedelte Krimiserie um Decius Caecilius Metellus, in der Roberts beweist, dass er deutlich mehr kann als belanglose Fantasyabenteuer verfassen. Und interessanterweise ist sein vielleicht bester Einzelroman einer, in dem er eine Krimigeschichte vor einem (nicht unbedingt für seine Originalität berühmten) Fantasyhintergrund ablaufen lässt: Murder in Tarsis (1996) erzählt von einem Mordfall in der Welt der Drachenlanze. Genau wie fast alle anderen hier erwähnten Werke von Roberts (mit Ausnahme von The Strayed Sheep of Charum und King of the Wood) ist auch dieser Fantasykrimi (unter dem Titel Mord in Tarsis (1998)) in deutscher Übersetzung erschienen.
Bibliotheka Phantastika gratuliert John Dickinson, der heute 50 Jahre alt wird. Man könnte ja eigentlich annehmen, dass dem am 24. Juni 1962 in London geborenen John Geoffrey Hyett Dickinson das Talent zum Schreiben sozusagen in die Wiege gelegt wurde, schließlich ist sein Vater Peter Dickinson ein bekannter Krimi- und Jugendbuchautor. Doch ganz so einfach ist es anscheinend doch nicht, denn John Dickinson entschloss sich erst nach einem Sabbatical im Jahre 2002, sein Glück als Hausmann und Autor zu versuchen, nachdem er zuvor 17 Jahre lang u.a. für das britische Verteidigungsministerium und die NATO gearbeitet hatte.
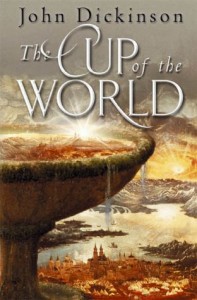 Zwei Jahre – und zwei für die Schublade geschriebene Romane – später war es dann soweit: Im Januar 2004 erschien mit The Cup of the World der erste Band einer gleichnamigen Fantasy-Jugendbuchtrilogie, die ein Jahr später mit The Widow and the King fortgesetzt und 2008 mit The Fatal Child abgeschlossen wurde. Im Mittelpunkt des ersten Bandes der eher gemächlich erzählten Trilogie steht Prinzessin Phaedre, die vor dem Hintergrund einer realistisch geschilderten mittelalterlichen Welt mit magischen Einsprengseln eine sich als fatal erweisende Entscheidung trifft, indem sie den falschen Mann heiratet. Der zweite Band dreht sich dann um ihren Sohn Ambrose, der seine Herkunft und seine Bestimmung erst nach und nach erfährt, und der schließlich im dritten Band eine ähnlich fatale Entscheidung trifft wie einst seine Mutter. Was Dickinsons Trilogie von vielen ähnlich gelagerten Werken unterscheidet, sind neben dem sparsamen Einsatz magischer Elemente vor allem die subtil gezeichneten, stets aus nachvollziehbaren Beweggründen handelnden Figuren und die Tatsache, dass die Handlung von Intrigen auf privater und politischer Ebene vorangetrieben und bestimmt wird, während die durchaus vorkommenden Kämpfe und Schlachten zumeist im Off stattfinden.
Zwei Jahre – und zwei für die Schublade geschriebene Romane – später war es dann soweit: Im Januar 2004 erschien mit The Cup of the World der erste Band einer gleichnamigen Fantasy-Jugendbuchtrilogie, die ein Jahr später mit The Widow and the King fortgesetzt und 2008 mit The Fatal Child abgeschlossen wurde. Im Mittelpunkt des ersten Bandes der eher gemächlich erzählten Trilogie steht Prinzessin Phaedre, die vor dem Hintergrund einer realistisch geschilderten mittelalterlichen Welt mit magischen Einsprengseln eine sich als fatal erweisende Entscheidung trifft, indem sie den falschen Mann heiratet. Der zweite Band dreht sich dann um ihren Sohn Ambrose, der seine Herkunft und seine Bestimmung erst nach und nach erfährt, und der schließlich im dritten Band eine ähnlich fatale Entscheidung trifft wie einst seine Mutter. Was Dickinsons Trilogie von vielen ähnlich gelagerten Werken unterscheidet, sind neben dem sparsamen Einsatz magischer Elemente vor allem die subtil gezeichneten, stets aus nachvollziehbaren Beweggründen handelnden Figuren und die Tatsache, dass die Handlung von Intrigen auf privater und politischer Ebene vorangetrieben und bestimmt wird, während die durchaus vorkommenden Kämpfe und Schlachten zumeist im Off stattfinden.
Im englischen Sprachraum konnte The Cup of the World mit einer begeisterten Rezension im Guardian punkten, ohne dass dies dem Roman und seinen Folgebänden allerdings massenhaft Leser und Leserinnen beschert hätte. Dass die mit den Titeln Die Schlange am Rande der Welt (2010), Der Prinz unter dem Himmel und Das Kind des Schicksals (beide 2011) erschienene deutsche Ausgabe hierzulande kaum Resonanz gefunden hat, ist hingegen in einer Zeit, in der Fantasy im engeren Sinne eigentlich – von wenigen Ausnahmen abgesehen – nur einen nennenswerten Leserzuspruch findet, wenn sie entweder grim & gritty ist oder zur Reihe der Tolkienvölker-Romane zählt, nicht weiter verwunderlich.
Seit Beendigung seiner Fantasytrilogie hat John Dickinson inzwischen den im 18. Jahrhundert in Deutschland spielenden historischen Roman The Lightstep (2009) sowie den SF-Roman WE (2010) vcröffentlicht, und man darf durchaus gespannt sein, was in Zukunft noch von ihm kommen wird.