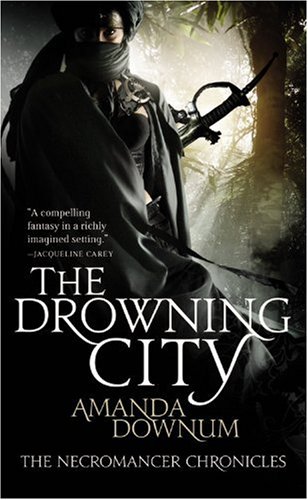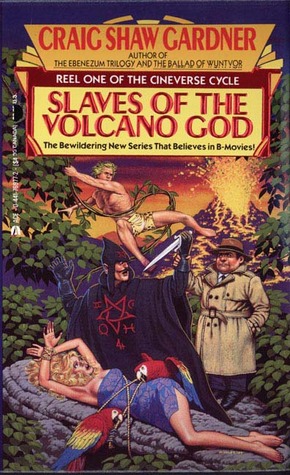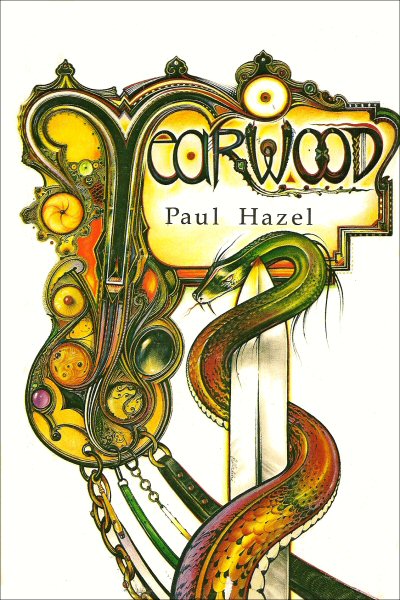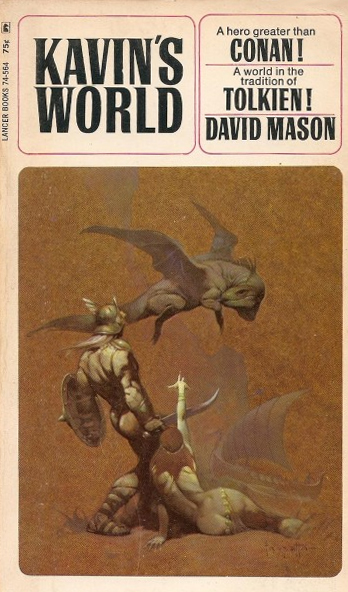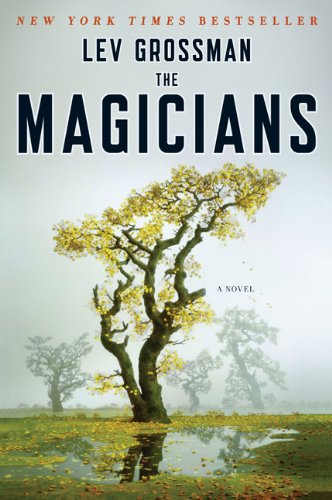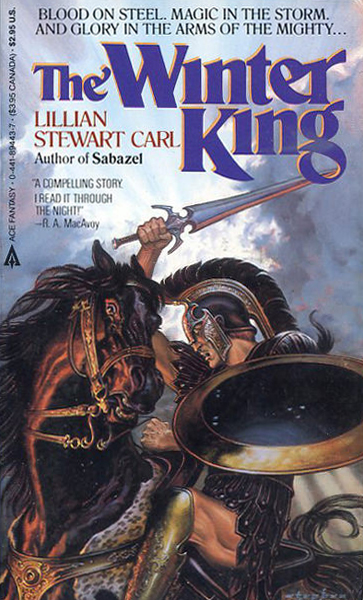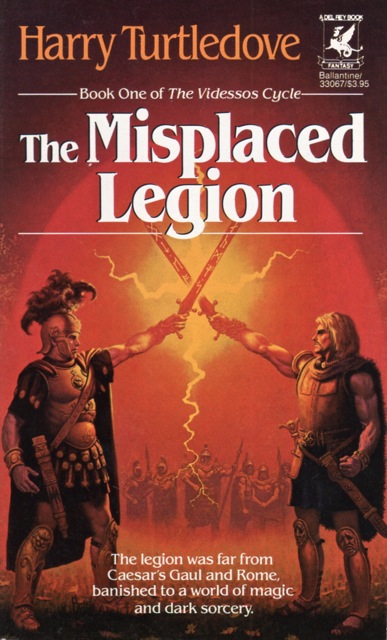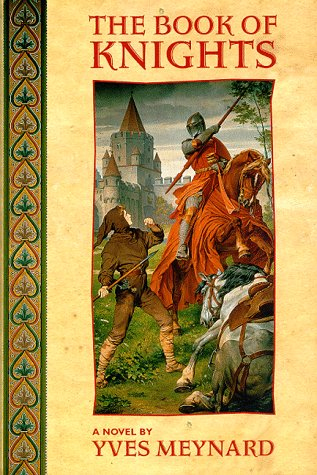Bibliotheka Phantastika gratuliert Glen Cook, der heute 70 Jahre alt wird. Dem Teil unserer Stammleserschaft, der öfter mal in unser Forum schaut, wird der nachfolgende Beitrag wenig oder gar nichts Neues bringen, denn ungeachtet der Tatsache, dass nur ein knappes Viertel seiner rund 50 Romane ins Deutsche 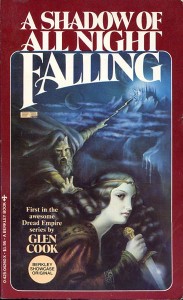 übersetzt wurde, ist der am 09. Juli 1944 in New York City geborene Glen Charles Cook einer der Autoren, deren Werke dort immer mal wieder erwähnt bzw. diskutiert werden. Cooks erste, dem Genre zuzurechnende Veröffentlichung war die Fantasystory “Silverheels” im Magazin Witchcraft & Sorcery # 6 im Mai 1971, die in der gleichen Welt spielt wie der Romanzyklus um das Dread Empire, der allerdings erst ein paar Jahre später erscheinen sollte. Auf zwei, drei weitere SF- und Fantasystories folgte als erster Roman The Heirs of Babylon (1972), ein Post-Doomsday-Roman, und danach ging es mit einer oder zwei Geschichten pro Jahr tröpfchenweise weiter – bis 1979.
übersetzt wurde, ist der am 09. Juli 1944 in New York City geborene Glen Charles Cook einer der Autoren, deren Werke dort immer mal wieder erwähnt bzw. diskutiert werden. Cooks erste, dem Genre zuzurechnende Veröffentlichung war die Fantasystory “Silverheels” im Magazin Witchcraft & Sorcery # 6 im Mai 1971, die in der gleichen Welt spielt wie der Romanzyklus um das Dread Empire, der allerdings erst ein paar Jahre später erscheinen sollte. Auf zwei, drei weitere SF- und Fantasystories folgte als erster Roman The Heirs of Babylon (1972), ein Post-Doomsday-Roman, und danach ging es mit einer oder zwei Geschichten pro Jahr tröpfchenweise weiter – bis 1979.
Denn mit A Shadow of All Night Falling kam in besagtem Jahr nicht nur der Auftakt der Dread Empire Trilogy auf den Markt, sondern das Erscheinen dieses Romans kennzeichnet darüberhinaus den Beginn einer Phase, in der Glen Cook überaus produktiv war (vor allem, wenn man bedenkt, dass er die ganze Zeit über bei GM angestellt war und somit nur nebenberuflich geschrieben hat) und den jeweiligen Grundstein für all die Zyklen gelegt hat, die seinen Ruf begründet und ihn zu so etwas wie einem Kultautor gemacht haben. A Shadow of All Night Falling und die Folgebände October’s Baby und All Darkness Met (beide 1980) erzählen die Geschichte eines gewaltigen Krieges – oder, genauer, des gewaltigsten Krieges seit Menschengedenken (auch wenn es Figuren gibt, die sich an noch größere Kriege erinnern können) –, vor allem und in erster Linie drehen sich die drei Romane aber um die Schicksale einer Handvoll Personen, die auf die eine oder andere Weise miteinander verbunden sind. Das fängt an mit Mocker, dem kauderwelschenden Scharlatan, dessen Ziele lange Zeit so unklar bleiben wie seine Herkunft, geht weiter mit Nepanthe, der Tochter der Storm Kings von Iwa Skolovda, die anfangs nur eine Schachfigur in einem komplizierten Intrigenspiel ist, und mit Varthlokkur, dem letzten Erben von Ilkazar und gefürchtetsten Magier des Westens, bis sich allmählich Bragi Ragnarson in den Mittelpunkt des Geschehens schiebt, ein Nordmann und Abenteurer, der plötzlich mitten in einem Schlamassel steckt, der dem, dessentwegen er seine Heimat verlassen hat, verdammt ähnlich ist (und der den zwielichtigen Mocker von früher kennt). Ebenfalls eine nicht ganz unwichtige Rolle spielen Haroun bin Yousif, der König ohne Thron, und Mist, eine Prinzessin (und kurzfristige Kaiserin von Shinsan, dem Reich, das dem ganzen Zyklus seinen Titel gibt). Und dann ist da natürlich noch der Star Rider … Glen Cooks Dread Empire Trilogy ist ganz gewiss kein leichter, eingängiger Lesestoff. Als Leser wird man sehr unvermittelt ins Geschehen geworfen, und auch wenn es Cook von Anfang an gelingt, ebensosehr ein Gefühl für große Zeiträume zu vermitteln wie auch dafür, Zeuge gewaltiger, welterschütternder Ereignisse zu sein, dauert es einige Zeit, bis die Figuren an Konturen und Charaktertiefe gewinnen. Andererseits stehen trotz des epischen Rahmens immer die Figuren und ihre nur allzu menschlichen Hoffnungen und Wünsche, 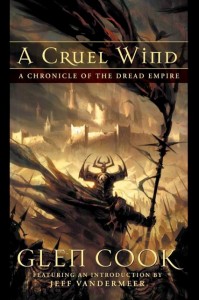 ihr Leiden und ihre Enttäuschungen im Fokus. Glen Cook erzählt in der (auch als Sammelband unter dem Titel A Cruel Wind (2006) erschienenen) Dread Empire Trilogy zwar von einem großen Krieg, aber vor allem von menschlichen Schicksalen.
ihr Leiden und ihre Enttäuschungen im Fokus. Glen Cook erzählt in der (auch als Sammelband unter dem Titel A Cruel Wind (2006) erschienenen) Dread Empire Trilogy zwar von einem großen Krieg, aber vor allem von menschlichen Schicksalen.
Mit The Swordbearer (1982) folgte ein Einzelband, in dem es um die Geschichte Gathrids geht, eines jungen Mannes, der von Heldentaten und Ruhm träumt und der eines Tages ein uraltes magisches Schwert findet und dadurch plötzlich die Chance bekommt, seine Träume Wirklichkeit werden zu lassen und sich an den Mördern seiner Familie zu rächen – allerdings muss er bald feststelle, dass die Sache einen verdammt großen Haken hat. Im gleichen Jahr erschien mit der Starfishers Trilogy eine komplette SF-Trilogie, ehe Cook sich mit den beiden Prequels The Fire in His Hands (1984) und With Mercy Toward None (1985) wieder dem Dread Empire zuwandte. In den beiden (auch als Sammelband A Fortress In Shadow (2007) erschienenen) Bänden lernen wir nicht nur den Propheten El Murid kennen, der davon träumt, die Stämme der Wüste Hammad al Nakir zu einen und ihnen Frieden, Gerechtigkeit und Wohlstand zu bringen, sondern begegnen u.a. auch Haroun bin Yousif, Bragi Ragnarson und Mocker wieder und erfahren mehr über ihre Vergangenheit.
Parallel zu diesen beiden Romanen kamen mit The Black Company, Shadows Linger (beide 1984) und The White Rose (1985) auch die ersten drei – gelegentlich auch als Books of the North bezeichneten – Bände des Werkes auf den Markt, das bis heute am ehesten mit Cooks Namen verknüpft (und vermutlich auch sein erfolgreichstes) ist: die Chronicles of the Black Company. Stilistisch noch ein bisschen schroffer als in seinen vorangegangenen Romanen lässt uns Glen Cook hier an den vom Ich-Erzähler Croaker geschilderten Abenteuern einer Söldnerkompanie teilhaben, die im Auftrag der – wie sie glaubt – guten Seite einen Aufstand nach dem anderen niederschlägt, bis … tja, bis sich nach und nach herausstellt, dass alles, was Croaker und die Seinen (und die Leser) zu wissen glaubten, vielleicht doch nicht so ganz der Wahrheit entspricht … In den drei (auch als Sammelband Chronicles of the Black Company (2007) erschienenen) Romanen begibt sich Cook endgültig auf das Level der grunts, der Frontschweine, die ihren Kopf (oder welchen Körperteil auch immer) hinhalten und Kriege ausfechten müssen, die aus ihnen unklaren Gründen ganz woanders beschlossen bzw. angezettelt wurden. Der Blutzoll, den die Söldner zu zahlen haben, ist hoch – und das bisschen Ruhm, das sie vielleicht erringen, schnell verblasst. Die mit Shadow Games, The Silver Spike (beide 1989), Dreams of Steel (1990) – auch als The Books of the South: Tales of the Black Company (2008) –, Bleak Seasons (1996), She is the Darkness (1997) – auch als The Return of the Black Company (2009) – sowie Water Sleeps (1999) und Soldiers Live (2000) – auch als The Many Deaths of the Black Company (2010) – fortgesetzten Chronicles of the Black Company lassen sich zweifellos der Grim-&-Gritty-Fantasy zurechnen, wirken dabei aber am ehesten wie realistische Kriegsromane aus einer Fantasywelt.
Zwischen den zehn Bänden der Black Company sind Ende der 80er Jahre mit Reap the East Wind (1987) und An Ill Fate Marshalling (1988) die ersten beiden Bände einer Folgetrilogie zur Dread Empire Trilogy erschienen. Das Manuskript des dritten Bandes wurde Glen Cook damals gestohlen, und lange Zeit hat es so ausgesehen, als würde er nie mehr erscheinen, doch im Rahmen der Neuauflage der Dread Empire Chronicles hat Cook A Path to Coldness of Heart (2012) doch noch einmal (wenn auch sicher ein bisschen anders als damals geplant) neu geschrieben, so dass einschließlich der in An Empire Unacquainted with Defeat (2008) gesammelten Stories inzwischen praktisch das gesamte Dread-Empire-Material in Buchform vorliegt.
Ebenfalls in den 80ern – wie gesagt, Cook war da einige Jahre sehr fleißig – ist auch eine aus den Bänden Doomstalker, Warlock (beide 1985) und Ceremony (1986) bestehende Science-Fantasy-Trilogie mit dem Titel Darkwar (auch als gleichnamiger Sammelband (2009)) auf den Markt gekommen, dazu drei weitere SF-Romane und der Fantasyroman The Tower of Fear (1989), in dem so ziemlich alle Elemente, die Cooks Fantasy ausmachen, in stark eingedampfter Form enthalten sind (und der außerdem mit einer faszinierend ambivalenten Hauptfigur aufwartet).
Last but not least hatte in diesem Jahrzehnt auch der Privatdetektiv Garrett (in Sweet Silver Blues (1987)) seinen ersten Auftritt. Garrett ist ganz eindeutig ein Nachfahre von Sam Spade und Philip Marlowe, der seine unter dem Obertitel Garrett, P.I. laufenden Abenteuer allerdings in einer Fantasywelt erlebt – und das in mittlerweile vierzehn Bänden; auf den o.g. Auftaktband folgten Bitter Gold Hearts, Cold Copper Tears (beide 1988), Old Tin Sorrows (1989), Dread Brass Shadows (1990), Red Iron Nights (1991), Deadly Quicksilver Lies (1994), Petty Pewter Gods (1995), Faded Steel Heat (1999), Angry Lead Skies (2002), Whispering Nickel Idols (2005), Cruel Zinc Melodies (2008), Gilded Latten Bones (2010) und Wicked Bronze Ambition (2013).
Mit dem aus den Romanen The Tyranny of the Night (2005), Lord of the Silent Kingdom (2007), Surrender to the Will of the Night (2010) und Working God’s Mischief (2014) bestehenden, vierteiligen Zyklus The Instrumentalities of the Night ist Glen Cook (der diesen Zyklus gerne einen Band länger gemacht hätte) fast wieder ein bisschen zu seinen Anfängen zurückgekehrt, wobei das weder für die Ausgangssituation der in einem leicht verfremdeten Mittelmeerraum angesiedelten Handlung noch die Figurenkonstellation direkt gilt, sondern heißen soll, dass er sich wieder eines epischen Handlungsrahmens bedient, in den auch in diesem Fall viele kleinere Konflikte auf der persönlichen Ebene eingeflochten sind. Hinzu kommt eine nochmal gesteigerte Komplexität, die auch die Instrumentalities of the Night zu einem durchaus fordernden Lesestoff macht.
Was die deutschen Veröffentlichungen Cooks angeht, sieht es – wie eingangs erwähnt – eher nicht so gut aus. Außer den ersten drei Black-Company-Bänden, die es unter dem Obertitel Die Schwarze Schar (Einzeltitel: Im Dienst der Seelenfänger, Nacht über Juniper und Die Rückkehr des Bösen (alle 1999)) nach Deutschland geschafft haben, ist das nur Garrett, P.I.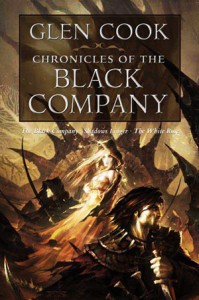 in einer als Die Rätsel von Karenta betitelten Serie neun Bände lang gelungen, die hierzulande als Zentaurengelichter, Fauler Zauber, Tempelhyänen, Geisterstunde, Schattentänzer (alle 1996), Heißes Eisen, Spitze Buben, Göttergetöse (alle 1997) und Goldfieber (2001) erschienen sind.
in einer als Die Rätsel von Karenta betitelten Serie neun Bände lang gelungen, die hierzulande als Zentaurengelichter, Fauler Zauber, Tempelhyänen, Geisterstunde, Schattentänzer (alle 1996), Heißes Eisen, Spitze Buben, Göttergetöse (alle 1997) und Goldfieber (2001) erschienen sind.
In den USA hingegen hat Glen Cook in den letzten Jahren eine Renaissance erlebt, die nicht nur zu einer Neuauflage (teils in Form der o.g. Sammelbände) seiner Werke aus den 80er und 90er Jahren geführt hat, sondern mit Winter’s Dreams (2012) auch einen zweiten Band mit seinen bislang verstreut in diversen Anthologien und Magazinen erschienenen Kurzgeschichten hervorgebracht hat.
Tag: Jubiläen
Bibliotheka Phantastika gratuliert Amanda Downum, die heute 35 Jahre alt wird. Die am 05. Juli 1979 in Virginia Beach, Virginia, geborene Amanda Downum zählt zur Garde der jungen Fantasy-Autorinnen und -Autoren, die in den letzten Jahren von sich reden gemacht haben, auch wenn sie – einigermaßen unverdient – längst noch nicht so bekannt ist wie einige ihrer Kolleginnen und Kollegen. Ihre ersten schriftstellerischen Gehversuche machte sie im Online-Magazin Strange Horizons, wo im Februar 2006 ihre Story “Wrack” veröffentlicht wurde, der rasch zwei weitere folgten, und mit “Snake Charmer” gelang ihr noch im gleichen Jahr der Sprung in die Print-Magazine (in diesem Fall Realms of Fantasy).
Sie schrieb weiterhin Kurzgeschichten, arbeitete aber parallel dazu an ihrem ersten Roman, der schließlich 2009 unter dem Titel The Drowning City auf den Markt kam und den Auftakt der Necromancer Chronicles darstellt, in deren Mittelpunkt die Nekromantin Isyllt Iskaldur steht. In The Drowning City hat Isyllt – unter falschem Namen und von zwei Söldnern begleitet – in Symir, der Hauptstadt des Reiches Sivahra, einen Auftrag ihres Heimatlandes zu erfüllen. Symir steht unter der Kontrolle des im Süden gelegenen Königreichs Assar, doch der Widerstand der einheimischen Bevölkerung gegen die Fremdherrschaft wächst, und es gibt Anzeichen, die auf eine bevorstehende Rebellion hindeuten. Eine derartige Rebellion käme den Herrschern von Isyllts Heimatland, die sich von den Expansionsgelüsten Assars bedroht fühlen, mehr als gelegen, und deshalb soll Isyllt Kontakt zu den Rebellen aufnehmen und sie in ihren Bestrebungen unterstützen. Allerdings erweist sich beides als nicht so einfach, denn die Rebellen sind keine homogene Gruppe – und schon bald hat Isyllt alle Hände voll zu tun, um in einem Wirrwarr aus politischen Intrigen, umstürzlerischen Umtrieben und magischen Gefahren überhaupt nur zu zu überleben … 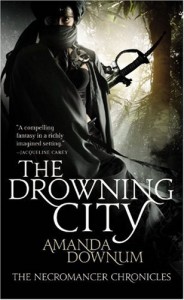 The Drowning City ist in mehrfacher Hinsicht ein recht ungewöhnlicher Fantasyroman. Das hat noch am wenigsten mit der Hauptfigur zu tun – die ist als Nekromantin zugegebenermaßen eine recht originelle Wahl, und die Einbindung von Magie ist generell recht gut gelungen – sondern mehr mit dem “realpolitischen” Ansatz, der dem Plot zugrundeliegt, vor allem aber mit dem Setting. Denn Symir – eine aus unzähligen Inselchen und Kanälen bestehende, im Delta eines gewaltigen Flusses gelegene, von dichtem Dschungel umgebene und unter monsunartigen Regenfällen leidende Stadt – ist einer der faszinierendsten Handlungsorte der modernen Fantasy. Was einerseits an besagten geographischen Bedingungen liegt, andererseits an der üppigen Geisterwelt und den (teils nur angedeuteten) mythologischen Zusammenhängen, die mit der Stadt direkt in Verbindung stehen. Symir ist im wahrsten Sinne des leicht doppeldeutigen Titels a “drowning” city (und profitiert hinsichtlich ihrer atmosphärischen Schilderung zweifellos davon, dass Amanda Downum einige Jahre in Indonesien und Mikronesien verbracht hat).
The Drowning City ist in mehrfacher Hinsicht ein recht ungewöhnlicher Fantasyroman. Das hat noch am wenigsten mit der Hauptfigur zu tun – die ist als Nekromantin zugegebenermaßen eine recht originelle Wahl, und die Einbindung von Magie ist generell recht gut gelungen – sondern mehr mit dem “realpolitischen” Ansatz, der dem Plot zugrundeliegt, vor allem aber mit dem Setting. Denn Symir – eine aus unzähligen Inselchen und Kanälen bestehende, im Delta eines gewaltigen Flusses gelegene, von dichtem Dschungel umgebene und unter monsunartigen Regenfällen leidende Stadt – ist einer der faszinierendsten Handlungsorte der modernen Fantasy. Was einerseits an besagten geographischen Bedingungen liegt, andererseits an der üppigen Geisterwelt und den (teils nur angedeuteten) mythologischen Zusammenhängen, die mit der Stadt direkt in Verbindung stehen. Symir ist im wahrsten Sinne des leicht doppeldeutigen Titels a “drowning” city (und profitiert hinsichtlich ihrer atmosphärischen Schilderung zweifellos davon, dass Amanda Downum einige Jahre in Indonesien und Mikronesien verbracht hat).
Natürlich hat der Roman auch seine Schwächen – etwa in der Figurenführung –, doch diese hat Amanda Downum in den Folgebänden The Bone Palace (2010) – in dem Isyllt in Erisín, der Hauptstadt ihres Heimatlands Selafai in ein sowohl weltliches wie magisches Komplott gegen die Krone verwickelt wird – und The Kingdoms of Dust (2012) – in dem es sie nach dramatischen Entwicklungen in ihrem Leben in die Wüsten von Assar (sprich: ins Land der Erzfeinde Selafais) verschlägt – so ziemlich abgestellt. Darüber hinaus beweist sie in ihnen, dass sie mehr als ein Setting mit Leben erfüllen kann. Und wohl auch gerne weiterhin erfüllen würde, denn dem Vernehmen nach würde Amanda Downum die Necromancer Chronicles (deren bislang erschienene Bände primär durch ihre Hauptfigur miteinander verbunden sind, so dass man sie im Prinzip auch unabhängig voneinander lesen kann) gerne fortsetzen – wenn der Verlag denn mitspielen würde. Doch wie es aussieht, wird es für die nähere Zukunft bei den o.g. Romanen – und der in der gleichen Welt spielenden Erzählung “The Bone Garden” in der Anthologie A Fantasy Medley 2 (2012) – bleiben, denn bei dem für das nächste Jahr angekündigten Titel Dreams of Shreds and Tatters handelt es sich um einen Urban-Fantasy-Roman, in dem der “King in Yellow” eine wichtige Rolle spielen soll.
Bibliotheka Phantastika gratuliert Craig Shaw Gardner, der heute 65 Jahre alt wird. Der am 02. Juli 1949 in Rochester im amerikanischen Bundesstaat New York geborene Craig Shaw Gardner feierte sein Debüt als Schriftsteller 1978 mit der Kurzgeschichte “Rocket Roll” in der Frühjahrsausgabe des Magazins Unearth, auf die rasch weitere Stories folgen sollten. In einer dieser Geschichten, nämlich der im gleichen Jahr in der Oktoberausgabe von Fantastic erschienenen und in der Anthologie The Year’s Best Fantasy Stories: 5 (1980) nachgedruckten “A Malady of Magicks”, hatte der Magier Ebenezum seinen ersten Auftritt – und es sollte nicht sein letzter bleiben.
Zunächst trieb der an Magieallergie leidende Ebenezum in mehreren Original-Anthologien sein Unwesen, doch 1986 erschien mit A Malady of Magicks ein sogenanntes Fix-up, d.h. ein Roman, der aus den bislang veröffentlichten Geschichten zusammengesetzt und um neues Material ergänzt worden war und zugleich den Auftakt der Ebenezum Trilogy bildet, die mit A Multitude of Monsters (1986) und A Night in the Netherhells (1987) fortgesetzt wurde. Die Titel deuten ebenso wie das Konzept eines an Magieallergie leidenden Magiers bereits darauf hin, dass es sich bei diesen Romanen um Funny Fantasy bzw. humoristische Fantasy handelt – und zwar von der Sorte, die ihren Witz aus den slapstickhaften Situationen bezieht, in die Ebenezum und sein tollpatschiger Lehrling Wuntvor so unausweichlich wie häufig geraten. Die Trilogie – die auch als Sammelband unter dem Titel The Exploits of Ebenezum (1987) nachgedruckt wurde – erwies sich als erfolgreich genug, um mit The Ballad of Wuntvor eine zweite Trilogie nach sich zu ziehen, in deren Mittelpunkt allerdings der – wie bereits erwähnt überaus tollpatschige – Zauberlehrling Wuntvor steht. Ansonsten bieten A Difficulty with Dwarves (1987), An Excess of Enchantments (1988) und A Disagreement with Death (1989; alle drei auch als Sammelband The Wanderings of Wuntvor (1989)) mehr oder weniger das Gleiche wie die vorangegangenen Bände.
Da die Zahl der sich für Schenkelklopfer eignenden Situationen, in die man einen deutlich gehandicapten Magier und seinen ebenfalls eher untauglichen Lehrling in 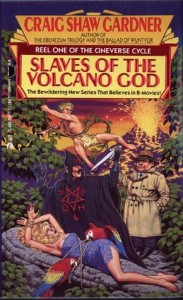 einer Standard-Fantasywelt bringen kann, letztlich begrenzt ist, musste Gardner sich für seine nächste lustige Trilogie etwas Neues einfallen lassen, und man kann ihm attestieren, dass ihm das mit The Cineverse Cycle auch recht erfolgreich gelungen ist. In der aus den Bänden Slaves of the Volcano God (1989), Bride of the Slime Monster und Revenge of the Fluffy Bunnies (beide 1990; alle drei auch als Sammelband The Cineverse Cycle (1990)) bestehenden Trilogie gerät der junge Erdenmensch Roger Gordon mit Hilfe seines Captain Crusader Decoder Rings in alternative Welten, die wie Manifestationen von B-Movie-Klischees wirken (in Wirklichkeit sind sie für besagte Klischees verantwortlich), und muss dort diverse Gefahren überstehen und sich mit üblen Schurken auseinandersetzen – was zumindest Lesern und Leserinnen mit einem ausgeprägten Faible für B-Movies durchaus Spaß machen kann.
einer Standard-Fantasywelt bringen kann, letztlich begrenzt ist, musste Gardner sich für seine nächste lustige Trilogie etwas Neues einfallen lassen, und man kann ihm attestieren, dass ihm das mit The Cineverse Cycle auch recht erfolgreich gelungen ist. In der aus den Bänden Slaves of the Volcano God (1989), Bride of the Slime Monster und Revenge of the Fluffy Bunnies (beide 1990; alle drei auch als Sammelband The Cineverse Cycle (1990)) bestehenden Trilogie gerät der junge Erdenmensch Roger Gordon mit Hilfe seines Captain Crusader Decoder Rings in alternative Welten, die wie Manifestationen von B-Movie-Klischees wirken (in Wirklichkeit sind sie für besagte Klischees verantwortlich), und muss dort diverse Gefahren überstehen und sich mit üblen Schurken auseinandersetzen – was zumindest Lesern und Leserinnen mit einem ausgeprägten Faible für B-Movies durchaus Spaß machen kann.
Bei der darauf folgenden, Arabian Nights betitelten Sequenz handelt es sich um schon anhand ihrer Titel The Other Sinbad, A Bad Day for Ali Baba (beide 1991) und Scheherazade’s Night Out (1992; auch als The Last Arabian Night (1993)) als solche erkennbare, locker-leicht lesbare Parodien auf die Geschichten aus 1001 Nacht.
Zu diesem Zeitpunkt dürfte Craig Shaw Gardner vermutlich nicht nur in seiner Heimat der neben Robert Asprin bekannteste amerikanische Funny-Fantasy-Autor gewesen sein. Die englischen Ausgaben seiner Romane wurden von Josh-Kirby-Titelbildern geschmückt, und drei seiner vier humoristischen Trilogien hatten es zu deutschen Übersetzungen gebracht: die Bände um Ebenezum und Wuntvor erschienen hierzulande als Die Ballade von Wuntvor (Einzeltitel: Ein Magier in Nöten, Ein Magier im Monsterland (beide 1989), Ein Magier auf Höllentrip (1990), Zwergenzwist im Monsterland, Hexenhatz im Monsterland (beide 1991) und Totentanz im Monsterland (1992)), und die Arabian Nights ohne Zyklustitel als Der andere Sindbad, Ein schwarzer Tag für Ali Baba (beide 1994) und Scheherazade macht Geschichten (1995).
Laut Gardners Aussage war es sein amerikanischer Stammverlag, der ihm vorgeschlagen hat, es doch einmal mit “ernsthafter” Fantasy zu versuchen (dazu passt, dass Gardner mit ihnen bei Ace Books zum Hardcover-Autor aufstieg), und das Ergebnis war The Dragon Circle – drei Romane (Dragon Sleeping (1994; auch als Raven Walking (1994)), Dragon Waking (1995) und Dragon Burning (1996)), in denen es ein ganzes Stadtviertel von der Erde in eine typische Fantasywelt verschlägt, wo sich die Menschen mit den neuen Gegebenheiten (und natürlich auch dem titelgebenden Drachen) auseinandersetzen müssen, und die Gardner selbst für seine besten Werke hält. Doch wie es scheint, sind seine Leser ihm nicht gefolgt, denn The Dragon Circle hat sich dem Vernehmen nach nicht besonders gut verkauft.
Vermutlich hat er sich sogar richtig schlecht verkauft, denn Craig Shaw Gardners nächste, auch wieder “ernsthafte” Trilogie The Changeling Saga (The Changeling War, The Sorcerer’s Gun (beide 1999) und The Magic Dead (2000)) erschien 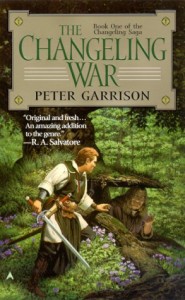 unter dem Pseudonym Peter Garrison. Nach Erscheinen des dritten Bandes war die Karriere von “Peter Garrison” dann bereits wieder beendet – und anscheinend auch die von Craig Shaw Gardner, denn seit der Jahrtausendwende sind nur noch zwei Romane zu TV-Serien (einmal zu Angel und einmal zu Battlestar Galactica) sowie ein Horrorroman (unter Verlagspseudonym) von ihm erschienen. Und das ist schon merkwürdig für einen Autor, der jahrelang drei bis vier Romane pro Jahr veröffentlicht hat (parallel zu den bisher genannten Titeln hat Gardner eigentlich immer im Laufe seiner Karriere Film-Novelisationen und Romane zu TV-Serien bzw. Comicuniversen geschrieben). Es scheint im Hinblick auf den kommerziellen Erfolg gerade im Genrebereich wirklich nicht ganz ungefährlich zu sein, das (Sub-)Genre zu wechseln.
unter dem Pseudonym Peter Garrison. Nach Erscheinen des dritten Bandes war die Karriere von “Peter Garrison” dann bereits wieder beendet – und anscheinend auch die von Craig Shaw Gardner, denn seit der Jahrtausendwende sind nur noch zwei Romane zu TV-Serien (einmal zu Angel und einmal zu Battlestar Galactica) sowie ein Horrorroman (unter Verlagspseudonym) von ihm erschienen. Und das ist schon merkwürdig für einen Autor, der jahrelang drei bis vier Romane pro Jahr veröffentlicht hat (parallel zu den bisher genannten Titeln hat Gardner eigentlich immer im Laufe seiner Karriere Film-Novelisationen und Romane zu TV-Serien bzw. Comicuniversen geschrieben). Es scheint im Hinblick auf den kommerziellen Erfolg gerade im Genrebereich wirklich nicht ganz ungefährlich zu sein, das (Sub-)Genre zu wechseln.
Außerdem wollen wir die Gelegenheit nutzen, anlässlich seines 100. Geburtstags an Hannes Bok zu erinnern. Hannes Bok, der am 02. Juli 1914 als Wayne Francis Woodard in Kansas City, Missouri, geboren wurde, hat sich dieses Pseudonym Anfang der 30er Jahre zugelegt, als er anfing, Illustrationen an SF-Fanzines zu schicken und die ersten Schritte in dem Metier machte, mit dem sein Name in erster Linie verbunden wird. Denn er war vor allem Grafiker, der rund 150 Titelbilder (und mehrere 100 Innenillustrationen) für die verschiedensten amerikanischen Phantastik-Magazine geschaffen hat und dessen Bilder auch die Umschläge von etlichen Büchern aus in den 30er und 40er Jahren aktiven Kleinverlagen wie Shasta oder Arkham House zieren.
Doch Hannes Bok hat auch phantastische Erzählungen und Kurzromane geschrieben, die in Magazinen wie Science Fiction Quarterly, Weird Tales, Future Fantasy and Science Fiction, Planet Stories, Startling Stories oder Fantastic Universe erschienen sind. Thematisch und erzählerisch war er stark von den Werken seines Freundes Abraham Merritt beeinflusst, und so ist es kein Wunder, dass er zwei von Merritt bei dessen Tod hinterlassene Fragmente ergänzt hat. Diese beiden posthumen Kollaborationen – The Fox Woman and The Blue Pagoda (1946) sowie The Black Wheel (1947) – waren die einzigen erzählerischen Werke, die noch zu Boks Lebzeiten in Buchform veröffentlicht wurden, denn seine beiden Romane The Sorcerer’s Ship (1969) und Beyond the Golden Stair (1970) erschienen erst einige Jahre nach seinem Tod in der von Lin Carter herausgegebenen Reihe Ballantine Adult Fantasy als Taschenbuch.
The Sorcerer’s Ship (1969; erstmals unter dem gleichen Titel in der Dezemberausgabe 1942 von Unknown erschienen) erweist sich einerseits als deutlich von A. Merrits The Ship of Ishtar inspiriert, ist aber weit davon entfernt, ein schlichtes Plagiat zu sein. Das fängt mit der Hauptfigur an, denn der Postangestellte Gene, der am Anfang des Buches als Schiffbrüchiger auf einer Planke im Ozean treibt, bis er von einer Galeere in einer offensichtlich anderen Welt aufgefischt wird, ist kein im Umgang mit antiken Waffen vertrauter Tatmensch wie Merritts Kenton, und auch die Situation auf dem Schiff (auf dem es ebenfalls zwei unterschiedliche Fraktionen gibt, die den Mann aus einer anderen Welt zu benutzen versuchen) ist ein bisschen anders – genauso wie der weitere Verlauf der Reise. Bok mag die fiebrige Intensität fehlen, mit der Merritt die Abenteuer seiner Figuren schildert, aber ihm gelingt ein farbiges Beispiel von zu Unrecht vollkommen vergessener Abenteuerfantasy der Prä-Tolkien-Ära.
Dies gilt auch für Beyond the Golden Stair (1970; ursprünglich in einer kürzeren Version als “The Blue Flamingo” 1948 in der Januarausgabe von Startling Stories erschienen). In diesem Roman gerät der etwas naive Hibbert zu Unrecht ins Gefängnis, wo er den Schlägertypen Scarlatti kennenlernt – und schon wenig später, nach einem geglückten Gefängnisausbruch, eher widerwillig mit Scarlatti, dessen Freundin Carlotta und einem Mann namens Burks unterwegs in die Everglades ist. Dort stoßen die vier auf eine goldene Treppe, die ins Nichts zu führen scheint, in Wirklichkeit aber zu einem Teich, der möglicherweise die Quelle der ewigen Jugend ist und von einem blauen Flamingo bewacht wird … allerdings nicht mehr lange. Der Weg der vier 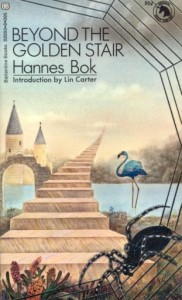 ungleichen Gefährten ist damit jedoch noch lange nicht zu Ende, und das, was am Ende der nächsten Treppe auf sie wartet, macht den Roman zu einem in mehrfacher Hinsicht ungewöhnlichen Werk.
ungleichen Gefährten ist damit jedoch noch lange nicht zu Ende, und das, was am Ende der nächsten Treppe auf sie wartet, macht den Roman zu einem in mehrfacher Hinsicht ungewöhnlichen Werk.
Wenn man bedenkt, dass Hannes Bok diese Romane noch relativ jung – nämlich mit Ende 20 bzw. Anfang 30 – geschrieben hat, kann man es eigentlich nur bedauern, dass er anscheinend keine schriftstellerische Karriere angestrebt hat, sondern hautpsächlich als Grafiker arbeiten wollte. Nicht zuletzt, weil er sich Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre mit etlichen Auftraggebern überworfen hat und es auch kaum noch Bilder von ihm gegeben hat. Im Verlauf der 50er Jahre ist er dann mehr und mehr in Richtung Okkultismus und Astrologie abgedriftet, und am 11. April 1964 ist er mit 49 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben. Zumindest offiziell. In der amerikanischen SF-Szene hält sich allerdings hartnäckig das Gerücht, dass Hannes Bok – der in seinen letzten Jahren praktisch keine Titelbild- oder Illustrationsaufträge mehr bekommen hat und völlig verarmt ist – im wahrsten Sinne des Wortes verhungert ist.
Wer jetzt übrigens meint, dass in diesem Text der Grafiker Hannes Bok ein bisschen zu kurz gekommen ist, hat völlig recht. Immerhin können wir (mal abgesehen von den Weiten des Internets, die in dieser Hinsicht ebenfalls Einiges zu bieten haben) an dieser Stelle zumindest auf ein paar Bildbände verweisen, die eine recht große Bandbreite des ziemlich unverwechselbaren grafischen Ouevres von Hannes Bok präsentieren, wie Beauty and the Beasts: The Art of Hannes Bok (1978), A Hannes Bok Treasury (1993), A Hannes Bok Showcase (1995), Hannes Bok – Drawings and Sketches (1996) und das leider sehr teure Hannes Bok: A Life in Illustration (2012).
Bibliotheka Phantastika gratuliert Paul Hazel, der heute 70 Jahre alt wird. Der am 01. Juli 1944 in Bridgeport, Connecticut, geborene Paul E. Hazel ist einer der (gar nicht so wenigen) Autoren, die in der Fantasy nur ein kurzes Gastspiel gegeben haben. Im Gegensatz zu manchen anderen Autoren, die sich vorher oder nachher anderen Genres zugewandt haben, ist Hazel dabei in seinem gerade einmal vier Romane und zwei Kurzgeschichten umfassenden schriftstellerischen Schaffen der Fantasy praktisch immer treu geblieben – und hat sie letztlich auch bereichert.
Drei von Paul Hazels Romanen bilden die Trilogie The Finnbranch, in deren Auftaktband Yearwood (1980) sich ein anfangs namenloser, später Finn genannter Ich-Erzähler auf eine Reise durch eine einerseits vertraute – da sich in ihr etliche Elemente aus der keltischen Mythylogie finden lassen –, andererseits ungewöhnlich düster und bedrohlich wirkende Welt begibt, deren Wunder häufig auch Gefahren sind. Finn, ein Bastard und der Sohn einer Hexe, ist auf der Suche nach seinem Vater und seiner Bestimmung, und Hazel schildert seine Queste bzw. deren Episoden in Sätzen, die wie gemeißelt wirken, auf eine ungemein kraftvolle und eindringliche Weise, erschafft Bilder von archaischer Wucht. Was den ganzen Roman eher zu einer Abfolge locker miteinander verbundener Geschehnisse (mit kaum zu entschlüsselndem Symbolgehalt) macht, als zu einer stringent durchgezogenen Erzählung. Hinzu kommt, dass Finn nicht unbedingt eine sympathische Figur ist, auch wenn man ihm zugestehen muss, dass er sich von Anfang an auf einem seit den Tragödien der alten Griechen vorgezeichneten Weg befindet, der nur ein ganz bestimmtes Ende nehmen kann.
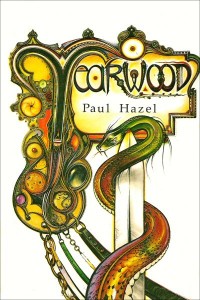 Während der Plot als solcher in Yearwood zwar hinter Hazels Sprachgewalt zurücktritt, aber immer noch erkennbar ist (und sich in seiner grundlegenden Struktur nicht von dem vieler anderer Fantasyquesten unterscheidet), zerfällt in Undersea (1982) die Handlung endgültig in (noch symbolbeladenere) Episoden, deren Zuordnung zum großen Ganzen noch schwerer fällt. Sprachlich gibt es auch an diesem Roman, in dem Finn – der schon im ersten Band als “heir to kingdoms both on land and under sea” eingeführt wurde – etliche Metamorphosen durchleben muss, um sein Erbe antreten zu können, nichts auszusetzen. Im Gegenteil – auch hier gelingt es Paul Hazel wieder, mittels einer eigentlich einfachen Sprache eine unglaublich dichte, intensive Atmosphäre zu erschaffen, doch ein zusammenhängender Plot ist kaum noch erkennbar (wobei umfassende Kenntnisse vor allem der keltischen Mythologie vermutlich dabei helfen würden, den Symbolgehalt der – für sich betrachtet großartig geschilderten – Episoden zu entschlüsseln). Verglichen mit seinem Vorgänger, ist Winterking (1985) dann wieder wesentlich konventioneller erzählt – allerdings spielt der Roman in einem vollkommen anderen Setting, einer Art Parallelwelt-Neuengland, in dem auch Finn seinen Platz hat, wenn auch unter einem anderen Namen. Sprachlich nicht mehr ganz so wuchtig, inhaltlich aber auch nicht leichter zu entschlüsseln als die beiden vorangegangenen Bände, ist Winterking der ungewöhnliche Schlussstein einer ungewöhnlichen Trilogie, die sich einem Lesen als typische Fantasytrilogie konsequent entzieht. Wenn man Spaß an The Finnbranch haben will – wobei Spaß angesichts der das Werk durchziehenden Düsternis vielleicht nicht ganz das richtige Wort ist – muss man sich auf die sprachlichen und stilistischen Qualitäten der drei Romane einlassen, denn dann können sie in eine Welt führen, die man zwar häufig nicht begreift, die in ihrer archaischen Schönheit und Grausamkeit aber so ziemlich ohnegleichen ist.
Während der Plot als solcher in Yearwood zwar hinter Hazels Sprachgewalt zurücktritt, aber immer noch erkennbar ist (und sich in seiner grundlegenden Struktur nicht von dem vieler anderer Fantasyquesten unterscheidet), zerfällt in Undersea (1982) die Handlung endgültig in (noch symbolbeladenere) Episoden, deren Zuordnung zum großen Ganzen noch schwerer fällt. Sprachlich gibt es auch an diesem Roman, in dem Finn – der schon im ersten Band als “heir to kingdoms both on land and under sea” eingeführt wurde – etliche Metamorphosen durchleben muss, um sein Erbe antreten zu können, nichts auszusetzen. Im Gegenteil – auch hier gelingt es Paul Hazel wieder, mittels einer eigentlich einfachen Sprache eine unglaublich dichte, intensive Atmosphäre zu erschaffen, doch ein zusammenhängender Plot ist kaum noch erkennbar (wobei umfassende Kenntnisse vor allem der keltischen Mythologie vermutlich dabei helfen würden, den Symbolgehalt der – für sich betrachtet großartig geschilderten – Episoden zu entschlüsseln). Verglichen mit seinem Vorgänger, ist Winterking (1985) dann wieder wesentlich konventioneller erzählt – allerdings spielt der Roman in einem vollkommen anderen Setting, einer Art Parallelwelt-Neuengland, in dem auch Finn seinen Platz hat, wenn auch unter einem anderen Namen. Sprachlich nicht mehr ganz so wuchtig, inhaltlich aber auch nicht leichter zu entschlüsseln als die beiden vorangegangenen Bände, ist Winterking der ungewöhnliche Schlussstein einer ungewöhnlichen Trilogie, die sich einem Lesen als typische Fantasytrilogie konsequent entzieht. Wenn man Spaß an The Finnbranch haben will – wobei Spaß angesichts der das Werk durchziehenden Düsternis vielleicht nicht ganz das richtige Wort ist – muss man sich auf die sprachlichen und stilistischen Qualitäten der drei Romane einlassen, denn dann können sie in eine Welt führen, die man zwar häufig nicht begreift, die in ihrer archaischen Schönheit und Grausamkeit aber so ziemlich ohnegleichen ist.
Acht Jahre nach dem Ende von The Finnbranch hat Paul Hazel mit The Wealdwife’s Tale (1993) einen weiteren – und zugleich seinen letzten – Roman vorgelegt. Angelehnt an das alte englische Weihnachtslied Good King Wenceslas erzählt er die Geschichte des Grafen Waldo Wenceslas, der sich nach dem Tod seiner Frau in die umliegenden Wälder begibt und damit Geschenisse in Gang setzt, die sich auf seine ganze Familie auswirken.
Paul Hazels Trilogie um den Bastard und Hexensohn Finn ist zweifellos ein Solitär in der (ja insgesamt recht weiträumigen) Fantasylandschaft. Aus heutiger Sicht sind vor allem zwei Dinge an ihr überraschend und beeindruckend: Zum Einen die Konsequenz, mit der Hazel sich weigert, die zweifellos vorhandenen Erwartungen der (auch schon Anfang der 80er Jahre an gewisse Genrekonventionen gewöhnten) Fantasyleserschaft zu befriedigen bzw. sich ihnen zu beugen, und zum anderen die Sprachgewalt, mit der er seine Geschichte von Tod und Wiedergeburt und erneutem Tod und erneuter Wiedergeburt erzählt. Überraschend ist natürlich auch, dass die Trilogie es als Die drei Zweige des Finn (Einzeltitel Jahreswald (1984), Meeresgrund (1985) und Winterkönig (1986)) auch nach Deutschland geschafft hat, denn heutzutage wäre das vollkommen undenkbar.
Von Hazel selbst gibt es übrigens eine Aussage, die seine Herangehensweise (in Bezug auf The Finnbranch) vielleicht am besten illustriert: “All my stuff is stolen … because there’s only one place to take it from … and out of that place comes the story of the birth, the search and the death, and the hope of resurrection, of doing it over and over again – that endless wheel on which we keep turning. And I have tried to listen hard enough to hear not simply echoes … but some of the original sounds that come out of that place.”*
* in Fantasy Newsletter 62, Sept. ’83
Bibliotheka Phantastika erinnert an David Mason, dessen Todestag sich heute zum 40. mal jährt. David Mason – der 1924 als Samuel Mason geboren wurde – zählt zu den Autoren, über die sich kaum etwas in Erfahrung bringen lässt. Fakt ist, dass er von 1956 bis 1962 mit der SF-Autorin Katherine MacLean verheiratet war und zwischen 1955 und 1958 insgesamt acht Stories veröffentlicht hat, die zumeist im Magazin Infinity erschienen sind. Und als Infinity eingestellt wurde, gab es erstmal auch keine Kurzgeschichten mehr von ihm.
Aber hier soll es nicht primär um Masons Stories gehen (von denen noch drei weitere 1963 bzw. 1970 in verschiedenen Magazinen erschienen), sondern um seine Romane, die Ende der 60er, Anfang der 70er veröffentlicht wurden. Den 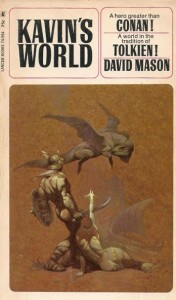 Auftakt machte Kavin’s World (1969), die von ihm selbst erzählte Geschichte Kavins, des Prinzen von Dorada, der sein von Barbaren und Monstern bedrohtes Volk nach dem Tod seines Vaters mit Unterstützung des Zauberers Thuramon auf eine andere Welt führen muss. Dort bekommen die Doradaner es allerdings mit den Evil Three zu tun – und der mächtigste von ihnen ist ganz etwas anderes und viel, viel mehr als ein typischer “dunkler Lord” … Kavin’s World ist insofern ein ungewöhnlicher Roman, als Mason in ihm den – zum damaligen Zeitpunkt noch recht ungewöhnlichen – Versuch unternimmt, Elemente der Sword & Sorcery eines Robert E. Howard mit denen der High Fantasy eines J.R.R. Tolkien zu verknüpfen, und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Was einerseits an Kavin, dem Ich-Erzähler der Geschichte liegt, der freimütig von seinen Abenteuern berichtet (auch denen, in denen er eine weniger glückliche oder moralisch fragwürdige Rolle spielt), andererseits am “Viele-Welten-Konzept”, das ein wenig an das in Michael Moorcocks Multiversum erinnert. Und last but not least hat natürlich auch der erstaunlich originelle Oberbösewicht seinen Anteil daran. Die Mischung funktioniert jedenfalls, und das ist eindeutig David Masons Verdienst.
Auftakt machte Kavin’s World (1969), die von ihm selbst erzählte Geschichte Kavins, des Prinzen von Dorada, der sein von Barbaren und Monstern bedrohtes Volk nach dem Tod seines Vaters mit Unterstützung des Zauberers Thuramon auf eine andere Welt führen muss. Dort bekommen die Doradaner es allerdings mit den Evil Three zu tun – und der mächtigste von ihnen ist ganz etwas anderes und viel, viel mehr als ein typischer “dunkler Lord” … Kavin’s World ist insofern ein ungewöhnlicher Roman, als Mason in ihm den – zum damaligen Zeitpunkt noch recht ungewöhnlichen – Versuch unternimmt, Elemente der Sword & Sorcery eines Robert E. Howard mit denen der High Fantasy eines J.R.R. Tolkien zu verknüpfen, und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Was einerseits an Kavin, dem Ich-Erzähler der Geschichte liegt, der freimütig von seinen Abenteuern berichtet (auch denen, in denen er eine weniger glückliche oder moralisch fragwürdige Rolle spielt), andererseits am “Viele-Welten-Konzept”, das ein wenig an das in Michael Moorcocks Multiversum erinnert. Und last but not least hat natürlich auch der erstaunlich originelle Oberbösewicht seinen Anteil daran. Die Mischung funktioniert jedenfalls, und das ist eindeutig David Masons Verdienst.
In The Return of Kavin (1972), der zwar keineswegs unbedingt erforderlichen, aber in sich schlüssig möglichen Fortsetzung, steht zwar immer noch Kavin (wenn auch nicht mehr als Ich-Erzähler) im Mittelpunkt, aber er hat – von einer Ausnahme abgesehen – jetzt andere, neue Gefährten, die ihm manchmal fast schon die Show stehlen. Das gilt vor allem für Zamor und Hugon, die gelegentlich ein bisschen an zwei andere, immer im Team auftretende S&S-Helden erinnern. Die beiden Kavin-Romane sind gewiss keine große Literatur, und sie sind auch keine Meilensteine der Fantasy, doch mit ihnen hat David Mason angenehm lesbare Abenteuerfantasy geschrieben, die – vor allem, wenn man den Zeitpunkt ihrer Entstehung in Betracht zieht – mit durchaus originellen, teilweise sogar mutigen Ideen ebenso punkten kann wie mit trotz ihrer Fehler sympathischen Hauptfiguren und einem jeweils sehr befriedigenden Ende.
David Mason hat noch drei andere phantastische Romane geschrieben: The Sorcerer’s Skull (1970) ist ebenfalls Fantasy und dreht sich um den titelgebenden Zaubererschädel bzw. das, was mit ihm geschieht, während The Shores of Tomorrow (1971) ein SF-Roman mit Alternativ-Welten ist, und es in The Deep Gods (1973) einen Mann aus dem 20. Jahrhundert in eine prähistorische Epoche verschlägt, wo er es mit einem der “Götter der Tiefe” zu tun bekommt.
Im Gegensatz zu den letztgenannten drei Titeln sind die Kavin-Romane auch auf Deutsch erschienen, und zwar als Kavins Welt und Kavins Rückkehr (beide 1986). Die nur im Buch auch als “Saga von Kavin Hostan, dem Prinzen von Dorada” bezeichneten Romane dürften aufgrund der inhaltlichen und formalen Entwicklung des Genres auf ihre deutschsprachige Leserschaft in den 80er Jahren allerdings längst nicht mehr so frisch und originell gewirkt haben wie bei ihrem ursprünglichen Erscheinen. David Mason selbst hat die o.g. inhaltliche und formale Entwicklung des Genres – zu der er möglicherweise sogar etwas beizutragen gehabt hätte – nicht mehr miterlebt, denn am 28. Juni 1974 ist er im Alter von 49 oder 50 Jahren gestorben.
Bibliotheka Phantastika gratuliert Lev Grossman, der heute seinen 45. Geburtstag feiern kann. Nach dem College-Abschluss und einem nicht beendeten Studium der vergleichenden Literaturwissenschaft begann der am 26. Juni 1969 in Lexington, Massachusetts, geborene Lev Grossman als Journalist zu arbeiten und wurde 2002 Buchkritiker des Time magazine, verfasste aber auch Artikel und Essays für andere Zeitungen und Zeitschriften wie The New York Times, Salon, Entertainment Weekly oder Village Voice. Parallel dazu begann er Romane zu schreiben. Während sein Erstling Warp (1997) nicht sonderlich viel Aufmerksamkeit erregte, gelang ihm mit dem Thriller Codex (2004) ein internationaler Bestseller, der als Die Macht des Codex (2006) auch auf Deutsch erschienen ist.
Noch weitaus erfolgreicher war dann sein dritter – und erster wirklich phantastischer – Roman The Magicians (2009). In dessen Mittelpunkt steht der hochintelligente Quentin Coldwater, der gerade die High School hinter sich gebracht hat, und dem das alltägliche Leben grau und trist erscheint; nicht 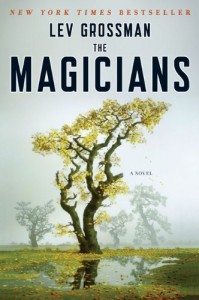 zuletzt deshalb beschäftigt er sich noch heute insgeheim mit den Fantasyromanen, die er als Kind so gerne gelesen hat. In ihnen geht es um fünf Kinder, die es in ein magisches Land namens Fillory verschlägt, und die dort wunderbare Abenteuer erleben. Und dann landet er plötzlich und unerwartet eines Tages an einem sehr geheimen, sehr exklusiven College, an dem moderne Magie gelehrt wird. Aber das ist noch nicht alles, denn auch im Hinblick auf Fillory steht ihm noch eine Überraschung bevor …
zuletzt deshalb beschäftigt er sich noch heute insgeheim mit den Fantasyromanen, die er als Kind so gerne gelesen hat. In ihnen geht es um fünf Kinder, die es in ein magisches Land namens Fillory verschlägt, und die dort wunderbare Abenteuer erleben. Und dann landet er plötzlich und unerwartet eines Tages an einem sehr geheimen, sehr exklusiven College, an dem moderne Magie gelehrt wird. Aber das ist noch nicht alles, denn auch im Hinblick auf Fillory steht ihm noch eine Überraschung bevor …
Wenn ein Literaturkritiker einen Roman schreibt, kann man (oder muss man fast) erwarten, dass er ein bisschen anders an die Sache herangeht als allgemein üblich, vor allem, wenn er sich im Bereich der Genreliteratur bewegt. Und tatsächlich hat The Magicians nur auf den allerersten Blick viel mit anderen Romanen gemein, in denen es um magische Universitäten geht. Hier gibt es keinen dunklen Bösewicht, mit dem sich Quentin Coldwater und seine Mitstudierenden auseinandersetzen müssen (was nicht heißt, dass es keine Gefahren gibt); stattdessen dreht sich ein Großteil der Handlung um Sex, Alkohol und andere Drogen, sprich um (typische?) Themen und Probleme der Adoleszenz – zumindest bis es nach Fillory geht. Oder, anders ausgedrückt: statt einen Harry-Potter-Klon vorzulegen, hat Grossman in The Magicians sowohl die Zauberschüler-Romane als auch Sachen wie The Chronicles of Narnia und vergleichbar angelegte Jugendbuch-Zyklen dekonstruiert.
Das hat ihm einerseits jede Menge positiver Kritiken und den John W. Campbell Award als bester Nachwuchsautor eingebracht, während die angloamerikanische Blogosphere etwas verhaltener reagiert hat und auch die englischsprachige Leserschaft nicht nur begeistert war. Auch in Deutschland (wo der Roman als Fillory – Die Zauberer (2010) erschienen ist), war das Echo gespalten. Doch Dekonstruktion bekannter und beliebter Topoi und der persönliche Umgang damit hin oder her – inzwischen hat Lev Grossman dem ursprünglich als Einzelband geplanten Roman mit The Magician King (2011) eine Fortsetzung folgen lassen, die es unter dem Titel Fillory – Der König der Zauberer (2013) ebenfalls nach Deutschland geschafft hat. Und zumindest die (vermeintlichen?) rein formalen Zwänge des Genres scheinen der Lust an der Dekonstruktion tapfer Widerstand zu leisten, denn mit dem für den kommenden August angekündigten Band The Magician’s Land wird aus dem Ganzen das, was es in der Fantasy vermutlich am häufigsten von allen Genres gibt: eine Trilogie.
Bibliotheka Phantastika gratuliert Lillian Stewart Carl, die heute 65 Jahre alt wird. Zwar ist die am 22. Juni 1949 in Columbia, Missouri, geborene Lillian Stewart Carl heutzutage in ihrer Heimat vor allem als Autorin von Krimis mit mehr oder weniger phantastischem Einschlag bekannt, doch angefangen hat ihre schriftstellerische Karriere mit Fantasy – oder, genauer gesagt, mit Sword & Sorcery. Denn “The Borders of Sabazel”, ihre erste, in der von Jessica Amanda Salmonson herausgegebenen Anthologie Amazons II (1982) veröffentlichte Story, ist eine waschechte Sword-&-Sorcery-Story, in der Danica, die Kriegerin und Königin des Amazonenreiches Sabazel, ihren ersten Auftritt hat und zum ersten Mal dem Eroberer und zukünftigen Gottkönig Marcos Bellasteros begegnet.
Danica und Bellasteros sind auch die Hauptfiguren von Sabazel (1985), dem ersten Band der Sabazel Series, in dem ihre Geschichte weitergesponnen wird (und das im wahrsten Sinne des Wortes, denn die ursprüngliche Kurzgeschichte bildet leicht abgewandelt die ersten beiden Kapitel des Romans). Die Amazonenkönigin und der Eroberer – für den unzweifelhaft Alexander der Große Pate stand – müssen ihre gegenseitigen Vorbehalte überwinden, um ein politisches Bündnis zu schmieden, doch je näher die beiden sich kommen, desto größer werden die Widerstände im Lager von Bellasteros, dessen Reich alsbald von innen und außen bedroht wird, und der mehr als je zuvor der Unterstützung der Amazonen und ihrer Göttin bedarf.
 Sabazel bietet einerseits typische und weniger typische S&S-Elemente – Zweikämpfe und blutige Schlachten, Magie, übermenschliche Heldenfiguren beiderlei Geschlechts und ein Amazonenreich, das zumindest funktionieren könnte –, die mit einer glaubhaft umgesetzten Liebesgeschichte verwoben sind; andererseits gibt der Roman den Rahmen vor, in dem sich auch die weiteren Bände des Zyklus bewegen: eine alternative antike Mittelmeerwelt, in der die Mythen unserer Welt ebenso real sind wie Magie, und in der sich die Götter wie in den griechischen Sagen und Legenden gern mal ins Geschehen einmischen. Und ebenso, wie man in Bellasteros rasch einen alternativen Alexander erkennen kann, lassen sich auch die realen Vorbilder zumindest der nächsten beiden Bände – in denen Andrion, der Sohn von Danica und Bellasteros die Hauptrolle spielt – leicht ausmachen, egal, ob er es in The Winter King (1986) mit der Crimson Horde, dem Reitervolk der Khazyari aus den westlichen Steppen, zu tun bekommt, oder sich in Shadow Dancers (1987) nach der Entführung seiner Frau in das Inselkönigreich Minras begeben und sich nicht nur mit dessen von Dämonen besessener Königin auseinandersetzen muss, sondern auch mit dem Gott im Labyrinth. In Wings of Power (1989) schließlich verschlägt es Gard, einen Enkel der ursprünglichen Hauptfiguren, dem sein Erbe (nicht das weltliche) ebenso viele Probleme macht wie sein jugendlicher Leichtsinn, weit nach Osten, ins exotische Königreich India, wo er dessen Sklavenmärkte und dunkle Verliese kennenlernt und sich bösartiger Magier erwehren muss – und so ganz nebenbei einen Krieg auslöst.
Sabazel bietet einerseits typische und weniger typische S&S-Elemente – Zweikämpfe und blutige Schlachten, Magie, übermenschliche Heldenfiguren beiderlei Geschlechts und ein Amazonenreich, das zumindest funktionieren könnte –, die mit einer glaubhaft umgesetzten Liebesgeschichte verwoben sind; andererseits gibt der Roman den Rahmen vor, in dem sich auch die weiteren Bände des Zyklus bewegen: eine alternative antike Mittelmeerwelt, in der die Mythen unserer Welt ebenso real sind wie Magie, und in der sich die Götter wie in den griechischen Sagen und Legenden gern mal ins Geschehen einmischen. Und ebenso, wie man in Bellasteros rasch einen alternativen Alexander erkennen kann, lassen sich auch die realen Vorbilder zumindest der nächsten beiden Bände – in denen Andrion, der Sohn von Danica und Bellasteros die Hauptrolle spielt – leicht ausmachen, egal, ob er es in The Winter King (1986) mit der Crimson Horde, dem Reitervolk der Khazyari aus den westlichen Steppen, zu tun bekommt, oder sich in Shadow Dancers (1987) nach der Entführung seiner Frau in das Inselkönigreich Minras begeben und sich nicht nur mit dessen von Dämonen besessener Königin auseinandersetzen muss, sondern auch mit dem Gott im Labyrinth. In Wings of Power (1989) schließlich verschlägt es Gard, einen Enkel der ursprünglichen Hauptfiguren, dem sein Erbe (nicht das weltliche) ebenso viele Probleme macht wie sein jugendlicher Leichtsinn, weit nach Osten, ins exotische Königreich India, wo er dessen Sklavenmärkte und dunkle Verliese kennenlernt und sich bösartiger Magier erwehren muss – und so ganz nebenbei einen Krieg auslöst.
Insgesamt ist die Sabazel Series ein gelungenes Beispiel für mit leichter Hand erzählte, aber keineswegs unspannende oder unblutige Sword & Sorcery in einem an der griechischen Antike orientierten, farbig und plastisch gestalteten Setting, in der es ungeachtet aller Kämpfe und Kriege und magischen Attacken auch immer wieder um die Annäherung einander zunächst fremder Kulturen geht. Auf Deutsch ist von Lillian Stewart Carl weder ihr Fantasy-Zyklus noch einer ihrer übersinnlichen Krimis erschienen. Einzig und allein “The Borders of Sabazel” hat es als “Die Grenzen von Sabazel” im Rahmen der Anthologie Neue Amazonen-Geschichten (1983) nach Deutschland geschafft. Somit können rein deutschsprachige Leserinnen und Leser Danica und Bellasteros zwar kennenlernen, doch das Potential, das in den Figuren und dem Setting steckt, lässt sich anhand der zwar ganz netten, aber letztlich nicht mehr als durchschnittlichen Kurzgeschichte allenfalls erahnen.
Bibliotheka Phantastika erinnert an Brian Jacques, der heute 75 Jahre alt geworden wäre. Auch wenn sich die schriftstellerische Begabung des am 15. Juni 1939 in Liverpool, England, geborenen James Brian Jacques bereits im zarten Alter von zehn Jahren zum ersten Mal zeigte, deutete lange Zeit nichts darauf hin, dass er einmal ein überaus erfolgreicher Autor von Jugend- bzw. Kinderbüchern werden würde. Denn nachdem Jacques mit fünfzehn die Schule verlassen hatte, fuhr er erst einmal zur See und arbeitete später – als er lieber wieder dauerhaft festen Boden unter den Füßen haben wollte – unter anderem als Dockarbeiter, Animateur, Radiosprecher, Polizist, Boxer, Fernfahrer und Milchmann. Damit Jacques seine Autorenkarriere beginnen konnte, waren einige Voraussetzungen – die man teilweise auch als glückliche Zufälle bezeichnen könnte – nötig: dass er als Milchmann eine Schule für blinde Kinder belieferte, sich mit ihnen anfreundete und ihnen Geschichten vorzulesen begann, dass er mit den vorhandenen Geschichten (die seiner Meinung nach zu viel “Angst” enthielten) unzufrieden war und selbst zu schreiben begann, dass er das Manuskript seinem ehemaligen Englischlehrer zeigte und dieser es ohne sein Wissen an Verlage schickte – und dass ein Verleger das Potential erkannte, das in der Geschichte steckte.
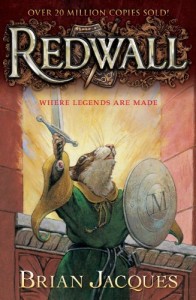 Auf alle Fälle kam im November 1986 mit Redwall der Auftakt der gleichnamigen Saga in Großbritannien auf den Markt. In ihm müssen sich die friedliebenden Bewohner der inmitten der Mossflower Woods gelegenen Redwall Abbey – bei denen es sich vor allem um Mäuse, Maulwürfe und Wühlmäuse handelt – des Angriffs einer bösartigen Ratte mit dem Namen Cluny the Scourge und ihrer Horden erwehren (was ihnen natürlich auch gelingt). In den Folgebänden Mossflower (1988), Mattimeo (1989), Mariel of Redwall (1991), Salamandastron (1992), Martin the Warrior (1993), The Bellmaker (1994), Outcast of Redwall (1995), The Pearls of Lutra (1996), The Long Patrol (1997), Marlfox (1998), The Legend of Luke (1999), Lord Brocktree (2000), Taggerung (2001), Triss (2002), Loamhedge (2003), Rakkety Tam (2004), High Rhulain (2005), Eulalia! (2007), Doomwyte (2008), The Sable Quean (2010) und The Rogue Crew (2011) wird dann nicht nur die Geschichte der Helden des ersten Bandes fortgeschrieben – die sich bald einer neuen Bedrohung ausgesetzt sehen –, sondern sie erzählen teilweise auch Geschehnisse aus der Vergangenheit Redwalls und setzen Figuren in Szene, die anfangs nur mythische Gestalten zu sein scheinen.
Auf alle Fälle kam im November 1986 mit Redwall der Auftakt der gleichnamigen Saga in Großbritannien auf den Markt. In ihm müssen sich die friedliebenden Bewohner der inmitten der Mossflower Woods gelegenen Redwall Abbey – bei denen es sich vor allem um Mäuse, Maulwürfe und Wühlmäuse handelt – des Angriffs einer bösartigen Ratte mit dem Namen Cluny the Scourge und ihrer Horden erwehren (was ihnen natürlich auch gelingt). In den Folgebänden Mossflower (1988), Mattimeo (1989), Mariel of Redwall (1991), Salamandastron (1992), Martin the Warrior (1993), The Bellmaker (1994), Outcast of Redwall (1995), The Pearls of Lutra (1996), The Long Patrol (1997), Marlfox (1998), The Legend of Luke (1999), Lord Brocktree (2000), Taggerung (2001), Triss (2002), Loamhedge (2003), Rakkety Tam (2004), High Rhulain (2005), Eulalia! (2007), Doomwyte (2008), The Sable Quean (2010) und The Rogue Crew (2011) wird dann nicht nur die Geschichte der Helden des ersten Bandes fortgeschrieben – die sich bald einer neuen Bedrohung ausgesetzt sehen –, sondern sie erzählen teilweise auch Geschehnisse aus der Vergangenheit Redwalls und setzen Figuren in Szene, die anfangs nur mythische Gestalten zu sein scheinen.
Ihre tierischen Helden und Heldinnen (hauptsächlich Mäuse, Dachse, Maulwürfe, Hasen, Wühlmäuse und Eichhörnchen) bzw. Schurken und Schurkinnen (vor allem Ratten, Wiesel, Frettchen, Hermeline und Schlangen) und deren kriegerischen Auseinandersetzungen und Abenteuer machen die Redwall Saga zu einem Bestandteil der Animal Fantasy, auch wenn die Tiere so stark anthropomorphisiert sind, dass sich eine große Nähe zur Tierfabel nicht verleugnen lässt. Dessen ungeachtet bieten die Romane (die ersten neun sind als Redwall – Der Sturm auf die Abtei, Mossflower – In den Fängen der Wildkatze, Mattimeo – Die Rache des Fuchses (alle 1998), Mariel – Das Geheimnis der Glocke (1999), Salamandastron – Die Jagd nach dem Schatz (2000), Martin der Krieger – Der Ruf nach Freiheit (2001), Redwall – In den Fängen des Tyrannen, Redwall – Der Kampf der Gefährten (beide 2003) und Redwall – Die Geiseln des Kaisers (2004) auch auf Deutsch erschienen) gerade Kindern einen guten Einstieg in die weite Welt der Fantasy.
Auf Deutsch wurde die Saga nach dem neunten Band abgebrochen, doch auch im Original wird es keine weitere Fortsetzung der insgesamt mehr als zwanzig Millionen mal verkauften Redwall Saga mehr geben, denn ihr Schöpfer Brian Jacques ist am 05. Februar 2011 an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben.
Bibliotheka Phantastika gratuliert Harry Turtledove, der heute 65 Jahre alt wird. Heutzutage gilt der am 14. Juni 1949 in Los Angeles, Kalifornien, geborene Harry Norman Turtledove zumindest im angloamerikanischen Sprachraum als unumstrittener Großmeister der Alternate History oder Alternativwelt-Literatur, der er sich in mehreren Zyklen auf sehr unterschiedliche Weise gewidmet hat bzw. immer noch widmet, doch am Anfang seiner Autorenkarriere standen ein Pseudonym und zwei Fantasyromane. Bei Wereblood (1978) und Werenight (1979), die unter dem Pseudonym Eric Iverson erschienen sind, handelt es sich um typische Fantasy der ausgehenden 70er Jahre – das heißt: um Sword & Sorcery. In ihnen kämpft Gerin, der auch the Fox genannt wird, in den mehr oder minder vergessenen und sich selbst überlassenen nördlichen Marschen eines (ein bisschen an das Römische Reich erinnernden) Imperiums gegen Barbarenhorden, Gestaltwandler und machthungrige Barone. Zwar ist Gerin – der nicht nur der Sohn eines Barons ist, sondern u.a. auch Geschichte studiert hat, sich für Literatur interessiert, in dem hünenhaften Van of the Strong Arm einen weitgereisten, gebildeten Freund besitzt und recht bald die Frau fürs Leben findet und heiratet – ein für die Sword & Sorcery ziemlich untypischer Held, doch der Rest der Romane bietet nichts, was man nicht schon in anderen Werken dieses Typus ähnlich oder besser gemacht gelesen hätte.
Vielleicht sind Turtledove seine Schwächen selbst aufgefallen, denn er verlegte sich zunächst einige Jahre auf das Schreiben von Geschichten – bis Mitte der 80er Jahre noch unter dem (um die Mittelinitiale “G.” ergänzten) Iverson-Pseudonym, ab 1985 unter seinem richtigen Namen –, und Agent of Byzantium (1987, erw. 1994), sein nächstes Buch, war dann auch ein “Fix-up” aus einigen dieser Geschichten, in deren Mittelpunkt Basil Argyros, ein byzantinischer Soldat und Geheimagent steht. Argyros’ Welt unterscheidet sich in einigen signifikanten Details von unserer – z.B. war Justinians Wirken erfolgreicher, und Mohammed war ein christlicher Erzbischof und Heiliger – und stellt somit das erste der vielen Werke aus dem Bereich der Alternativwelt-Literatur dar, die Turtledove von nun an in Form von Romanen und Erzählungen schaffen sollte.
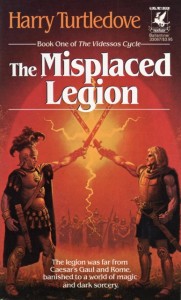 Mit The Misplaced Legion (1987), dem ersten Band des Videssos Cycle, wandte er sich der Military Fantasy zu, doch eigentlich handelt es sich auch hierbei um Alternate History, denn das Empire of Videssos, in das es drei römische Kohorten verschlägt, als ihr Anführer Marcus Aemilius Scaurus mit dem Keltenfürsten Viridovix die Klinge kreuzt, ist sowohl kulturell als auch von den geschichtlichen Ereignissen her stark an das Byzantinische Reich (des 7. Jahrhunderts) angelehnt. Die Unterschiede liegen in der Geographie, den Namen – und in der Tatsache, dass auf der Welt von Videssos Magie funktioniert. Doch abgesehen davon lassen sich die Realwelt-Vorbilder der Feinde von Videssos ebenso erkennen wie die byzantinischen Pendants der Herrscher des Kaiserreichs. Dass Turtledove Byzanz schon zum zweiten Mal als Blaupause benutzt, ist übrigens kein Wunder, denn er hat einen Doktortitel in byzantinischer Geschichte. Was dazu führt, dass Videssos (das gilt für das Kaiserreich ebenso wie für die gleichnamige Hauptstadt) als Setting ungemein stimmig und authentisch wirkt. Wobei man dieses Setting mitsamt seiner Besonderheiten erst nach und nach in The Misplaced Legion und den Folgebänden An Emperor for the Legion, The Legion of Videssos und Swords of the Legion (alle 1987) kennelernt; anfangs durch die Augen von Marcus Aemilius Scaurus, später auch durch die des (ebenfalls mit auf die fremde Welt gelangten) Kelten Viridovix und anderer Figuren. Und natürlich sind Marcus Scaurus und seine Soldaten, die Kaiser Mavrikios Gavras ihre Dienste als Söldner angeboten haben, immer mittendrin im Geschehen – egal, ob es gegen den sich zum Erzfeind entwickelnden Magier Avshar aus Yezd oder um Intrigen am kaiserlichen Hof geht.
Mit The Misplaced Legion (1987), dem ersten Band des Videssos Cycle, wandte er sich der Military Fantasy zu, doch eigentlich handelt es sich auch hierbei um Alternate History, denn das Empire of Videssos, in das es drei römische Kohorten verschlägt, als ihr Anführer Marcus Aemilius Scaurus mit dem Keltenfürsten Viridovix die Klinge kreuzt, ist sowohl kulturell als auch von den geschichtlichen Ereignissen her stark an das Byzantinische Reich (des 7. Jahrhunderts) angelehnt. Die Unterschiede liegen in der Geographie, den Namen – und in der Tatsache, dass auf der Welt von Videssos Magie funktioniert. Doch abgesehen davon lassen sich die Realwelt-Vorbilder der Feinde von Videssos ebenso erkennen wie die byzantinischen Pendants der Herrscher des Kaiserreichs. Dass Turtledove Byzanz schon zum zweiten Mal als Blaupause benutzt, ist übrigens kein Wunder, denn er hat einen Doktortitel in byzantinischer Geschichte. Was dazu führt, dass Videssos (das gilt für das Kaiserreich ebenso wie für die gleichnamige Hauptstadt) als Setting ungemein stimmig und authentisch wirkt. Wobei man dieses Setting mitsamt seiner Besonderheiten erst nach und nach in The Misplaced Legion und den Folgebänden An Emperor for the Legion, The Legion of Videssos und Swords of the Legion (alle 1987) kennelernt; anfangs durch die Augen von Marcus Aemilius Scaurus, später auch durch die des (ebenfalls mit auf die fremde Welt gelangten) Kelten Viridovix und anderer Figuren. Und natürlich sind Marcus Scaurus und seine Soldaten, die Kaiser Mavrikios Gavras ihre Dienste als Söldner angeboten haben, immer mittendrin im Geschehen – egal, ob es gegen den sich zum Erzfeind entwickelnden Magier Avshar aus Yezd oder um Intrigen am kaiserlichen Hof geht.
Der Videssos Cycle war so erfolgreich, dass Harry Turtledove ihm wenige Jahre später The Tale of Krispos folgen ließ, ein aus den Romanen Krispos Rising, Krispos of Videssos (beide 1991) und Krispos the Emperor (1994) bestehendes Prequel, das den Aufstieg eines legendären Herrschers von Videssos schildert. Kurz darauf folgte mit The Time of Troubles ein noch weiter in der Vergangenheit angesiedeltes, die Romane The Stolen Throne (1995), Hammer and Anvil (1996), The Thousand Cities (1997) und Videssos Besieged (1998) umfassendes Prequel.
Parallel zu den Arbeiten am Krispos-Dreiteiler hatte Turtledove sich den Helden seiner ersten beiden Romane noch einmal vorgenommen, sodass 1994 mit Werenight eine überarbeitete Version besagter Romane und zugleich der Auftakt einer von nun an Gerin the Fox betitelten Reihe erschien, die mit Prince of the North (1994), King of the North (1996) und Fox and Empire (1998) fortgesetzt wurde und sich als deutlich verbessert erwies. Darüberhinaus veröffentlichte der überaus fleißige Turtledove in diesen Jahren mehrere der SF zuzuzählende Einzelromane und die ersten Bände von Worldwar und The Great War, seinen beiden großen Alternativwelt-Zyklen, in denen sich der Verlauf des Zweiten Weltkriegs durch das Eingreifen von Aliens ändert bzw. durch den Sieg der Konföderierten im amerikanischen Bürgerkrieg ein anderer Geschichtsverlauf entsteht.
Die sechsbändige Zyklus The Darkness – Into the Darkness (1999), Darkness Descending (2000), Through the Darkness (2001), Rulers of 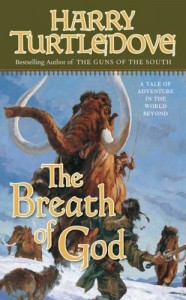 the Darkness (2002), Jaws of Darkness (2003) und Out of the Darkness (2004) – wartet mit einer merkwürdigen Melange aus einem an Geschehnisse im Ersten und Zweiten Weltkrieg angelehnten Krieg in einer feudalistischen Welt, in der Magie funktioniert (und in der dann auch logischerweise mit magischen Waffen und Wesen gekämpft wird) auf, während für die unter dem Pseudonym Dan Chernenko erschienene Trilogie The Scepter of Mercy (The Bastard King (2003), The Chernagor Pirates (2004) und The Scepter’s Return (2005)) einmal mehr das Byzantinische Reich bzw. dessen Geschichte Pate stand.
the Darkness (2002), Jaws of Darkness (2003) und Out of the Darkness (2004) – wartet mit einer merkwürdigen Melange aus einem an Geschehnisse im Ersten und Zweiten Weltkrieg angelehnten Krieg in einer feudalistischen Welt, in der Magie funktioniert (und in der dann auch logischerweise mit magischen Waffen und Wesen gekämpft wird) auf, während für die unter dem Pseudonym Dan Chernenko erschienene Trilogie The Scepter of Mercy (The Bastard King (2003), The Chernagor Pirates (2004) und The Scepter’s Return (2005)) einmal mehr das Byzantinische Reich bzw. dessen Geschichte Pate stand.
Recht originell ist hingegen die Idee, die dem aus den drei Romanen Beyond the Gap (2007), The Breath of God (2008) und The Golden Shrine (2009) bestehenden Zyklus Opening of the World zugrundeliegt: in einem mehr als tausend Jahre auf dem Gebiet nördlich des Raumsdalian Empire lastenden Gletscher öffnet sich plötzlich ein Spalt und macht den Weg zu all dem frei, was auf der anderen Seite liegt – allerdings gilt das in beide Richtungen …
Die bisher genannten Romane machen nur einen Teil – nämlich den, der der Fantasy zuzurechnen ist – von Harry Turtledoves Gesamtwerk aus, denn der ist wie schon erwähnt ein überaus fleißiger Autor und hat von 2000 bis 2013 fast 50 Romane veröffentlicht. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass von einigen Kritikern bei etlichen seiner neueren Romane stilistische Nachlässigkeiten ebenso moniert werden wie zunehmend repetetiver werdende Plots und Schwächen in der Figurenzeichnung. Unabhängig davon, wie gut oder schlecht Turtledoves neue(re) Romane sein mögen, kann man dem Videssos Cycle in seiner Gesamtheit – also einschließlich der Prequels, zu denen sich 2005 mit Bridge of the Separator noch ein Einzelroman gesellte – zubilligen, dass er solide Abenteuerfantasy (die manchmal sogar über die rein abenteuerliche Ebene hinausgeht) in einem sehr überzeugend gestalteten und authentisch wirkenden Setting bietet und der neben Glen Cooks Black Company vielleicht wichtigste Military-Fantasy-Zyklus ist (auch wenn die beiden Zyklen weder vorder- noch hintergründig viel miteinander gemein haben!). Die Romane aus den 90ern liegen inzwischen auch in Sammelbänden als Videssos Cycle: Volume One und Videssos Cycle: Volume Two (beide 2013), The Tale of Krispos (2007) und The Time of Troubles I und II (2005) vor, sollten im Zweifelsfall aber unbedingt in der Reihenfolge ihrer Entstehung und nicht in der ihrer inneren Chronologie gelesen werden.
Bibliotheka Phantastika gratuliert Yves Meynard, der heute 50 Jahre alt wird. Der am 13. Juni 1964 in Québec, der Haupstadt der gleichnamigen kanadischen Provinz geborene Yves Meynard gilt als einer der wichtigsten Vertreter der neuen Generation frankokanadischer SF- und Fantasy-Autoren und wurde für seine Erzählungen und Romane in französischer Sprache bereits mehrfach mit den Preisen der frankokanadischen SF- und Fantasy-Szene wie dem Prix Aurora, dem Prix Boréal und 1994 auch einmal mit dem Grand Prix de la Science-Fiction et du Fantastique Québécois ausgezeichnet. Im Gegensatz zu den meisten seiner Kolleginnen und Kollegen schreibt Meynard allerdings nicht ausschließlich auf Französisch, sondern verfasst gelegentlich – oder, wie viele Leser meinen: viel zu selten – auch Geschichten und Romane auf Englisch. Der Löwenanteil seines Schaffens liegt jedoch nur in französischer Sprache vor: knapp drei Dutzend Geschichten auf Französisch stehen ein gutes Dutzend auf Englisch gegenüber, und bei den Romanen sieht das Verhältnis mit dreizehn zu zwei noch extremer aus. Während sich unter den dreizehn Romanen in französischer Sprache mehrere Jugendbücher finden lassen, richten sich The Book of Knights und Chrysanthe eindeutig an ein erwachsenes Publikum.
The Book of Knights (1998) ist nicht nur der Titel von Yves Meynards erstem Roman auf Englisch, sondern auch der eines Buches, das in diesem Roman eine bedeutende Rolle spielt. Denn als der junge Adelrune – ein Findelkind – es auf 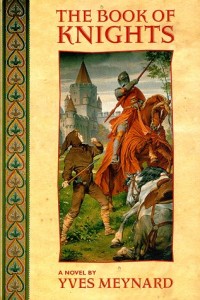 dem staubigen Dachboden des Hauses seiner Stiefeltern findet, ist es für ihn wie ein Fenster zu einer anderen Welt – einer Welt, die sehr viel großartiger und bunter zu sein verspricht als seine unmittelbare Umgebung, das Dorf Faudace, in dem er genau wie alle anderen nach den strengen Regeln der Rule – eines rigiden Glaubenssystems – lebt. Fast zwangsläufig fasst Adelrune den Entschluss, der Enge von Faudace zu entfliehen und selbst ein Ritter zu werden, Ruhm und Ehre zu gewinnen und fantastische Abenteuer zu erleben. Und nach einem denkwürdigen Erlebnis im einzigen Spielwarenladen des Dorfes setzt er seinen Entschluss in die Tat um und macht sich auf die Suche nach Riander, der laut dem Book of Knights Ritter ausbildet. Adelrunes Suche erweist sich als erfolgreich – doch so richtig beginnen seine Abenteuer erst, als er seine Ausbildung beendet hat und sich in die weite Welt aufmacht … Oberflächlich betrachtet, ist The Book of Knights ein Entwicklungsroman im Gewand eines märchenhaften Fantasyromans, dessen Sprach- und Erzählduktus mehr an die europäische Märchen- und Sagentradition erinnert als an zeitgenössische Fantasy. Doch unter der schlichten Oberfläche geht es um einige zentrale Fragen unserer menschlichen Existenz, etwa darum, was aus unseren jugendlichen Träumen wird, wenn wir erwachsen werden, oder auch darum, ob es sinnvoll ist, sein Leben nach gewissen Regeln zu führen – und ob man diese Regeln hinterfragen darf. Unabhängig davon ist The Book of Knights mit seinem anfangs blauäugigen jugendlichen Helden, den großen und kleinen Abenteuern, die er erlebt und an denen er wächst, und seinem die Geschichte perfekt abrundenden Ende einfach ein wundervolles Buch, das eigentlich all denen, die z.B. die Werke einer Patricia McKillip lieben, gefallen müsste.
dem staubigen Dachboden des Hauses seiner Stiefeltern findet, ist es für ihn wie ein Fenster zu einer anderen Welt – einer Welt, die sehr viel großartiger und bunter zu sein verspricht als seine unmittelbare Umgebung, das Dorf Faudace, in dem er genau wie alle anderen nach den strengen Regeln der Rule – eines rigiden Glaubenssystems – lebt. Fast zwangsläufig fasst Adelrune den Entschluss, der Enge von Faudace zu entfliehen und selbst ein Ritter zu werden, Ruhm und Ehre zu gewinnen und fantastische Abenteuer zu erleben. Und nach einem denkwürdigen Erlebnis im einzigen Spielwarenladen des Dorfes setzt er seinen Entschluss in die Tat um und macht sich auf die Suche nach Riander, der laut dem Book of Knights Ritter ausbildet. Adelrunes Suche erweist sich als erfolgreich – doch so richtig beginnen seine Abenteuer erst, als er seine Ausbildung beendet hat und sich in die weite Welt aufmacht … Oberflächlich betrachtet, ist The Book of Knights ein Entwicklungsroman im Gewand eines märchenhaften Fantasyromans, dessen Sprach- und Erzählduktus mehr an die europäische Märchen- und Sagentradition erinnert als an zeitgenössische Fantasy. Doch unter der schlichten Oberfläche geht es um einige zentrale Fragen unserer menschlichen Existenz, etwa darum, was aus unseren jugendlichen Träumen wird, wenn wir erwachsen werden, oder auch darum, ob es sinnvoll ist, sein Leben nach gewissen Regeln zu führen – und ob man diese Regeln hinterfragen darf. Unabhängig davon ist The Book of Knights mit seinem anfangs blauäugigen jugendlichen Helden, den großen und kleinen Abenteuern, die er erlebt und an denen er wächst, und seinem die Geschichte perfekt abrundenden Ende einfach ein wundervolles Buch, das eigentlich all denen, die z.B. die Werke einer Patricia McKillip lieben, gefallen müsste.
Es dauerte vierzehn Jahre, bis Yves Meynard mit Chrysanthe (2012) seinen zweiten Roman auf Englisch vorlegte. Wesentlich umfangreicher als sein Vorgänger (der Roman war dem Vernehmen nach ursprünglich als Trilogie geplant) beginnt Chrysanthe im Hier und Heute – allerdings einem Hier und Heute, das sich auf subtile Weise von unserer Gegenwart unterscheidet. Was kein Wunder ist, denn Christine, die Hauptfigur des Romans, lebt in einer “gemachten” Welt; in Wirklichkeit ist sie die Tochter von Edisthen, dem – zumindest seiner Meinung nach (und er hat gute Gründe für seine Meinung) – rechtmäßigen Herrscher der einzig wahren titelgebenden Welt. Ist es ein Wunder, dass Christine, ein ganz normaler Teenager mit für ein Mädchen im Teenageralter ganz normalen Wünschen und Sehnsüchten, diese Geschichte, die ihr ein schwarz gekleideter junger Mann namens Quentin erzählt, der noch nicht einmal mit einem Telefon umgehen kann, anfangs nicht glaubt? Vor allem, da 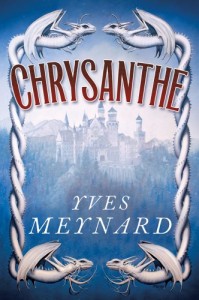 Chrysanthe eine “magische” Welt sein soll, auf der Magie funktioniert und das Wirken von God the Mother spürbar und erlebbar ist? Doch nachdem Christine mit Quentin durch ein Portal gegangen und auf Chrysanthe – einer wirklich und im wahrsten Sinne des Wortes magischen Welt – angekommen ist, bleibt ihr nicht mehr viel Zeit für Skepsis, denn sie wird in den Konflikt zwischen ihrem Vater und den Söhnen des vorherigen Königs hineingezogen – den gleichen Konflikt, der vor zehn Jahren dazu geführt hat, dass sie von den Feinden ihres Vaters entführt und auf einer gemachten Welt versteckt wurde … Das Konzept von Parallel- oder Alternativwelten ist in SF & Fantasy weit verbreitet, Meynards Konzept in Chrysanthe ähnelt aber vor allem dem in Roger Zelaznys Amber-Zyklus. Davon einmal abgesehen hat er mit Chrysanthe, der einzig wahren Welt, ein faszinierendes Setting geschaffen, das die phantastischen Möglichkeiten der Fantasy ziemlich weit auslotet und eine beeindruckende Bühne für interessante, durchweg gelungene Figuren und ihren Kampf um die Macht bietet. (Es bliebe allerdings anzumerken, dass Meynards auch stilistisch überzeugender Roman mit einem wichtigen Plotelement aufwartet, das vor allem in dieser Hinsicht sensibilisierten Leserinnen Bauchschmerzen oder Schlimmeres bereiten könnte. Um niemanden zu spoilern, soll der Hinweis genügen, dass es dabei um sich als falsch erweisende Erinnerungen darüber geht, was der Hauptfigur in ihrer Kindheit angetan wurde bzw. um die Schlüsse, die man aus dem Umgang mit diesem Thema im Roman für den Umgang damit in unserer Realität zieht.)
Chrysanthe eine “magische” Welt sein soll, auf der Magie funktioniert und das Wirken von God the Mother spürbar und erlebbar ist? Doch nachdem Christine mit Quentin durch ein Portal gegangen und auf Chrysanthe – einer wirklich und im wahrsten Sinne des Wortes magischen Welt – angekommen ist, bleibt ihr nicht mehr viel Zeit für Skepsis, denn sie wird in den Konflikt zwischen ihrem Vater und den Söhnen des vorherigen Königs hineingezogen – den gleichen Konflikt, der vor zehn Jahren dazu geführt hat, dass sie von den Feinden ihres Vaters entführt und auf einer gemachten Welt versteckt wurde … Das Konzept von Parallel- oder Alternativwelten ist in SF & Fantasy weit verbreitet, Meynards Konzept in Chrysanthe ähnelt aber vor allem dem in Roger Zelaznys Amber-Zyklus. Davon einmal abgesehen hat er mit Chrysanthe, der einzig wahren Welt, ein faszinierendes Setting geschaffen, das die phantastischen Möglichkeiten der Fantasy ziemlich weit auslotet und eine beeindruckende Bühne für interessante, durchweg gelungene Figuren und ihren Kampf um die Macht bietet. (Es bliebe allerdings anzumerken, dass Meynards auch stilistisch überzeugender Roman mit einem wichtigen Plotelement aufwartet, das vor allem in dieser Hinsicht sensibilisierten Leserinnen Bauchschmerzen oder Schlimmeres bereiten könnte. Um niemanden zu spoilern, soll der Hinweis genügen, dass es dabei um sich als falsch erweisende Erinnerungen darüber geht, was der Hauptfigur in ihrer Kindheit angetan wurde bzw. um die Schlüsse, die man aus dem Umgang mit diesem Thema im Roman für den Umgang damit in unserer Realität zieht.)
Yves Meynards bisher zwei in englischer Sprache verfassten Romane sind einerseits so unterschiedlich, andererseits jeder für sich so interessant und originell, dass man wirklich bedauern kann, dass er nicht öfters auf Englisch schreibt. Immerhin hat die englischsprachige SF&F-Community diese beiden Romane (und ein gutes Dutzend Geschichten) und ist damit viel besser dran als rein deutschsprachige Leser und Leserinnen. Die dürften allenfalls über den Namen Yves Meynard gestolpert sein, wenn sie Gene Wolfes Mythgarthr-Zweiteiler gelesen haben, denn dessen erster Band Der Ritter ist Yves Meynard und seinem Book of Knights gewidmet. Warum wohl?