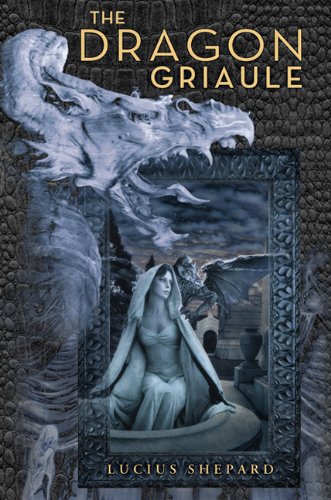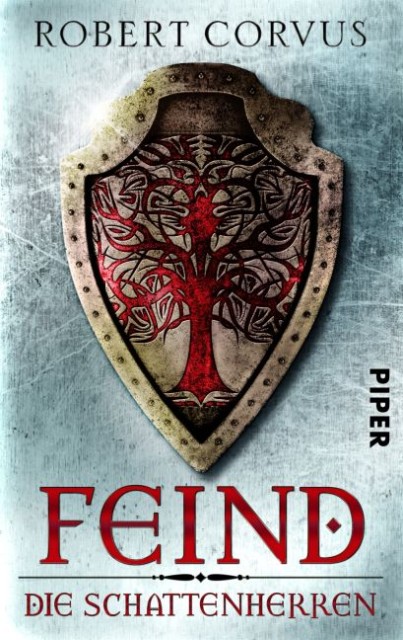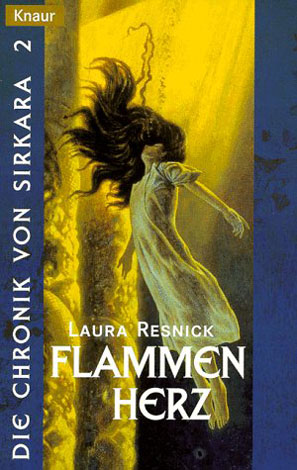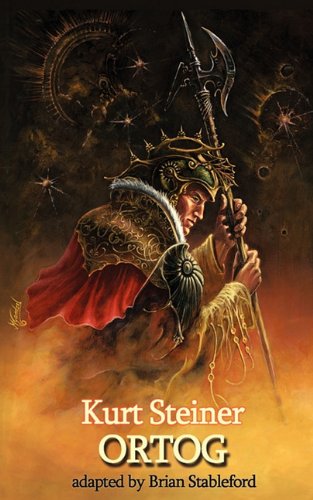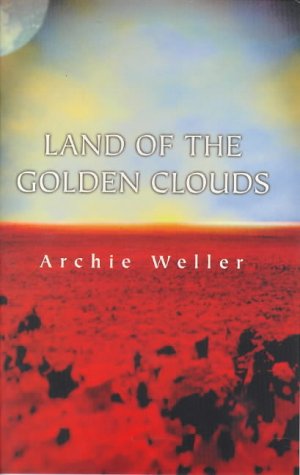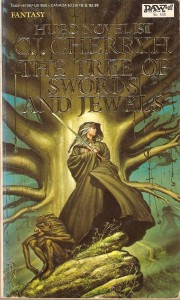 Bibliotheka Phantastika gratuliert C.J. Cherryh, die heute 70 Jahre alt wird. Als die am 01. September 1942 in St. Louis, Missouri, geborene Caroline Janice Cherry (das “h” hat sie ihrem Namen auf Anraten ihres damaligen Verlegers Donald A. Wollheim hinzugefügt, da er der Ansicht war, Cherry würde zu sehr nach einer Liebesroman-Autorin klingen) im Jahre 1976 mit Gate of Ivrel (dt. Das Tor von Ivrel (1979)) und Brothers of Earth (dt. Brüder der Erde (1979)) ihre ersten Romane veröffentlichte, wurde ihr rasch eine große Karriere prophezeit. Gut 35 Jahre und rund doppelt so viele Romane (plus viele, viele Kurzgeschichten sowie etliche Collections und Anthologien) später kann man sagen, dass diese Prophezeiung sich bewahrheitet hat.
Bibliotheka Phantastika gratuliert C.J. Cherryh, die heute 70 Jahre alt wird. Als die am 01. September 1942 in St. Louis, Missouri, geborene Caroline Janice Cherry (das “h” hat sie ihrem Namen auf Anraten ihres damaligen Verlegers Donald A. Wollheim hinzugefügt, da er der Ansicht war, Cherry würde zu sehr nach einer Liebesroman-Autorin klingen) im Jahre 1976 mit Gate of Ivrel (dt. Das Tor von Ivrel (1979)) und Brothers of Earth (dt. Brüder der Erde (1979)) ihre ersten Romane veröffentlichte, wurde ihr rasch eine große Karriere prophezeit. Gut 35 Jahre und rund doppelt so viele Romane (plus viele, viele Kurzgeschichten sowie etliche Collections und Anthologien) später kann man sagen, dass diese Prophezeiung sich bewahrheitet hat.
Der weitaus überwiegende Teil ihres Schaffens ist der SF zuzurechnen, und die meisten ihrer SF-Romane spielen vor einem gemeinsamen Hintergrund, dem Alliance-Union Universe, dem sie mit Brothers of Earth einen ersten Besuch abstattete. Auch Gate of Ivrel ist in diesem Universum angesiedelt, ohne allerdings mit den anderen Subzyklen großartig verbunden zu sein bzw. im Gesamtkonzept eine Rolle zu spielen.
Ganz im Gegenteil, der Roman liest sich – wie die ganze, mit Well of Shiuan (1978; dt. Der Quell von Shiuan (1980)) und Fires of Azeroth (1979; dt. Die Feuer von Azeroth (1982)) in kurzen Abständen fortgesetzte Sequenz um Morgaine – in weiten Teilen wie ein Fantasyroman. Denn die Geschichte der geheimnisvollen Morgaine, die durch Sternentore auf technologisch rückständige Planeten reist, um besagte Sternentore dort zu versiegeln, bedient sich ihrer Fantasyelemente so überzeugend, dass man die SF-Prämisse rasch vergisst. Was nicht zuletzt an Cherryhs Fähigkeiten liegt, ihre Figuren treffend zu charakterisieren und den Kulturen, denen Morgaine auf den verschiedenen Planeten begegnet, glaubhafte individuelle Konturen zu verleihen. Hinzu kommt das Spannungsfeld, das durch die Beziehung der beiden in jeglicher Hinsicht vollkommen unterschiedlichen Hauptfiguren Morgaine und Vanye entsteht, und das Cherryh in jedem Roman weiter ausleuchtet und auch im deutlich später entstandenen vierten Band Exile’s Gate (1988) wieder aufgreift.
Die anderen Fantasyromane von C.J. Cherryh kommen dann ganz ohne SF-Elemente aus (was vermutlich nicht zuletzt damit zu tun hat, dass sich Ende der 70er Jahre die Fantasy endgültig als Genre etabliert hatte und auch als solche vermarktet werden konnte). Bei den beiden unter dem Oberbegriff Ealdwood Stories zusammengefassten Romanen The Dreamstone und The Tree of Swords and Jewels (beide 1983; dt. Stein der Träume (1985) und Der Baum der Schwerter und Juwelen (1988)) handelt es sich um lupenreine, allerdings ungewöhnlich düstere keltische Fantasy, die zeigt, dass Cherryhs von ihren Charakteren lebende Romane auch vor einem bekannten und vertrauten – zum damaligen Zeitpunkt noch deutlich frischer als heutzutage wirkenden – Hintergrund funktionieren.
Die sog. Russian Stories hingegen – Rusalka (1989), Chernevog (1990) und Yvgenie (1991) – spielen nicht nur in einem alternativen mittelalterlichen russischen Königreich mit dem Zentrum Kiew, sondern greifen auch stark auf Motive der slawischen Mythologie zurück. Dies könnte – verbunden mit der zwiespältigen Darstellung von Magiern und Magie – mit dafür verantwortlich sein, dass die Russian Stories deutlich weniger erfolgreich als Cherryhs andere Fantasyromane waren und auch nicht ins Deutsche übersetzt wurden. Ungewöhnliche Ansätze bieten auch The Paladin (1988; dt. Der Paladin (1994)) – hier ist das Setting dem China der Tang-Dynastie nachempfunden – und The Goblin Mirror (1992; dt. Der Koboldspiegel (1996)), in dem die Interaktion zwischen Menschen- und Koboldwelt im Mittelpunkt steht. Faery in Shadow (1993) ist dann wieder – auch dieses Mal recht düstere – keltische Fantasy, in der sich die altbekannten Sidhe tummeln.
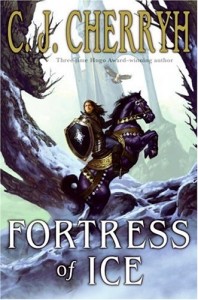 Mit Fortress in the Eye of Time (1995), dem Auftakt der Fortress Series, hat C.J. Cherryh sich schließlich ihr ganz persönliches High-Fantasy-Universum gegönnt (das nur auf den ersten Blick ein “typisches” ist). Im Mittelpunkt dieses erstaunlich langsam erzählten ersten Bandes steht Tristen, ein durch einen Zauberspruch geschaffener junger Mann, der einen Großteil des Romans damit verbringt, herauszufinden, wer er eigentlich ist. Was folgt und auch in den weiteren Bänden Fortress of Eagles (1998), Fortress of Owls (1999), Fortress of Dragons (2000) und Fortress of Ice (2006) die Handlung größtenteils bestimmt, ist eine teilweise vielleicht zu detailverliebt geschilderte Suche nach dem Platz eines Wesens in der Welt, in der es nun einmal leben muss. Verbunden mit einer anfangs generisch wirkenden, sich Roman um Roman jedoch komplexer und undurchschauberer präsentierenden Welt ergibt das einen der interessantesten (mehrbändigen) Entwicklungsromane der Fantasy, der vor allem durch seine psychologisch und politisch glaubwürdig agierenden Figuren überzeugt.
Mit Fortress in the Eye of Time (1995), dem Auftakt der Fortress Series, hat C.J. Cherryh sich schließlich ihr ganz persönliches High-Fantasy-Universum gegönnt (das nur auf den ersten Blick ein “typisches” ist). Im Mittelpunkt dieses erstaunlich langsam erzählten ersten Bandes steht Tristen, ein durch einen Zauberspruch geschaffener junger Mann, der einen Großteil des Romans damit verbringt, herauszufinden, wer er eigentlich ist. Was folgt und auch in den weiteren Bänden Fortress of Eagles (1998), Fortress of Owls (1999), Fortress of Dragons (2000) und Fortress of Ice (2006) die Handlung größtenteils bestimmt, ist eine teilweise vielleicht zu detailverliebt geschilderte Suche nach dem Platz eines Wesens in der Welt, in der es nun einmal leben muss. Verbunden mit einer anfangs generisch wirkenden, sich Roman um Roman jedoch komplexer und undurchschauberer präsentierenden Welt ergibt das einen der interessantesten (mehrbändigen) Entwicklungsromane der Fantasy, der vor allem durch seine psychologisch und politisch glaubwürdig agierenden Figuren überzeugt.
Die Fortress Series ist recht schwergewichtiger Stoff; dass Cherryh es gelegentlich auch leichter und abenteuerlicher kann, zeigt sie nicht nur in einigen ihrer vielen SF-Romane, sondern im Bereich der Fantasy in ihren in den 80er Jahren entstandenen Beiträgen – mehreren Kurzgeschichten und drei Romanen, zwei davon in Zusammenarbeit mit Janet Morris – zu der Shared-World-Reihe Heroes in Hell. Nachdem C.J. Cherryh viele Jahre lang zu den Autoren und Autorinnen gehörte, deren Werke mit schöner Regelmäßigkeit ins Deutsche übersetzt wurden, ist damit seit Anfang des neuen Jahrtausends Schluss. Was sowohl im Hinblick auf ihre SF wie auch auf ihre Fantasy eher bedauerlich ist.
Category: Reaktionen
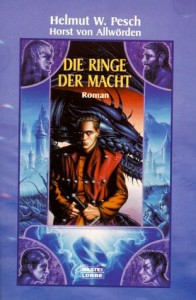 Bibliotheka Phantastika gratuliert Helmut W. Pesch, der heute 60 Jahre alt wird. Der am 30. August 1952 in Mönchengladbach geborene Helmut Pesch ist in den letzten Jahren vor allem durch seine Veröffentlichungen zu Tolkiens Elben-Sprache (Elbisch – Grammatik, Schrift und Wörterbuch der Elben-Sprache J.R.R. Tolkiens (2003) und Elbisch – Lern- und Übungsbuch der Elben-Sprache J.R.R. Tolkiens (2004)) einer breiteren Leserschaft bekannt geworden, doch das sind nur die am deutlichsten sichtbaren Früchte einer Beschäftigung mit der Fantasy im Allgemeinen und J.R.R. Tolkien im Besonderen, die bereits in den 70er Jahren ihren Anfang genommen hat. Nach ersten Gehversuchen als Illustrator und Kurzgeschichtenautor in den Publikationen des Fantasyclubs FOLLOW schuf Pesch für die von 1973 bis ’74 erschienene erste deutsche Fantasy-Heftserie Dragon – Söhne von Atlantis Innenillustrationen, Karten und schließlich Titelbilder, und war auch bei der ab 1980 erschienenen zweiten Fantasy-Heftserie Mythor mit Innenillustrationen und Karten dabei.
Bibliotheka Phantastika gratuliert Helmut W. Pesch, der heute 60 Jahre alt wird. Der am 30. August 1952 in Mönchengladbach geborene Helmut Pesch ist in den letzten Jahren vor allem durch seine Veröffentlichungen zu Tolkiens Elben-Sprache (Elbisch – Grammatik, Schrift und Wörterbuch der Elben-Sprache J.R.R. Tolkiens (2003) und Elbisch – Lern- und Übungsbuch der Elben-Sprache J.R.R. Tolkiens (2004)) einer breiteren Leserschaft bekannt geworden, doch das sind nur die am deutlichsten sichtbaren Früchte einer Beschäftigung mit der Fantasy im Allgemeinen und J.R.R. Tolkien im Besonderen, die bereits in den 70er Jahren ihren Anfang genommen hat. Nach ersten Gehversuchen als Illustrator und Kurzgeschichtenautor in den Publikationen des Fantasyclubs FOLLOW schuf Pesch für die von 1973 bis ’74 erschienene erste deutsche Fantasy-Heftserie Dragon – Söhne von Atlantis Innenillustrationen, Karten und schließlich Titelbilder, und war auch bei der ab 1980 erschienenen zweiten Fantasy-Heftserie Mythor mit Innenillustrationen und Karten dabei.
1982 veröffentlichte er mit Fantasy. Theorie und Geschichte einer literarischen Gattung seine Dissertation zum Dr. phil., die bis heute eine der grundlegenden deutschsprachigen sekundärliterarischen Arbeiten zur Fantasy geblieben ist. Seit 1984 arbeitet er nicht nur als Redakteur und Lektor, sondern gelegentlich auch als Übersetzer, und hat zwischen 1984 und 1993 u.a. Romane von John Myers Myers, James Branch Cabell, Dennis L. McKiernan und E.R. Eddison ins Deutsche übertragen. Vor allem die mit Anmerkungen und Erläuterungen versehene Übersetzung von Eddisons The Worm Ouroboros gilt zu recht als Meilenstein deutschsprachiger Fantasy-Übersetzungen.
Bereits 1984 hat Helmut W. Pesch mit J.R.R. Tolkien – der Mythenschöpfer einen Sammelband mit Artikeln zu Tolkien herausgegeben, doch seine eigentliche Faszination mit dem Schöpfer von Mittelerde hat – nach eigener Aussage – erst allmählich angefangen. Ein Ergebnis dieser Faszination sind die bereits erwähnten Elbisch-Bücher, der Sammelband Das Licht von Mittelerde (1994), der Aufsätze und Vorträge enthält, sowie eine Handvoll verstreuter Artikel, etwa in der Schriftenreihe der Phantastischen Bibliothek Wetzlar.
Ein weiteres, gänzlich anders geartetes Ergebnis sind die beiden Romane Die Ringe der Macht (1998, mit Horst von Allwörden) und Die Herren der Zeit (2000, beide zusammen als Der Ring der Zeit (2008)), die sogenannte Elderland-Saga, die sich – als bewusste Hommage angelegt – etlicher erzählerischer und inhaltlicher Elemente von Tolkiens Herr der Ringe bedient, sie variiert und verfremdet und doch immer wieder augenzwinkernd auf das nie verhohlene Original verweist. Das kleine, gemütliche und ein bisschen vertratschte Völkchen der Ffolks steht dabei für die Hobbits, und ähnlich wie Frodo Beutlin im Original muss sich auch Kimberon Veit – begleitet von einem Menschen, einem Zwerg und einem Elb (sowie seiner Haushälterin) – auf eine gefährliche Queste durch eine etwas andere Version von Mittelerde begeben. Eine klassische Handlung, ein angenehm lesbarer Stil und eine gelungene Sprache vereinen sich zu einem Werk, in das nicht nur Tolkien-Afficionados, sondern auch Freunde und Liebhaberinnen klassischer Questen durchaus einmal einen Blick werfen sollten.
Parallel zur Elderland-Saga verfasste Pesch Ende der 1990er Jahre mit der Anderswelt-Trilogie eine Fantasy-Jugendbuchreihe, in der er seine drei jugendlichen Protagonisten, Siegfried („Siggi“), Gunhild und Hagen auf ebenso spannende wie (für die Helden und die Heldin) unangenehme Weise mit großen Sagenkreisen in Berührung kommen lässt. So schlüpfen die drei in Die Kinder der Nibelungen (1998) in die – nomen est omen – naheliegenden Rollen und werden so unmittelbar in die mythischen Ereignisse hineingezogen. Dabei erzählt Pesch nicht einfach das Nibelungenlied nach, sondern spinnt vielmehr eine Fortsetzung aus dem Stoff der Völsungensaga und der nordischen Mythologie, in der nicht alles so ist, wie es anfangs zu sein scheint. Wie zuhause er sich im Themenfeld Mythologie fühlt, beweist Pesch auch mit den beiden Fortsetzungen, die nach dem bewährten Storyrezept funktionieren. In Die Kinder von Erin (1999) werden Siggi und Hagen im Rahmen eines Irlandurlaubes in die Sagenkreise um Finn den Weissen und Cú Chulainn hineingezogen, während Gunhild bei den drei Göttinnen Eriú, Brigid und Caillech unterkommt. In Die Kinder von Avalon (2001) schließlich geraten alle drei auf die titelgebende mythische Insel und müssen sich auf die Suche nach dem Gral begeben.
Nach diesem Ausflug als Romancier stand wieder Tolkien im Mittelpunkt von Peschs Arbeit; zum einen die bereits erwähnte Beschäftigung mit Tolkiens Elben-Sprache, zum anderen die Übersetzung von Tom Shippeys Tolkien-Biographie The Road to Middle-Earth (1982, rev. u. erw. 2003) als Der Weg nach Mittelerde: Wie J.R.R. Tolkien Der Herr der Ringe schuf (2008). Und schließlich übersetzte er zusammen mit Hans J. Schütz The Children of Húrin (2007), den von Christopher Tolkien herausgegebenen Band um eine der wichtigsten und dramatischsten Episoden aus dem Ersten Zeitalter von Mittelerde (Die Kinder Húrins (2007)). Auch wenn seither der Lektor Helmut W. Pesch wieder den Autor, Übersetzer, Kartenzeichner und Illustrator Helmut W. Pesch in den Hintergrund gedrängt hat, möchten wir ihm als einem der wichtigsten Wegbegleiter und Former der Fantasy in Deutschland an dieser Stelle herzlich zum Geburtstag gratulieren. In diesem Sinne: Alles Gute, Helmut!
Bibliotheka Phantastika gratuliert Lucius Shepard, der heute 65 Jahre alt wird. Der am 21. August in Lynchburg im amerikanischen Bundesstaat Virginia geborene Shepard gilt zu Recht als einer der thematisch und stilistisch interessantesten derzeit aktiven Autoren der phantastischen Literatur. Diesen Ruf verdankt er vor allem den rund 100 Kurzgeschichten und Erzählungen, die er – beginnend mit “The Taylorsville Reconstruction” (1983) – seit Anfang der 80er Jahre veröffentlicht hat, und von denen bisher nur ein relativ geringer Teil ins Deutsche übersetzt wurde. Dabei bewegt er sich in allen Genres, die sich unter dem Oberbegriff phantastische Literatur subsummieren lassen, von SF über Horror und Magischen Realismus – der sonst zumeist in der lateinamerikanischen Literatur zu finden ist – bis hin zur Fantasy.
Am Anfang seiner Karriere hat Shepard – parallel zu seinem bis in die frühen 90er enormen Ausstoß an Geschichten – auch einige wenige Romane verfasst; Green Eyes (1984; dt. Grüne Augen (1989)) behandelt dabei die Zombiethematik im Gewand eines SF-Romans (sprich: mit einem wissenschaftlichen Ansatz), Life during Wartime (1987; dt. Das Leben im Krieg (1989)) schildert in einer beeindruckenden Sprache und mit konsequent übersteigerten, aus Vietnamkriegsberichten bekannten Bildern und Motiven einen fiktiven, in naher Zukunft stattfindenden Krieg in Lateinamerika, und The Golden (1993; dt. Die Spur des Goldenen Opfers (1997)) bereichert den Vampirmythos um eine originelle Facette.
 Doch Shepards eigentliche Stärke liegt in kürzeren, vor allem aber längeren Erzählungen bzw. Kurzromanen, in denen seine stilistischen Fähigkeiten voll zum Tragen kommen, und denen er sich inzwischen fast ausschließlich zugewandt hat. Für Fantasyleser und -leserinnen sind in diesem Zusammenhang – neben der atmosphärisch, aber nicht unbedingt inhaltlich überzeugenden Joseph-Conrad-Hommage Kalimantan (1990; dt. Kalimantan (1992)) – in erster Linie die Geschichten um den Drachen Griaule interessant, die vor kurzem in den USA unter dem Titel The Dragon Griaule gesammelt erschienen sind. Beginnend mit “The Man Who Painted the Dragon Griaule” (1984) zeigt uns Shepard in ihnen Fragmente eines Fantasy-Universums, das einerseits fremd und exotisch wirkt (oder genauer: fremder und exotischer als die meisten anderen Fantasy-Universen), andererseits aber direkt um die Ecke liegen könnte. Der titelgebende Drache ist dabei ein gewaltiges, unbewegliches Wesen, das das Leben der Bevölkerung eines reichen, fruchtbaren Landstrichs durch seine reine Anwesenheit beherrscht. Und dieser Drache soll nun durch einen Anstrich mit giftiger Farbe getötet werden, denn auch wenn Griaule körperlich unbeweglich ist, kann er mit seinem Geist die Bewohner der Gegend beeinflussen, kann ihre Träume und Wünsche manipulieren. In den weiteren Erzählungen (“The Scalehunter’s Beautiful Daughter” (1988), “The Father of Stones” (1988), “Liar’s House” (2004), “The Taborin Scale” (2010) und “The Skull” (2012)) verändern sich die Gegebenheiten nach und nach. Die Welt und die Menschen in ihr wandeln sich, und schließlich ist Griaule nichts weiter als ein Mythos – in einer Welt, die der unseren dann doch sehr ähnlich ist.
Doch Shepards eigentliche Stärke liegt in kürzeren, vor allem aber längeren Erzählungen bzw. Kurzromanen, in denen seine stilistischen Fähigkeiten voll zum Tragen kommen, und denen er sich inzwischen fast ausschließlich zugewandt hat. Für Fantasyleser und -leserinnen sind in diesem Zusammenhang – neben der atmosphärisch, aber nicht unbedingt inhaltlich überzeugenden Joseph-Conrad-Hommage Kalimantan (1990; dt. Kalimantan (1992)) – in erster Linie die Geschichten um den Drachen Griaule interessant, die vor kurzem in den USA unter dem Titel The Dragon Griaule gesammelt erschienen sind. Beginnend mit “The Man Who Painted the Dragon Griaule” (1984) zeigt uns Shepard in ihnen Fragmente eines Fantasy-Universums, das einerseits fremd und exotisch wirkt (oder genauer: fremder und exotischer als die meisten anderen Fantasy-Universen), andererseits aber direkt um die Ecke liegen könnte. Der titelgebende Drache ist dabei ein gewaltiges, unbewegliches Wesen, das das Leben der Bevölkerung eines reichen, fruchtbaren Landstrichs durch seine reine Anwesenheit beherrscht. Und dieser Drache soll nun durch einen Anstrich mit giftiger Farbe getötet werden, denn auch wenn Griaule körperlich unbeweglich ist, kann er mit seinem Geist die Bewohner der Gegend beeinflussen, kann ihre Träume und Wünsche manipulieren. In den weiteren Erzählungen (“The Scalehunter’s Beautiful Daughter” (1988), “The Father of Stones” (1988), “Liar’s House” (2004), “The Taborin Scale” (2010) und “The Skull” (2012)) verändern sich die Gegebenheiten nach und nach. Die Welt und die Menschen in ihr wandeln sich, und schließlich ist Griaule nichts weiter als ein Mythos – in einer Welt, die der unseren dann doch sehr ähnlich ist.
Es fällt schwer, mehr über diese Geschichten zu sagen, ohne allzuviel vorwegzunehmen oder zu verraten. Sie bedienen sich fantasytypischer Motive, doch sie verwenden sie auf ungewohnte Weise. Sie sind eher beunruhigend als beruhigend. Und sie sind es wert, gelesen zu werden. Letzteres erweist sich für deutschsprachige Leser und Leserinnen allerdings als schwierig, denn von den insgesamt sechs Geschichten über den Drachen Griaule sind nur zwei (“Der Mann, der den Drachen Griaule (be)malte” (1987 bzw. 2005) und “Des Schuppensammlers schöne Tochter” (1989)) bislang auf Deutsch erschienen.
Bibilotheka Phantastika gratuliert Bernard Craw, der heute 40 Jahre alt wird. Wobei es sich bei Bernard Craw um ein Pseudonym handelt, unter dem der am 20. August 1972 im niedersächsischen Bramsche geborene Bernd-Otto Robker bisher seine phantastischen Arbeiten veröffentlicht hat. In seinem Romanerstling Sanguis B. – Vampire erobern Köln (2005) mischt er die Vampirthematik mit einem düsteren Endzeitszenario und verlegt das Ganze auf deutschen Boden (nämlich an seinen Wohnort Köln), was dem Roman eine zuvor selten gesehene, originelle Komponente verleiht.
Danach wandte er sich zwei bekannten Franchise-Universen zu, die bereits mehrfach als Setting für die frühen und nicht mehr ganz so frühen Gehversuche deutscher Autoren gedient haben (und immer noch dienen) – Das Schwarze Auge und BattleTech. Nach der Military SF im Rahmen des BattleTech-Universums (Karma (2007) und einem Zweiteiler um die Andurienkriege (2012)) verlegte Craw sich auf die Fantasy: Im DSA-Universum folgte auf die Romane Todesstille und Im Schatten der Dornrose (beide 2009) 2010 der vierteilige, aus den Bänden Stein, Erz, Eisen und Stahl bestehende Isenborn-Zyklus. Im darauffolgenden Jahr erschien mit Türme im Nebel der erste Teil des auf sechs Bände angelegten Zyklus Die Türme von Taladur, dessen Fortsetzungen jedoch nicht mehr von Craw verfasst, sondern nur noch koordiniert und redigiert wurden bzw. werden.
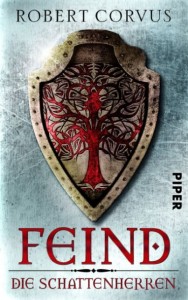 Was möglicherweise auch damit zu tun hat, dass sich Bernard Craw – jetzt allerdings unter dem neuen Pseudonym Robert Corvus – inzwischen mit dem Zyklus um Die Schattenherren einer eigenen Fantasywelt zugewandt hat. Der erste Band – Feind – soll im Januar 2013 erscheinen, und das, was bisher über Setting und Inhalt zu erfahren war, lässt einen Zyklus erwarten, in den hineinzuschauen sich vielleicht lohnen könnte, wenn man eher “klassische” Fantasy mag. Man darf zumindest gespannt sein (nicht zuletzt auch darauf, wie lange Craws Vorliebe für Einworttitel noch anhält). In diesem Sinne – herzlichen Glückwunsch, Bernard!
Was möglicherweise auch damit zu tun hat, dass sich Bernard Craw – jetzt allerdings unter dem neuen Pseudonym Robert Corvus – inzwischen mit dem Zyklus um Die Schattenherren einer eigenen Fantasywelt zugewandt hat. Der erste Band – Feind – soll im Januar 2013 erscheinen, und das, was bisher über Setting und Inhalt zu erfahren war, lässt einen Zyklus erwarten, in den hineinzuschauen sich vielleicht lohnen könnte, wenn man eher “klassische” Fantasy mag. Man darf zumindest gespannt sein (nicht zuletzt auch darauf, wie lange Craws Vorliebe für Einworttitel noch anhält). In diesem Sinne – herzlichen Glückwunsch, Bernard!
Bibliotheka Phantastika gratuliert Laura Resnick, die heute ihren 50. Geburtstag feiern kann. Die am 17. August 1962 in Chicago, Illinois, geborene Autorin, die die Tochter des SF-Autors Mike Resnick ist, begann ihre Karriere 1989 unter dem Pseudonym Laura Leone im Romance-Sektor. Für Fantasy-LeserInnen hochinteressant wird sie – abgesehen von ihren Kurzgeschichten, für die sie 1993 mit dem John W. Campbell Award ausgezeichnet wurde – mit In Legend Born (1998, dt. in zwei Teilen: Feuerbringer, Flammenherz (1998)), dem ersten Band der Sirkara Chronicles, einer dreibändigen Reihe um die Rebellion gegen das mächtige Valdani-Reich, die mit Wasser- und Feuermagie geführt wird, aber sich erst einmal mühselig aus den verfeindeten Volksgruppen und Fraktionen zusammenfinden muss. Die Sirkara Chronicles haben einen – für 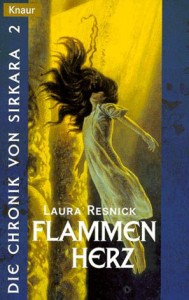 die damalige Zeit noch recht ungewöhnlichen – realistischen Ansatz, der durch das Abweichen von den bei Fantasy-Völkern verbreiteten kulturellen Klischees und der unaufgeregten, auf die Figuren und deren Entwicklung konzentrierten Erzählweise unterstrichen wird. Damit gewinnt Laura Resnick der klassischen Geschichte von Unterdrückung und Befreiung durch eine Erlöser-Figur neue Aspekte ab und liefert eine recht vielschichtige (auch aus mehreren Perspektiven erzählte) Variante.
die damalige Zeit noch recht ungewöhnlichen – realistischen Ansatz, der durch das Abweichen von den bei Fantasy-Völkern verbreiteten kulturellen Klischees und der unaufgeregten, auf die Figuren und deren Entwicklung konzentrierten Erzählweise unterstrichen wird. Damit gewinnt Laura Resnick der klassischen Geschichte von Unterdrückung und Befreiung durch eine Erlöser-Figur neue Aspekte ab und liefert eine recht vielschichtige (auch aus mehreren Perspektiven erzählte) Variante.
In Deutschland hatten Die Chroniken von Sirkara eine etwas unglückliche Veröffentlichungsgeschichte: Nachdem aus dem zweiten Original-Band zwei Bände wurden (In Fire Forged: The White Dragon, In Fire Forged: The Destroyer Goddess, beide 2003), die auch noch ungewöhnlich lange auf sich warten ließen, wurde die Reihe wie viele andere bei Droemer Knaur erschienene Fantasy-Zyklen eingestellt, so dass deutsche LeserInnen lediglich den (gesplitteten) ersten Band zu sehen bekamen.
Trotz ursprünglich weiterreichender Pläne für die Chronicles of Sirkara wandte sich Laura Resnick auch in den USA nach The Destroyer Goddess von der High Fantasy ab und begann mit Disappearing Nightly (2005) eine Urban-Fantasy-Reihe um die Schauspielerin Esther Diamond, die bis heute fortgesetzt wird und inzwischen auf fünf Bände angewachsen ist.
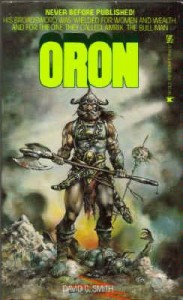 Bibliotheka Phantastika gratuliert David C. Smith, der heute 60 Jahre alt wird. Der am 10. August 1952 in Youngstown, Ohio, geborene David Claude Smith ist einer der Autoren, die – vergleichbar etwa mit seinem nur wenige Jahre älteren Kollegen Charles R. Saunders – im Kielwasser der durch die Conan-Ausgabe bei Lancer Books entfachten Begeisterung für Sword & Sorcery ihre ersten Stories um schwertschwingende, aber nicht zwangsläufig barbarische Helden in Amateur- und semiprofessionellen Magazinen veröffentlichten und schließlich zu ersten Romanveröffentlichungen kamen.
Bibliotheka Phantastika gratuliert David C. Smith, der heute 60 Jahre alt wird. Der am 10. August 1952 in Youngstown, Ohio, geborene David Claude Smith ist einer der Autoren, die – vergleichbar etwa mit seinem nur wenige Jahre älteren Kollegen Charles R. Saunders – im Kielwasser der durch die Conan-Ausgabe bei Lancer Books entfachten Begeisterung für Sword & Sorcery ihre ersten Stories um schwertschwingende, aber nicht zwangsläufig barbarische Helden in Amateur- und semiprofessionellen Magazinen veröffentlichten und schließlich zu ersten Romanveröffentlichungen kamen.
Wobei der erste Roman, der von Smith erschien, keine Sword & Sorcery war, sondern ein nur spärlich mit übernatürlichen Elementen versehenes Howard-Pastiche um den Piraten Black Vulmea (The Witch of the Indies, 1977), auf den ein Jahr später ein zweites, dieses Mal zusammen mit Richard L. Tierney verfasstes Howard-Pastiche folgte; in For the Witch of the Mists (1978; dt. Die Nebelhexe (1985)) steht allerdings mit Bran Mak Morn eine von Howards eindeutig der S&S zuzurechnenden Figuren im Mittelpunkt (und die Pastiches zählen beide zu den besseren Hervorbringungen ihrer Art).
Parallel dazu kamen auch die ersten Romane auf den Markt, in denen Smith sich seinen auf dem Inselkontinent Attluma (im Prinzip einer Atlantis-Version ohne High-Tech) agierenden eigenen Helden zuwenden konnte, die teilweise bereits in einigen seiner Kurzgeschichten aufgetreten waren. Oron (1978) bildet dabei den Auftakt zu einer vierbändigen Reihe – die Folgebände bzw. genauer gesagt Prequels sind Mosutha’s Magic, The Valley of Ogrum (beide 1982) und The Ghost Army (1983) – um den barbarischen Krieger Oron, der seinen Vater tötet, von seinem Stamm ausgestoßen wird und sich daraufhin seinen Lebensunterhalt als Söldner verdient. The Sorcerer’s Shadow (1978) spielt mehrere Jahrhunderte nach den Oron-Romanen ebenfalls auf Attluma, hat aber mit dem von einem Magier zur Unsterblichkeit verfluchten Krieger Akram eine anders geartete Hauptfigur, die eine gewisse Ähnlichkeit mit Karl Edward Wagners unsterblichem Helden Kane nicht ganz leugnen kann.
Von 1981 bis 1983 verfasste Smith – wieder in Zusammenarbeit mit Tierney – außerdem eine sechsteilige Reihe um die (in diesem Fall aus dem Mittelalter ins Hyborische Zeitalter versetzte) Howard-Heroine Red Sonja und schien sich als Autor etabliert zu haben. Doch da in den 80ern eine Art Wachablösung in der Fantasy stattfand und die Sword & Sorcery verglichen mit der High Fantasy tolkienesker Prägung endgültig ins Hintertreffen geriet, kam auch Smiths Autorenkarriere ins Stocken – und das, obwohl er auf Wunsch seines Verlags mit Fall of the First World eine aus den Einzelbänden The Master of Evil, Sorrowing Vengeance und The Passing of the Gods (alle 1983) bestehende Trilogie vorlegte, die sich deutlich an den komplexeren Epen etwa eines Stephen R. Donaldson orientierte und vom Autor selbst als Fantasy-Äquivalent von Krieg und Frieden gedacht war. Dem letztgenannten Anspruch kann Fall of the First World zwar sicher nicht gerecht werden, aber die Trilogie, die in einem vorgeschichtlichen Zeitalter spielt und deren archetypische Figuren ihren Nachhall in etlichen Personen unserer Legenden gefunden haben, ist deutlich origineller als viele der halbgaren Tolkien-Aufgüsse oder in Romanform nacherzählten Rollenspielrunden, die in den 80ern einen Großteil des Genres ausmachten.
1989 und 1991 veröffentlichte Smith noch zwei okkulte Horrorromane um den vom Priester zum Magier gewordenen David Trevisan (The Fair Rules of Evil und The Eyes of Night), doch seither ist er als Autor phantastischer Literatur verstummt. Smiths S&S-Romane oder auch seine epische Fantasy-Trilogie zählen gewiss nicht zu den Spitzenwerken des Genres, bieten aber den Freunden dieser Untergattung deutlich mehr als manch anderes Werk, das es zu einer deutschen Übersetzung gebracht hat.
Bibliotheka Phantastika gratuliert André Ruellan, der heute 90 Jahre alt wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass deutschsprachige Leser oder Leserinnen mit dem Namen des am 07. August 1922 in Courbevoie im Département Hauts-de-Seine geborenen Ruellan auf Anhieb etwas anfangen können, dürfte eher gering sein, denn hierzulande sind nur zwei SF-Romane aus seiner späteren Schreibperiode (in der er unter seinem eigenen Namen veröffentlicht hat) erschienen: Tunnel (1973) als Paris 2020 (1981; ein Near-Future-Roman, in dem ein junger Arzt seine komatöse, hochschwangere Frau ins Krankenhaus zu bringen versucht und dabei ein in jeder Hinsicht kaputtes, von Gewalt und Chaos beherrschtes Paris durchqueren muss) und Mémo (1984) als Memo (1987; ein Roman, in dem es um eine Substanz geht, die Erinnerungen – auch künstliche – derart intensiviert, dass sie sich praktisch nicht mehr von der erlebten Gegenwart unterscheiden).
Dabei war Ruellan, der Medizin studiert und auch einige Jahre als Arzt gearbeitet hat, vor allem zu Beginn seiner Schriftstellerkarriere recht fleißig und in den 50er und frühen 60er Jahren unter dem Pseudonym Kurt Steiner (gelegentlich auch Kurt Wargar) regelmäßig in Fleuve Noirs Genrereihen Angoisse (Horror bzw. Phantastik) und Anticipation (SF) vertreten. Und in der Reihe Anticipation sind auch die beiden Romane erschienen, denen Ruellan seinen heutigen Eintrag in unserem Blog verdankt.
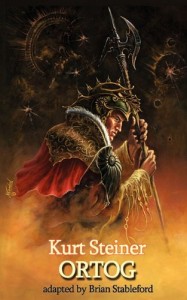 In Aux Armes d’Ortog (1960) lernen wir den Ritter-Navigator (oder Navigator-Ritter) Dal Ortog of Galankar kennen, der im 50. Jahrhundert auf einer Erde lebt, auf der High-Tech neben Magie existiert. Außerdem war sie kurz zuvor in einen verheerenden interplanetaren Krieg verwickelt, und die Bevölkerung siecht an einer unbekannten Krankheit dahin. Kein Wunder, dass Sopharch Karella seinen besten Mann losschickt, um ein Mittel gegen die Krankheit zu finden. Natürlich hat Ortog Erfolg – doch zu spät, denn seine große Liebe, Karellas Tochter Kalla, ist bereits tot. Und deshalb müssen sich Ortog und sein Freund Zoltan Charles Henderson de Nancy in Ortog et les Ténèbres (1969) in die Dimensionen des Todes aufmachen, um Kallas Seele zurückzuholen …
In Aux Armes d’Ortog (1960) lernen wir den Ritter-Navigator (oder Navigator-Ritter) Dal Ortog of Galankar kennen, der im 50. Jahrhundert auf einer Erde lebt, auf der High-Tech neben Magie existiert. Außerdem war sie kurz zuvor in einen verheerenden interplanetaren Krieg verwickelt, und die Bevölkerung siecht an einer unbekannten Krankheit dahin. Kein Wunder, dass Sopharch Karella seinen besten Mann losschickt, um ein Mittel gegen die Krankheit zu finden. Natürlich hat Ortog Erfolg – doch zu spät, denn seine große Liebe, Karellas Tochter Kalla, ist bereits tot. Und deshalb müssen sich Ortog und sein Freund Zoltan Charles Henderson de Nancy in Ortog et les Ténèbres (1969) in die Dimensionen des Todes aufmachen, um Kallas Seele zurückzuholen …
Das Ganze hat natürlich einen gewissen Trash-Faktor, vor allem im Vergleich zu den o.e., thematisch deutlich anspruchsvolleren SF-Romanen, doch das Setting – für das der britische SF-Kritiker John Clute den treffenden Begriff Medieval Futurism geprägt hat –, ein paar nette kleine Ideen und die Gelegenheit, einen Blick in nicht angloamerikanische Science Fantasy zu werfen, haben durchaus ihren Reiz. Letzteres ist tatsächlich auch Lesern und Leserinnen möglich, die kein Französisch können, denn die beiden recht dünnen Romane sind 2010 in der Übersetzung von Brian M. Stableford unter dem Titel Ortog als Sammelband in den USA erschienen. André Ruellan selbst hat sich seit Mitte der 90er Jahre aufs Drehbuchschreiben konzentriert, mit dem er bereits in den 70ern angefangen hatte, und war in diesem Bereich noch bis vor kurzem aktiv.
Bibliotheka Phantastika gratuliert Tobias O. Meißner, der heute 45 Jahre alt wird. Der am 04. August 1967 in Oberndorf am Neckar geborene Meißner ist einer der experimentierfreudigsten deutschen Fantasy-Autoren, der es mit seinem dem Spiel-Konzept verpflichteten Roman Das Paradies der Schwerter sogar geschafft hat, vom Feuilleton wahrgenommen zu werden, aber durchaus auch klassischere Fantasy-Stoffe und moderne Phantastik im Repertoire hat. Mehr erfahrt ihr in unserem ausführlichen Portrait – und alle Interessierten & Fans sollten außerdem in den nächsten Tagen auch in unserem Blog die Augen offenhalten …
Bibliotheka Phantastika erinnert an Rosemary Sutcliff, die heute vor 20 Jahren starb. Obwohl die 1920 in Surrey geborene Sutcliff schon sehr früh an Arthritis erkrankte und dadurch zeitlebens starken Beeinträchtigungen ausgesetzt war, entwickelt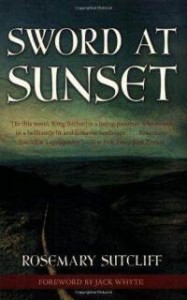 e sie sich zu einer ungeheuer produktiven Autorin vor allem historischer Romane, die überwiegend als Jugendbücher kategorisiert werden, aber dank der darin behandelten durchaus anspruchsvollen Themen und der genauen Recherche der geschichtlichen Hintergründe auch für erwachsene Leser reizvoll sind. Die größte Popularität genießen dabei wohl drei Bände ihrer Reihe um Angehörige der Familie Aquila im römischen Britannien, The Eagle of the Ninth (1954, dt. Der Adler der neunten Legion, 2011 unter demselben Titel mit abgewandelter Handlung verfilmt), The Silver Branch (1957, dt. Der silberne Zweig) und The Lantern Bearers (1959, dt. Die Fackelträger bzw. Drachenschiffe drohen am Horizont).
e sie sich zu einer ungeheuer produktiven Autorin vor allem historischer Romane, die überwiegend als Jugendbücher kategorisiert werden, aber dank der darin behandelten durchaus anspruchsvollen Themen und der genauen Recherche der geschichtlichen Hintergründe auch für erwachsene Leser reizvoll sind. Die größte Popularität genießen dabei wohl drei Bände ihrer Reihe um Angehörige der Familie Aquila im römischen Britannien, The Eagle of the Ninth (1954, dt. Der Adler der neunten Legion, 2011 unter demselben Titel mit abgewandelter Handlung verfilmt), The Silver Branch (1957, dt. Der silberne Zweig) und The Lantern Bearers (1959, dt. Die Fackelträger bzw. Drachenschiffe drohen am Horizont).
Doch Sutcliffs Romane stehen trotz ihrer festen Verwurzelung in tatsächlichen historischen Epochen in vielerlei Hinsicht der Fantasy näher, als man auf den ersten Blick vermuten könnte, und das nicht nur, weil sie durch ihre Schilderung fremdartiger, aber sehr authentisch und glaubwürdig erscheinender Lebenswelten etwas leisten, das man sich auch von guter Phantastik erhofft. So treten z.B. immer wieder Figuren auf, bei denen man zumindest vermuten kann, dass sie über magische oder hellseherische Fähigkeiten verfügen, wie etwa die eindrucksvoll geschilderte weise Frau Ancret in Knight’s Fee (1960, dt. Randal der Ritter). Darüber hinaus gewinnt man den Eindruck, dass bestimmte Deutungsmuster, die gerade in Sutcliffs Romanen zur Vor- und Frühgeschichte Großbritanniens immer wieder aufscheinen, stark der Mythenforschung des 19. und frühen 20. Jahrhunderts verpflichtet sind. Zu denken wäre hier etwa an James Frazers The Golden Bough. A Study in Magic and Religion (1890; dt. Der Goldene Zweig. Eine Studie über Magie und Religion), aus dem insbesondere das Motiv der sakral aufgeladenen (Selbst-)Opferung des Herrschers für das Gemeinwohl in Sutcliffs Geschichten eingeflossen sein könnte.
Auch vom Stoff her fantasynah sind schließlich Sutcliffs Sagennacherzählungen, von denen ihre mehrbändige Variante der Artussage, The Sword and the Circle (1981), The Light Beyond the Forest (1979) und The Road to Camlann (1981; auch als Sammelband The King Arthur Trilogy, dt. König Artus und die Abenteuer der Ritter von der Tafelrunde) am Bekanntesten sein dürfte. Mit dem charmanten Bilderbuch The Minstrel and the Dragon Pup (1993) liegt aus ihrer Feder auch noch eine echte Fantasygeschichte für Kinder vor.
Sutcliffs entscheidender Beitrag zum Genre kann jedoch in ihrer Gestaltung des Artusstoffs für erwachsene Leser, Sword at Sunset (1963, bisher keine deutsche Übersetzung), gesehen werden. Vordergründig handelt es sich auch bei der Geschichte des romano-britischen Kriegsherrn Artos, der als Ich-Erzähler im Angesicht des Todes auf sein Leben zurückblickt, um einen historischen Roman, der zudem als direkte Fortsetzung von The Lantern Bearers gelesen werden kann. Doch während die Artussage hier abseits jeder Tafelrundenromantik auf einen durchaus realistisch erscheinenden Kern um den Abwehrkampf der überwiegend keltisch und römisch geprägten Bevölkerung gegen die angelsächsischen Eroberer zurückgeführt wird, lässt Sutcliff zugleich mehrfach offen, ob nicht doch Übernatürliches im Spiel ist. Dem Leser steht es frei, selbst zu entscheiden, ob er die geschilderten Vorzeichen, Flüche und Prophezeiungen nur als Teil des Weltbilds einer spätantiken Gesellschaft sehen oder ihnen tatsächlich ein Eigenleben zubilligen möchte. Gesteigert wird das Verwirrspiel noch durch die Tatsache, dass der Ich-Erzähler durchaus reflektiert mit solchen Deutungen umzugehen weiß und spätestens im letzten Kapitel, das mit seinem Titel The Corn King die Mythen um Opferung und Wiederkehr des sakralen Königs evoziert, selbst gehörig dazu beiträgt, die eigene Legende erst zu schaffen.
Für alle Leser, die Freude daran haben, sich auch mit den der klassischen Fantasy benachbarten Gebieten zu befassen, hat Sutcliff also nach wie vor einiges zu bieten und sollte nicht in Vergessenheit geraten.
Bibliotheka Phantastika gratuliert Archie Weller, der heute 55 Jahre alt wird. Nachdem der erste, im Jahre 1981 veröffentlichte Roman The Day of the Dog des am 13. Juli 1957 in Subiaco im australischen Bundesstaat Westaustralien geborenen Archie Irving Kirkwood Weller noch autobiographische Bezüge aufwies und tief in die Lebenswelt der von ihrer ursprünglichen Lebensweise entfremdeten und an und in der Kultur des Weißen Mannes scheiternden Aborigines und Aborigine-Mischlinge eintauchte (und unter dem Titel Blackfellas auch verfilmt wurde), wandte er sich mit Land of the Golden Clouds (1998) einem postapokalyptischen Setting zu.
Schauplatz des unter dem Titel Der Mondredner (2000) auch auf Deutsch erschienenen Romans ist ein von den Verheerungen eines 3000 Jahre zurückliegenden Atomkriegs gezeichnetes Australien, in dem die wenigen Überlebenden 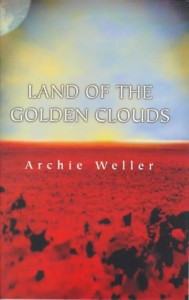 unterschiedliche Möglichkeiten gefunden haben, sich an die harten Lebensbedingungen anzupassen. Dabei leiden die an der Oberfläche lebenden, einander nicht unbedingt freundlich gesinnten Stämme, die sich in die wenigen nicht verstrahlten oder zur Wüste gewordenen Landstriche zurückgezogen haben, unter den nächtlichen Überfällen der unterirdisch lebenden, hellhäutigen und kannibalischen Nightstalkers. Und zwar so sehr, dass Red Mond Star Light, der Anführer des den Mond anbetenden kriegerischen Stammes der Ilkari, die Chance nutzt, die sich ihm durch die Begegnung mit der abtrünnigen Nightstalkerin S’shony bietet, und zusammen mit einer rasch wachsenden Schar von Gefährten aufbricht, den als King of the Bats bezeichneten Herrscher der Nightstalker zu töten.
unterschiedliche Möglichkeiten gefunden haben, sich an die harten Lebensbedingungen anzupassen. Dabei leiden die an der Oberfläche lebenden, einander nicht unbedingt freundlich gesinnten Stämme, die sich in die wenigen nicht verstrahlten oder zur Wüste gewordenen Landstriche zurückgezogen haben, unter den nächtlichen Überfällen der unterirdisch lebenden, hellhäutigen und kannibalischen Nightstalkers. Und zwar so sehr, dass Red Mond Star Light, der Anführer des den Mond anbetenden kriegerischen Stammes der Ilkari, die Chance nutzt, die sich ihm durch die Begegnung mit der abtrünnigen Nightstalkerin S’shony bietet, und zusammen mit einer rasch wachsenden Schar von Gefährten aufbricht, den als King of the Bats bezeichneten Herrscher der Nightstalker zu töten.
Auch wenn es zunächst so klingt, als wären Plot und Setting des Romans dem Handbuch für Genre-Autoren entnommen, besitzt Land of the Golden Clouds einen eigentümlichen Reiz – und geht letztlich über einen typischen Unterhaltungsroman deutlich hinaus. Denn die größte Aufgabe, die Red Mond Star Light und seine Mitstreiter und Mitstreiterinnen zu bewältigen haben, liegt nicht in der Durchquerung eines verwüsteten Kontinents oder der Vernichtung eines bösen, dunklen Herrschers, sondern darin, sich gegenseitig in ihrem Anderssein zu akzeptieren. Was in Anbetracht der sehr unterschiedlichen Gruppen, die sich nach und nach an der Queste beteiligen (darunter beispielsweise eine Gruppe Jamaikaner, die per Flugzeug gekommen sind – andernorts scheint der Atomkrieg nicht stattgefunden oder deutlich geringere Spuren zurückgelassen zu haben – und immer mal wieder Robert Nesta Marley zitieren, einen in ihrem Land hoch geachteteten Propheten; oder auch die Cricketeers), alles andere als leicht ist. Darüber hinaus ist auch eine über den zwischenmenschlichen Aspekt hinausgehende politische Lesart des Romans nicht nur möglich, sondern angesichts vieler Anspielungen auf die Gegenwart recht naheliegend (wobei manche dieser Anspielungen in Anbetracht der verstrichenen Zeitspanne schon etwas gezwungen wirken). Letztlich sollte man tatsächlich vor allem an solchen Themen und Fragestellungen oder Anspielungen Interesse haben, denn was vordergründige Spannung angeht, hat Land of the Golden Clouds deutlich weniger zu bieten als die meisten anderen Post-Doomsday-Romane, und zwar bis zum in dieser Hinsicht folgerichtig antiklimaktischen Ende.