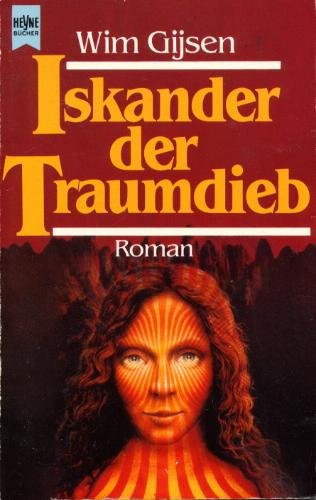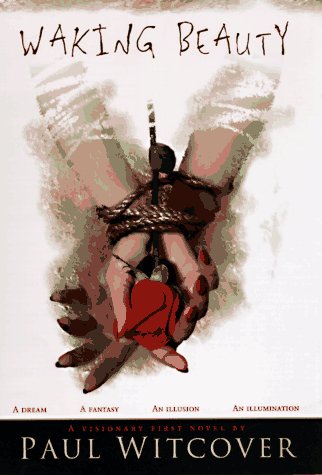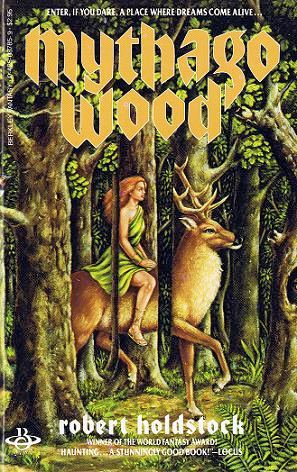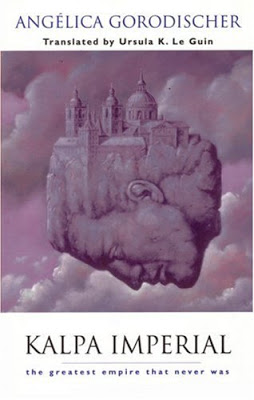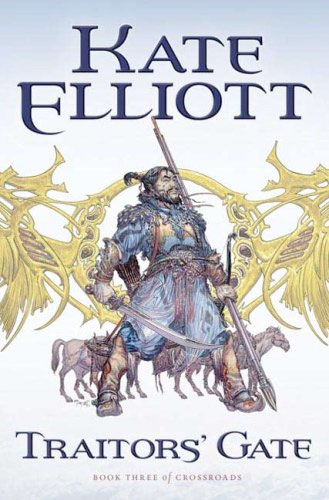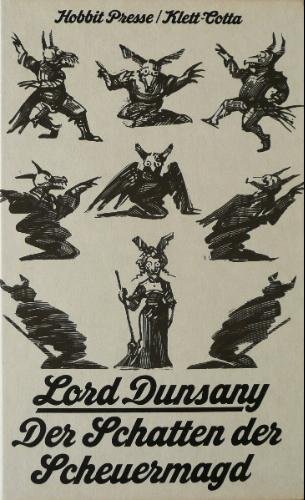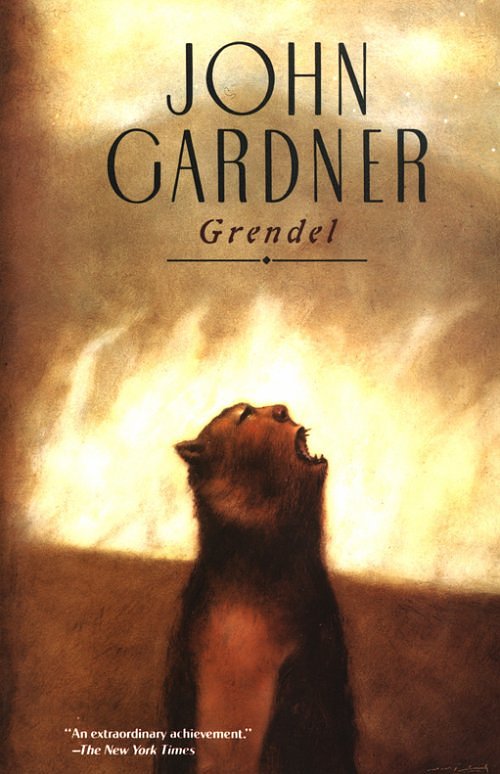Bibliotheka Phantastika erinnert an Wim Gijsen, der heute 80 Jahre alt geworden wäre. Der am 20. August 1933 in Zwolle in der Provinz Overijssel geborene Wim Gijsen wollte schon von Kindheit an Schriftsteller werden und hatte neben journalistischen Arbeiten u.a. bereits Kinder- und Sachbücher (über New-Age-Themen wie Meditation, Yoga oder das Leben nach dem Tod) veröffentlicht, ehe er sich Anfang der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts der SF und Fantasy zuwandte und rasch einer der bekanntesten niederländischen Autoren dieser Genres wurde bzw. in den 80ern vermutlich sogar der bekannteste und erfolgreichste war. Und er zählt zur kleinen Riege der Genre-Autoren seines Heimatlands, die es zu Übersetzungen ins Deutsche gebracht haben.
Gijsens Erstling innerhalb des Genres war De Eersten van Rissan (1980), der Auftakt eines Zweiteilers, der ein Jahr später mit De Koningen van Weleer abgeschlossen wurde. Rissan (unter diesem Titel auch als Sammelband (1987)) erzählt die Geschichte von Hirdan, dem Sohn eines einfachen Handwerkers, der in dem von einer diktatorischen Priesterkaste beherrschten Stadtstaat Lhissey durch besondere Umstände zum Priesterschüler wird, sich aber – angewidert vom Kastendenken und den Methoden der Priesterschaft – schon bald mit Rhes zusammentut, einem geheimnisvollen Fremden, der sich als Archäologe für den alten, pyramidenförmigen Großen Tempel von Lhissey interessiert. Viel mehr interessieren Rhes – der von der Erde stammt – allerdings Die Ersten von Rissan, die auch als Die Könige der Vorzeit (so die Titel der deutschen Ausgaben (beide 1987)) bekannt sind. Denn Rhes stammt von der Erde, und er hofft, auf dieser vergessenen und auf eine mittelalterliche Kulturstufe zurückgefallenen Kolonialwelt wichtige Hinweise auf eine vorher existierende nichtmenschliche Zivilisation zu entdecken. Bei der sich anschließenden gemeinsamen Reise durch die Welt lernen die beiden Land und Leute kennen, und Hirdan macht eine erstaunliche Entwicklung durch. Und am Ende wird natürlich auch das Rätsel der Ersten gelöst.
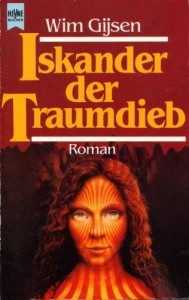 Während es sich beim Rissan-Zweiteiler noch um einen SF-Roman mit Fantasy-Elementen handelt – die vergessene Kolonie ist ja fast ein Standardmotiv der planetary romance – stehen beim Iskander-Zweiteiler eindeutig die Fantasy-Elemente im Vordergrund. In Iskander de Dromendief (1982; dt. Iskander der Traumdieb (1988)) machen wir mit dem nicht sonderlich begabten Magier Iskander Bekanntschaft, der zusammen mit seinem Freund und Diener Okke durch das Inselreich Albe zieht und sich mit einfachen Tricks seinen Lebensunterhalt verdient. Eine richtige Begabung hat Iskander allerdings: er kann in die Träume anderer Menschen eindringen und sie verändern. Und diese Begabung sorgt dann auch dafür, dass sein lockeres, leichtes Leben sich eines Tages schlagartig verändert. Denn Prinz Hamlet-Alexander, der Thronfolger von Albe, wird von Alpträumen geplagt, und die Hohepriesterin Merle bittet Iskander, sich der Träume des Prinzen einmal anzunehmen. Was der Magier tut – nur um sich in der Traumlandschaft Hamlet-Alexanders plötzlich dem Wolf gegenüberzusehen, einem mächtigen Magier, der das Inselreich Albe erobern will, und dem dazu nicht nur alle Mittel recht sind, sondern der auch über sie verfügt. Verglichen mit den Möglichkeiten und Fähigkeiten des Wolfs – der über einen ganzen Kontinent herrscht und bereits eine Flotte nach Vale, dem spirituellen Zentrum Albes ausgeschickt hat – ist Iskander kaum mehr als ein kleines Licht; doch zum einen verfügt er über durchaus mächtige Verbündete, zum anderen besitzt er sehr wohl etwas, das ihm in diesem Konflikt helfen kann, beispielsweise einen hellwachen Verstand. Den – und nicht nur den – braucht er allerdings auch dringend, wenn er sich in Het Huis van de Wolf (1983; dt. Das Haus des Wolfs (1988)) daran macht, auf dessen eigenem Territorium gegen den Wolf vorzugehen.
Während es sich beim Rissan-Zweiteiler noch um einen SF-Roman mit Fantasy-Elementen handelt – die vergessene Kolonie ist ja fast ein Standardmotiv der planetary romance – stehen beim Iskander-Zweiteiler eindeutig die Fantasy-Elemente im Vordergrund. In Iskander de Dromendief (1982; dt. Iskander der Traumdieb (1988)) machen wir mit dem nicht sonderlich begabten Magier Iskander Bekanntschaft, der zusammen mit seinem Freund und Diener Okke durch das Inselreich Albe zieht und sich mit einfachen Tricks seinen Lebensunterhalt verdient. Eine richtige Begabung hat Iskander allerdings: er kann in die Träume anderer Menschen eindringen und sie verändern. Und diese Begabung sorgt dann auch dafür, dass sein lockeres, leichtes Leben sich eines Tages schlagartig verändert. Denn Prinz Hamlet-Alexander, der Thronfolger von Albe, wird von Alpträumen geplagt, und die Hohepriesterin Merle bittet Iskander, sich der Träume des Prinzen einmal anzunehmen. Was der Magier tut – nur um sich in der Traumlandschaft Hamlet-Alexanders plötzlich dem Wolf gegenüberzusehen, einem mächtigen Magier, der das Inselreich Albe erobern will, und dem dazu nicht nur alle Mittel recht sind, sondern der auch über sie verfügt. Verglichen mit den Möglichkeiten und Fähigkeiten des Wolfs – der über einen ganzen Kontinent herrscht und bereits eine Flotte nach Vale, dem spirituellen Zentrum Albes ausgeschickt hat – ist Iskander kaum mehr als ein kleines Licht; doch zum einen verfügt er über durchaus mächtige Verbündete, zum anderen besitzt er sehr wohl etwas, das ihm in diesem Konflikt helfen kann, beispielsweise einen hellwachen Verstand. Den – und nicht nur den – braucht er allerdings auch dringend, wenn er sich in Het Huis van de Wolf (1983; dt. Das Haus des Wolfs (1988)) daran macht, auf dessen eigenem Territorium gegen den Wolf vorzugehen.
In der aus den Bänden Keerkringen, Bedahinne (beide 1985) und Lure (1986) bestehenden Deirdre-Trilogie erzählt Wim Gijsen die Geschichte der titelgebenden Heldin, die in einer mittelalterlichen, von Männern beherrschten Gesellschaft zunächst einmal auf der untersten sozialen Stufe ihrer Welt landet, als sie aufgrund eines harmlosen Vergehens von einer Priesterin zu einer Ausgestoßenen wird. Doch Deirdre weiß die Fähigkeiten, die sie ihrer Ausbildung im Kloster verdankt, zu nutzen und wird eine erfolgreiche Händlerin. Dem Aufstieg auf der sozialen Leiter folgt allerdings bald wieder ein tiefer Fall, da ihr Erfolg bei der männlichen Konkurrenz ebenso ungern gesehen wird wie ihre Weigerung, sich mit einem der Kaufleute zu vermählen. Doch auch ihre Zeit als Tempelprostituierte geht vorüber, als sie von der Äbtissin eines weit entfernten 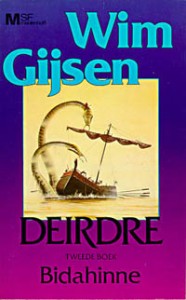 Wüstenklosters freigekauft wird. Die Reise über das Lavendelmeer und weiter durch die Wüste zum besagten Wüstenkloster bildet den Auftakt zu dem, was sich schließlich als Deirdres wahre Bestimmung erweisen wird: die zerstrittenen und miteinander tief verfeindeten Länder rings um das Lavendelmeer miteinander zu versöhnen.
Wüstenklosters freigekauft wird. Die Reise über das Lavendelmeer und weiter durch die Wüste zum besagten Wüstenkloster bildet den Auftakt zu dem, was sich schließlich als Deirdres wahre Bestimmung erweisen wird: die zerstrittenen und miteinander tief verfeindeten Länder rings um das Lavendelmeer miteinander zu versöhnen.
In der Deirdre-Trilogie – auf Deutsch als Wendekreise, Die Sandrose und Im Reich der Zauberinnen (alle 1999) erschienen – entwirft Wim Gijsen eine nicht unbedingt originelle, aber glaubwürdig geschilderte Welt, in deren Mittelpunkt er mit Deirdre eine – in Anbetracht des Erscheinungstermins der Originalausgabe – erstaunlich selbstbewusste und starke Frau stellt, die nicht all ihre Fähigkeiten verliert, wenn ein gutaussehender Mann auftaucht, sondern sich im Gegenteil eine gleichgeschlechtliche Liebesbeziehung gönnt. Dass er darüber hinaus den Rahmen einer Fantasy-Trilogie nutzt, um Kritik an so manchen zeitgenössischen Entwicklungen zu üben, ohne dass diese Kritik aufgesetzt wirkt oder mit der eigentlichen Handlung kollidiert, ist ein weiterer Pluspunkt.
Es ist bedauerlich, dass die weiteren Werke Gijsens – v.a. die beiden Einzelromane De Rook van duizend Vuren (1984) und De Droemenwever (1988) und die aus den Bänden Een Kring van Steenen (1989), Het groene Eiland (1990) und De Ceders van Urtan (1991) bestehende Merisse-Trilogie – nicht mehr ins Deutsche übersetzt wurden. Noch weitaus bedauerlicher ist allerdings, dass Wim Gijsen bereits am 20. Oktober 1990 im Alter von gerade einmal 57 Jahren verstorben ist (den letzten Band der Merisse-Trilogie musste sein Kollege Peter Schaap beenden), denn seine auf Deutsch vorliegenden Romane zeigen ihn als einen Autor, der sich inhaltlich und stilistisch deutlich vom Gros der angloamerikanischen Fantayliteratur unterscheidet – und Vielfalt ist etwas, das man eigentlich immer und in jedem Genre brauchen kann.
Category: Reaktionen
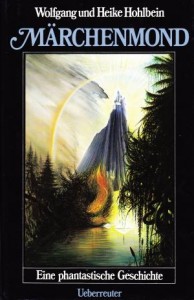 Bibliotheka Phantastika gratuliert Wolfgang Hohlbein, der heute 60 Jahre alt wird. Sein Durchbruch als Autor gelang ihm mit dem Jugendbuch Märchenmond, das er gemeinsam mit seiner Frau Heike verfasste. Seither veröffentlichte er regelmäßig mehrere Bücher im Jahr und zählt zu den meistgelesenen deutschen Fantasy-Autoren. Dabei umfasst sein Oeuvre keineswegs nur das Fantasy-Genre, sondern ebenso Science Fiction, Horror, historische Romane und Verschwörungsthriller, wobei sich in seinen Büchern gerne Elemente der verschiedenen Sparten der Phantastik vermengen, wie schon eines seiner frühen, großen Werke, die Enwor-Saga zeigt, in der sich Sword & Sorcery und Science Fiction verbinden.
Bibliotheka Phantastika gratuliert Wolfgang Hohlbein, der heute 60 Jahre alt wird. Sein Durchbruch als Autor gelang ihm mit dem Jugendbuch Märchenmond, das er gemeinsam mit seiner Frau Heike verfasste. Seither veröffentlichte er regelmäßig mehrere Bücher im Jahr und zählt zu den meistgelesenen deutschen Fantasy-Autoren. Dabei umfasst sein Oeuvre keineswegs nur das Fantasy-Genre, sondern ebenso Science Fiction, Horror, historische Romane und Verschwörungsthriller, wobei sich in seinen Büchern gerne Elemente der verschiedenen Sparten der Phantastik vermengen, wie schon eines seiner frühen, großen Werke, die Enwor-Saga zeigt, in der sich Sword & Sorcery und Science Fiction verbinden.
Mit seinem vielfältigen Werk stellte und stellt Wolfgang Hohlbein einen wichtigen Einstiegspunkt in die Phantastik dar, für junge LeserInnen ebenso wie für ältere Neueinsteiger.
Einen ausführlicheren Überblick über Wolfgag Hohlbeins Leben und Werk geben wir im entsprechenden Portrait, das wir aus diesem Anlass überarbeitet und aktualisiert haben.
Bibliotheka Phantastika gratuliert (aus technischen Gründen leicht verspätet) Paul Witcover, der heute 55 Jahre alt wird. Der nun schon seit etlichen Jahren in New York City lebende Paul Witcover wurde am 09. August 1958 in Zürich geboren und ist in den Randbezirken von Washington, D.C. aufgewachsen. Seine Schriftsteller-Karriere begann 1984 mit der Veröffentlichung der Erzählung “Red Shift” (als Judith Lessing) in der Januarausgabe von Isaac Asimov’s Science Fiction Magazine. Einige weitere Geschichten folgten ungefähr im Jahresabstand in Magazinen wie Night Cry oder Rod Serling’s The Twilight Zone Magazine, und mit “Jangletown” (in The Further Adventures of Batman (1990)) und “Lucifer over Lancaster” (in The Further Adventures of Superman (1993)) unternahm er zusammen mit Elizabeth Hand erste schriftstellerische Abstecher ins DC-Superheldenuniversum. Dort war auch die 16-teilige Comicserie Anima angesiedelt, die er ab Dezember 1993 – wieder zusammen mit Elizabeth Hand – getextet hat.
 Nach dem – wie immer in solchen Fällen auf mangelnde Verkaufszahlen zurückzuführenden – Ende von Anima blieb es einige Jahre ruhig um Witcover, bis er 1997 mit seinem ersten Roman auf die literarische Bühne zurückkehrte. Und diese Rückkehr hatte es in sich, denn Waking Beauty ist einer der ungewöhnlichsten und verstörendsten Fantasyromane der letzten zwanzig Jahre. In der einem Kastensystem nicht unähnlichen Welt des Hierarchats lockt ein nachts aus dem Wald aufsteigender Duft die Männer – die diesen Duft im Gegensatz zu ihren Frauen nicht nur wahrnehmen, sondern sich auch seiner Anziehungskraft nicht widersetzen können – aus ihren Häusern und weg von ihren Familien. Es sei denn, ihre Frauen oder Mütter oder Töchter binden sie auf ihren Betten fest und verschließen ihnen die Nasenlöcher. Atmen können sie schließlich zur Not auch durch einen Atemschlauch, der ihnen durch einen während ihres Mannbarkeitsrituals erfolgten rituellen Luftröhrenschnitt direkt in die Luftröhre eingeführt werden kann. Natürlich müssen die Frauen trotzdem die ganze Nacht wach und wachsam bleiben – und das sollten sie auch, denn eine Frau, die ihren Mann, ihren Sohn oder ihren Vater an den nur als “Beauty” bezeichneten Duft verliert, macht sich des schlimmsten Verbrechens schuldig. Zur Strafe wird sie ihren Namen und ihre Haare los und als “Cat” – als Prostituierte – an eines der in der zwar überaus religiösen, aber gleichzeitig auch dekadenten Gesellschaft wohlgelittenen offiziellen Bordelle verkauft. Genau das passiert Rose Rubra, die ihren frisch angetrauten Ehemann in der Hochzeitsnacht an Beauty verliert, und deren Leben dadurch schlagartig auf den Kopf gestellt wird. Aber die neue Cat ist nur eine der Figuren, durch deren Augen die Leser und Leserinnen die Welt des Hierarchats und ihre ebenso faszinierenden wie erschreckenden Geheimnisse – zu denen natürlich auch das der erwachenden Beauty zählt – nach und nach entdecken. Stilistisch anspruchsvoll im Präsens erzählt, gewinnt Waking Beauty an vielen Stellen die Qualität eines surrealen Traums, der nur allzuschnell zu einem Alptraum wird.
Nach dem – wie immer in solchen Fällen auf mangelnde Verkaufszahlen zurückzuführenden – Ende von Anima blieb es einige Jahre ruhig um Witcover, bis er 1997 mit seinem ersten Roman auf die literarische Bühne zurückkehrte. Und diese Rückkehr hatte es in sich, denn Waking Beauty ist einer der ungewöhnlichsten und verstörendsten Fantasyromane der letzten zwanzig Jahre. In der einem Kastensystem nicht unähnlichen Welt des Hierarchats lockt ein nachts aus dem Wald aufsteigender Duft die Männer – die diesen Duft im Gegensatz zu ihren Frauen nicht nur wahrnehmen, sondern sich auch seiner Anziehungskraft nicht widersetzen können – aus ihren Häusern und weg von ihren Familien. Es sei denn, ihre Frauen oder Mütter oder Töchter binden sie auf ihren Betten fest und verschließen ihnen die Nasenlöcher. Atmen können sie schließlich zur Not auch durch einen Atemschlauch, der ihnen durch einen während ihres Mannbarkeitsrituals erfolgten rituellen Luftröhrenschnitt direkt in die Luftröhre eingeführt werden kann. Natürlich müssen die Frauen trotzdem die ganze Nacht wach und wachsam bleiben – und das sollten sie auch, denn eine Frau, die ihren Mann, ihren Sohn oder ihren Vater an den nur als “Beauty” bezeichneten Duft verliert, macht sich des schlimmsten Verbrechens schuldig. Zur Strafe wird sie ihren Namen und ihre Haare los und als “Cat” – als Prostituierte – an eines der in der zwar überaus religiösen, aber gleichzeitig auch dekadenten Gesellschaft wohlgelittenen offiziellen Bordelle verkauft. Genau das passiert Rose Rubra, die ihren frisch angetrauten Ehemann in der Hochzeitsnacht an Beauty verliert, und deren Leben dadurch schlagartig auf den Kopf gestellt wird. Aber die neue Cat ist nur eine der Figuren, durch deren Augen die Leser und Leserinnen die Welt des Hierarchats und ihre ebenso faszinierenden wie erschreckenden Geheimnisse – zu denen natürlich auch das der erwachenden Beauty zählt – nach und nach entdecken. Stilistisch anspruchsvoll im Präsens erzählt, gewinnt Waking Beauty an vielen Stellen die Qualität eines surrealen Traums, der nur allzuschnell zu einem Alptraum wird.
Es dauerte acht Jahre, bis mit Tumbling After (2005) Witcovers zweiter Roman auf den Markt kam, ein SF-Roman, dessen einer Handlungsstrang – in dem ein Rollenspiel mit einem postapokalyptischen Szenario eine wichtige Rolle spielt – 1977 angesiedelt ist, während im zweiten genau dieses Szenario das Setting bildet. Schon ein Jahr später erschien mit Dracula: Asylum die “offizielle” Fortsetzung von Tod Brownings Dracula aus dem Jahre 1931.
2009 kam schließlich der Sammelband Everland and other Stories heraus, der einige der nach Meinung des Autors besten frühen und ein halbes Dutzend neue bzw. bislang unveröffentlichte Geschichten enthält. Und vor kurzen ist mit The Emperor of all Things (2013) der erste Teil des während des Siebenjährigen Kriegs spielenden Zweiteilers The Productions of Time erschienen, in dem u.a. die im 17. Jahrhundert gegründete Worshipful Company of Clockmakers und eine ganz besondere Uhr eine wichtige Rolle spielen; das klingt zumindest nach einem mit originellen Fantasyelementen ausgestatteten historischen Roman.
Paul Witcover gehört zu einer kleinen Gruppe von Autoren und Autorinnen, die sich mit ihren Romanen und Erzählungen an den Rändern oder auch in den Grauzonen der verschiedenen Subgenres der phantastischen Literatur tummeln. Was sie dort zu Tage fördern, ist nicht immer angenehm – aber zumindest im Fall von Waking Beauty von schrecklich schöner, alptraumhaft morbider Eleganz.
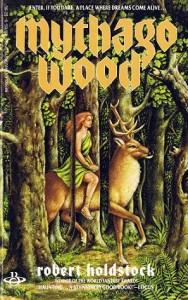 Bibliotheka Phantastika erinnert an Robert Holdstock, der heute 65 Jahre alt geworden wäre. Der am 2. August 1948 in Hythe geborene Brite war bekannt als Autor fantastischer Literatur und mythisch angereicherter Science-Fiction. Seinen Durchbruch als Autor erlebte er 1984 mit seiner Buchreihe Ryhope Wood, zu seinem Repertoire zählten aber auch zahlreiche Kurzgeschichten und die Hintergrundgeschichte zum Computerspiel Elite. Regelmäßige Besucher unseres Forums werden ihn vielleicht auch als Autor von Raven, Swordmisstress of Chaos (1978) (dt. Raven, die Schwertmeisterin) kennen. Hier schrieb er jedoch unter dem Pseudonym Richard Kirk.
Bibliotheka Phantastika erinnert an Robert Holdstock, der heute 65 Jahre alt geworden wäre. Der am 2. August 1948 in Hythe geborene Brite war bekannt als Autor fantastischer Literatur und mythisch angereicherter Science-Fiction. Seinen Durchbruch als Autor erlebte er 1984 mit seiner Buchreihe Ryhope Wood, zu seinem Repertoire zählten aber auch zahlreiche Kurzgeschichten und die Hintergrundgeschichte zum Computerspiel Elite. Regelmäßige Besucher unseres Forums werden ihn vielleicht auch als Autor von Raven, Swordmisstress of Chaos (1978) (dt. Raven, die Schwertmeisterin) kennen. Hier schrieb er jedoch unter dem Pseudonym Richard Kirk.
Robert Holdstock war ein Autor mit vielen Namen – nach seinem Durchbruch begann er gleich unter mehreren Pseudonymen zu schreiben, manche davon in Kooperation mit einem zweiten Autor. Da es kaum möglich ist, die Vielzahl an Werken Robert Holdstocks und seiner Pseudonyme im Rahmen eines Jubiläumstextes zusammen zu bringen, haben wir ihm anlässlich seines Geburtstags ein Portrait erstellt und laden euch ein, mehr über diesen Autor zu erfahren, der wegen seines Umgangs mit Mythen und phantastischen Elementen schon in einem Atemzug mit Ursula K. LeGuin, John Crowley und Marion Zimmer Bradley genannt wurde.
Bibliotheka Phantastika gratuliert Angélica Gorodischer, die heute 85 Jahre alt wird. Die am 28. Juli 1928 in Buenos Aires geborene Angélica Gorodischer, die im Alter von acht Jahren nach Rosario in der zentralargentinischen Provinz Santa Fe gezogen ist und seither dort lebt, hat sich in ihrem Heimatland und weit über dessen Grenzen hinaus mit Krimis und in den verschiedenen Subgenres der phantastischen Literatur angesiedelten Erzählungen und Romanen einen Namen gemacht und gilt heute im Bereich dieser Genres als eine der wichtigsten lateinamerikanischen Schriftstellerinnen. Darüber hinaus hat sie mehr als 350 Vorträge – vor allem über phantastische Literatur und das Schreiben von Frauen – im In- und Ausland gehalten und 1998, 2000 und 2002 in ihrer Heimatstadt Rosario drei bedeutende Kongresse über das literarische Schaffen argentinischer Schriftstellerinnen organisiert.
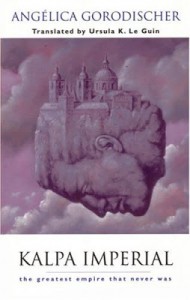 Als ihr wichtigstes Werk im Bereich der Fantasy gilt Kalpa imperial, eine Sammlung von Erzählungen, die zunächst in zwei Bänden – Libro I: La casa del Poder (1983) und Libro II: El imperio más vasto (1984) – in Argentinien erschienen ist, kurz darauf aber auch in einem Band (als Kalpa imperial (1984)) in Spanien veröffentlicht und seither mehrfach neu aufgelegt wurde. Interessanterweise taucht Kalpa imperial in Angélica Gorodischers Bibliographie häufig als Roman auf, doch der Inhalt besteht aus elf nur durch den Hintergrund und die Stimme des Erzählers zusammengehaltenen Stories, die verschiedene Episoden aus der Geschichte des besagten Imperiums bzw. Reiches erzählen und sich häufig um dessen mal gute, mal schlechte, mal schlicht verrückte Herrscher und Herrscherinnen drehen. Da geht es um Reichsgründer und Usurpatoren, um Kronprinzen, die sich entscheiden müssen, um Generäle und Deserteure, für die das ebenfalls gilt, und manchmal auch um Städte und Karawanen. Außerdem spielt der Erzähler selbst gelegentlich eine wichtige Rolle. Manche dieser Geschichten sind ziemlich witzig, manche tragisch und manche auch brutal, und viele transportieren eine leise, unaufdringlich vermittelte Botschaft. Magie hingegen gibt es kaum. Was das angeht, bewegt sich Kalpa imperial eher in der Tradition des Magischen Realismus. Und all das zusammen ergibt eine Mischung, die über einen schwer zu beschreibenden Reiz verfügt.
Als ihr wichtigstes Werk im Bereich der Fantasy gilt Kalpa imperial, eine Sammlung von Erzählungen, die zunächst in zwei Bänden – Libro I: La casa del Poder (1983) und Libro II: El imperio más vasto (1984) – in Argentinien erschienen ist, kurz darauf aber auch in einem Band (als Kalpa imperial (1984)) in Spanien veröffentlicht und seither mehrfach neu aufgelegt wurde. Interessanterweise taucht Kalpa imperial in Angélica Gorodischers Bibliographie häufig als Roman auf, doch der Inhalt besteht aus elf nur durch den Hintergrund und die Stimme des Erzählers zusammengehaltenen Stories, die verschiedene Episoden aus der Geschichte des besagten Imperiums bzw. Reiches erzählen und sich häufig um dessen mal gute, mal schlechte, mal schlicht verrückte Herrscher und Herrscherinnen drehen. Da geht es um Reichsgründer und Usurpatoren, um Kronprinzen, die sich entscheiden müssen, um Generäle und Deserteure, für die das ebenfalls gilt, und manchmal auch um Städte und Karawanen. Außerdem spielt der Erzähler selbst gelegentlich eine wichtige Rolle. Manche dieser Geschichten sind ziemlich witzig, manche tragisch und manche auch brutal, und viele transportieren eine leise, unaufdringlich vermittelte Botschaft. Magie hingegen gibt es kaum. Was das angeht, bewegt sich Kalpa imperial eher in der Tradition des Magischen Realismus. Und all das zusammen ergibt eine Mischung, die über einen schwer zu beschreibenden Reiz verfügt.
Ein anderes, ebenfalls häufig gelobtes Werk Angélica Gorodischers ist Trafalgar (1979), ein Sammelband mit SF-Erzählungen.
Für deutschsprachige Leser und Leserinnen war und ist es allerdings nicht einfach, sich einen Einblick in das Oeuvre dieser Autorin zu verschaffen. Viele Jahre lang gab es von ihr auf Deutsch nur einen einen einzigen Roman – einen Krimi mit dem Titel Eine Vase aus Alabaster (1992; Originaltitel: Floreros de alabastro, alfombras de Bokhara (1985)) –, und erst 2010 ist mit Im Schatten des Jaguars ein Sammelband mit phantastischen Erzählungen hinzugekommen.
Die englischsprachige Welt ist da ein bisschen besser dran, denn dort ist Kalpa imperial – übersetzt von niemand Geringerem als Ursula K. Le Guin – im Jahr 2003 als Kalpa Imperial: The Greatest Empire That Never Was auf den Markt gekommen. Es ist kaum anzunehmen, dass Angélica Gorodischer auch ohne diese Veröffentlichung 2011 mit dem World Fantasy Award für ihr Lebenswerk ausgezeichnet worden wäre. Vor wenigen Wochen ist zudem eine Übersetzung von Trafalgar, des bereits erwähnten Sammelbands mit SF-Erzählungen unter eben diesem Titel in den USA erschienen. Es wäre zu hoffen, dass die englischsprachigen Verlage noch weitere Titel von Angélica Gorodischer veröffentlichen, denn dann hätten die nicht-spanischsprachigen Leser und Leserinnen eine Option mehr, um zumindest Teile des Werks dieser in der spanischsprachigen Welt so bedeutenden und angesehenen Autorin kennenzulernen.
Bibliotheka Phantastika gratuliert Kate Elliott, die heute 55 Jahre alt wird. Wobei es sich bei Kate Elliott um ein (offenes) Pseudonym handelt, das die am 27. Juli 1958 in Des Moines, Iowa, geborene Alis A. Rasmussen seit 1992 für alle ihre Romane und Erzählungen benutzt. Begonnen hat sie ihre schriftstellerische Karriere unter ihrem richtigen Namen, unter dem The Labyrinth Gate (1988) – ein Fantasyroman um eine Alternativwelt mit matrilinearer Herrschaftsstruktur – und The Highroad Trilogy (1990) – eine Space Opera über eine junge Heldin und ihren überaus musikalischen robotischen Begleiter – erschienen sind. Doch aus vielerlei Gründen wollte sie einen Neuanfang, daher kamen die Novels of Jaran (1992-94) nicht nur bei einem anderen Verlag, sondern auch unter einem neuen Namen heraus. Und bei diesem Namen ist es bis heute geblieben.
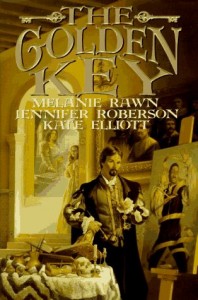 Nach den vier Novels of Jaran – in denen es um den Kontakt zwischen Erdenmenschen und dem nomadischen Volk der Jaran bzw. die sich daraus ergebenden Verwicklungen geht – schrieb Kate Elliott zusammen mit ihren Freundinnen und Kolleginnen Melanie Rawn und Jennifer Roberson (die damals wesentlich bekannter als sie selbst waren) The Golden Key (1996), einen ambitionierten Fantasyroman, der in den leicht verfremdeten, aber dennoch erkennbaren Ländern (v.a. Spanien, Frankreich und den nordafrikanischen Mittelmeerstaaten) einer Alternativwelt spielt. Im Mittelpunkt von The Golden Key steht die Malerfamilie der Grijalvas, deren männliche Nachkommen über die besondere Begabung verfügen, mit ihren Bildern die Welt um sich herum beeinflussen und verändern zu können. Seit Generationen nutzen die Grijalvas ihre Fähigkeiten, um Einfluss auf die Herrscherfamilie und die Politik ihres Heimatlandes zu nehmen, doch auch sie können die tiefgreifenden gesellschaftlichen Veränderungen, die sich ringsum auf der Welt anbahnen, nicht dauerhaft verhindern. Hier in Deutschland ist dieser durchaus gelungene Roman in drei Teilen erschienen, so dass Leser oder Leserinnen, die nur an den Arbeiten von einer oder zwei der drei beteiligten Autorinnen interessiert sind, sich entsprechend für Das Bildnis der Unsterblichkeit (Roberson), Die Farben der Unendlichkeit (Rawn, beide 1997) oder Zeit der Wiederkunft (Elliott, 1998) entscheiden können (auch wenn das – auf die gesamte Geschichte bezogen – natürlich wenig sinnvoll sein dürfte).
Nach den vier Novels of Jaran – in denen es um den Kontakt zwischen Erdenmenschen und dem nomadischen Volk der Jaran bzw. die sich daraus ergebenden Verwicklungen geht – schrieb Kate Elliott zusammen mit ihren Freundinnen und Kolleginnen Melanie Rawn und Jennifer Roberson (die damals wesentlich bekannter als sie selbst waren) The Golden Key (1996), einen ambitionierten Fantasyroman, der in den leicht verfremdeten, aber dennoch erkennbaren Ländern (v.a. Spanien, Frankreich und den nordafrikanischen Mittelmeerstaaten) einer Alternativwelt spielt. Im Mittelpunkt von The Golden Key steht die Malerfamilie der Grijalvas, deren männliche Nachkommen über die besondere Begabung verfügen, mit ihren Bildern die Welt um sich herum beeinflussen und verändern zu können. Seit Generationen nutzen die Grijalvas ihre Fähigkeiten, um Einfluss auf die Herrscherfamilie und die Politik ihres Heimatlandes zu nehmen, doch auch sie können die tiefgreifenden gesellschaftlichen Veränderungen, die sich ringsum auf der Welt anbahnen, nicht dauerhaft verhindern. Hier in Deutschland ist dieser durchaus gelungene Roman in drei Teilen erschienen, so dass Leser oder Leserinnen, die nur an den Arbeiten von einer oder zwei der drei beteiligten Autorinnen interessiert sind, sich entsprechend für Das Bildnis der Unsterblichkeit (Roberson), Die Farben der Unendlichkeit (Rawn, beide 1997) oder Zeit der Wiederkunft (Elliott, 1998) entscheiden können (auch wenn das – auf die gesamte Geschichte bezogen – natürlich wenig sinnvoll sein dürfte).
1997 erschien dann mit King’s Dragon der Auftaktroman von Crown of Stars, einem insgesamt siebenteiligen Zyklus, der sich nahtlos in die Reihe der großen, vielbändigen Fantasy-Epen einreiht und so manche von ihnen in mehrfacher 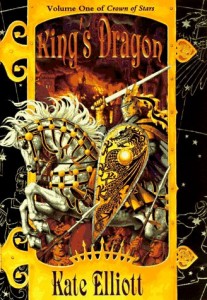 Hinsicht übertrifft. In King’s Dragon beginnt die Geschichte der beiden Hauptfiguren Liath – oder Liathano – und Alain, die anfangs den Geschehnissen, die sich jeweils rings um sie herum entwickeln, hilflos ausgeliefert erscheinen, die aber im Verlauf der weiteren Bände Prince of Dogs (1998), The Burning Stone (1999), Child of Flame (2000), The Gathering Storm (2003), In the Ruins (2005) und Crown of Stars (2006) mehr und mehr ihre Bestimmung erkennen und ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen. Das Setting ist ein Alternativwelt-Europa etwa zur Zeit der Ottonen, und eine der Stärken des Zyklus liegt in der für Fantasy-Verhältnisse relativ authentischen Darstellung einer frühmittelalterlichen Gesellschaft mit ihrem Reisekönigtum, den in immerwährende Machtkämpfe verstrickten Adelsfamilien oder den Verflechtungen zwischen weltlicher und kirchlicher Macht, aber auch dem Weltbild der in einer solchen Epoche lebenden Menschen. Hinzu kommen fantasyspezifische Komponenten wie die (durch eine erkennbar ans Christentum angelehnte, sich in einem Punkt aber von ihm wesentlich unterscheidende Religion begründete) deutlich aufgewertete Stellung der Frau, die nur noch aus Legenden bekannten, aber ein wichtiges Plotelement bildenden Lost Ones oder Aoi, die aus dem Land der Greife stammenden Qumaner – und nicht zu vergessen die Aika (bzw. Eikha). Und natürlich gibt es auch Magie. Das Worldbuilding, der sich erst allmählich entfaltende, gelegentlich mit überraschenden Wendungen aufwartende Plot – der ebenso von sehr irdischen Intrigen wie magischen Ereignissen getragen wird – und last but not least die überzeugend gezeichneten und vor allem glaubhaft agierenden Figuren – neben den bereits erwähnten Liath und Alain gibt es noch ein gutes Dutzend weiterer wichtiger Figuren und eine große Zahl von Komparsen – machen Crown of Stars zu einem der besten mehrbändigen Fantasyzyklen der letzten zwanzig Jahre. Von daher ist es bedauerlich, dass der Sternenkrone in ihrer zwölfteiligen (die ersten fünf Originalbände wurden gesplittet) deutschsprachigen Inkarnation – Erben der Nacht (1998), Im Namen des Königs, Auf den Flügeln des Sturms, Die Kathedrale der Hoffnung (alle 1999), Der brennende Stein, Das Rad des Schicksals (beide 2000), Kind des Feuers, Schatten des Gestern (beide 2001), Ins Land der Greife (2005), Die magischen Tore (2006), Das verwüstete Land (2007) und Die letzte Schlacht (2008) – nicht annähernd der Erfolg beschieden war, den sie verdient gehabt hätte.
Hinsicht übertrifft. In King’s Dragon beginnt die Geschichte der beiden Hauptfiguren Liath – oder Liathano – und Alain, die anfangs den Geschehnissen, die sich jeweils rings um sie herum entwickeln, hilflos ausgeliefert erscheinen, die aber im Verlauf der weiteren Bände Prince of Dogs (1998), The Burning Stone (1999), Child of Flame (2000), The Gathering Storm (2003), In the Ruins (2005) und Crown of Stars (2006) mehr und mehr ihre Bestimmung erkennen und ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen. Das Setting ist ein Alternativwelt-Europa etwa zur Zeit der Ottonen, und eine der Stärken des Zyklus liegt in der für Fantasy-Verhältnisse relativ authentischen Darstellung einer frühmittelalterlichen Gesellschaft mit ihrem Reisekönigtum, den in immerwährende Machtkämpfe verstrickten Adelsfamilien oder den Verflechtungen zwischen weltlicher und kirchlicher Macht, aber auch dem Weltbild der in einer solchen Epoche lebenden Menschen. Hinzu kommen fantasyspezifische Komponenten wie die (durch eine erkennbar ans Christentum angelehnte, sich in einem Punkt aber von ihm wesentlich unterscheidende Religion begründete) deutlich aufgewertete Stellung der Frau, die nur noch aus Legenden bekannten, aber ein wichtiges Plotelement bildenden Lost Ones oder Aoi, die aus dem Land der Greife stammenden Qumaner – und nicht zu vergessen die Aika (bzw. Eikha). Und natürlich gibt es auch Magie. Das Worldbuilding, der sich erst allmählich entfaltende, gelegentlich mit überraschenden Wendungen aufwartende Plot – der ebenso von sehr irdischen Intrigen wie magischen Ereignissen getragen wird – und last but not least die überzeugend gezeichneten und vor allem glaubhaft agierenden Figuren – neben den bereits erwähnten Liath und Alain gibt es noch ein gutes Dutzend weiterer wichtiger Figuren und eine große Zahl von Komparsen – machen Crown of Stars zu einem der besten mehrbändigen Fantasyzyklen der letzten zwanzig Jahre. Von daher ist es bedauerlich, dass der Sternenkrone in ihrer zwölfteiligen (die ersten fünf Originalbände wurden gesplittet) deutschsprachigen Inkarnation – Erben der Nacht (1998), Im Namen des Königs, Auf den Flügeln des Sturms, Die Kathedrale der Hoffnung (alle 1999), Der brennende Stein, Das Rad des Schicksals (beide 2000), Kind des Feuers, Schatten des Gestern (beide 2001), Ins Land der Greife (2005), Die magischen Tore (2006), Das verwüstete Land (2007) und Die letzte Schlacht (2008) – nicht annähernd der Erfolg beschieden war, den sie verdient gehabt hätte.
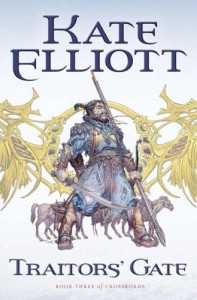 Nach dem Ende von Crown of Stars hat sich Kate Elliott mit Crossroads – einem aus den Bänden Spirit Gate (2006), Shadow Gate (2008) und Traitors’ Gate (2009) bestehenden Zyklus – erneut der klassischen Fantasy zugewandt. In diesem Fall ist das Setting allerdings nicht an ein geschichtlich zu verortendes europäisches Vorbild angelehnt, sondern wesentlich fantasyhafter. So gibt es zum Beispiel die auf riesigen Adlern reitenden Reeves, eine Art Polizeitruppe, die nach dem Verschwinden ihrer Herren, der Guardians, die jahrhundertelang das Land of the Hundred beherrscht haben, allergrößte Mühe haben, weiterhin für Recht und Ordnung zu sorgen. Dabei bekommen sie es zunehmend nicht nur mit die Handelswege bedrohenden Räuberbanden zu tun, sondern auch mit Übergriffen fremder Mächte. In dieses unruhige, an der Schwelle zum Krieg stehende Land kommt der Qin-Krieger Anji, der aus bestimmten Gründen aus seiner Heimat flüchten musste und schon bald erkennt, dass turbulente Zeiten zwar bedrohlich sind, sich in ihnen für einen entschlossenen Mann aber auch außergewöhnliche Möglichkeiten ergeben. Auch Crossroads wartet mit überzeugenden Figuren auf, und auch hier wird erst nach und nach deutlich, in welche Richtung sich die Geschichte wirklich entwickelt und was es mit den sagenhaften Guardians wirklich auf sich hat. Wenn man der Trilogie – auf die nach einem Brückenband eine weitere, zeitlich deutlich später angesiedelte Trilogie folgen soll – etwas vorwerfen kann, dann allenfalls, dass sie dem Setting und dem Hintergrund der einen oder anderen Figur ein bisschen mehr Platz hätte einräumen können. Aber vielleicht wird das ja in den noch geplanten Romanen geschehen.
Nach dem Ende von Crown of Stars hat sich Kate Elliott mit Crossroads – einem aus den Bänden Spirit Gate (2006), Shadow Gate (2008) und Traitors’ Gate (2009) bestehenden Zyklus – erneut der klassischen Fantasy zugewandt. In diesem Fall ist das Setting allerdings nicht an ein geschichtlich zu verortendes europäisches Vorbild angelehnt, sondern wesentlich fantasyhafter. So gibt es zum Beispiel die auf riesigen Adlern reitenden Reeves, eine Art Polizeitruppe, die nach dem Verschwinden ihrer Herren, der Guardians, die jahrhundertelang das Land of the Hundred beherrscht haben, allergrößte Mühe haben, weiterhin für Recht und Ordnung zu sorgen. Dabei bekommen sie es zunehmend nicht nur mit die Handelswege bedrohenden Räuberbanden zu tun, sondern auch mit Übergriffen fremder Mächte. In dieses unruhige, an der Schwelle zum Krieg stehende Land kommt der Qin-Krieger Anji, der aus bestimmten Gründen aus seiner Heimat flüchten musste und schon bald erkennt, dass turbulente Zeiten zwar bedrohlich sind, sich in ihnen für einen entschlossenen Mann aber auch außergewöhnliche Möglichkeiten ergeben. Auch Crossroads wartet mit überzeugenden Figuren auf, und auch hier wird erst nach und nach deutlich, in welche Richtung sich die Geschichte wirklich entwickelt und was es mit den sagenhaften Guardians wirklich auf sich hat. Wenn man der Trilogie – auf die nach einem Brückenband eine weitere, zeitlich deutlich später angesiedelte Trilogie folgen soll – etwas vorwerfen kann, dann allenfalls, dass sie dem Setting und dem Hintergrund der einen oder anderen Figur ein bisschen mehr Platz hätte einräumen können. Aber vielleicht wird das ja in den noch geplanten Romanen geschehen.
Bis es soweit ist, werden sich die Leserinnen und Leser aber noch ein bisschen gedulden müssen, denn zunächst einmal hat sich Kate Elliott mit der inzwischen vollständig vorliegenden Spiritwalker Trilogy (Cold Magic (2010), Cold Fire (2011) und Cold Steel (2013)) einem vollkommen neuen Setting zugewandt, das sich deutlich von ihren bisherigen High-Fantasy-Szenarien unterscheidet, und das sie am besten selbst beschreiben sollte: “Read an Afro-Celtic post-Roman icepunk Regency fantasy adventure with airships, Phoenician spies, the intelligent descendents of troodons, and a dash of steampunk whose gas lamps can be easily doused by the touch of a powerful cold mage.” Das klingt zunächst einmal ziemlich interessant.
Kate Elliott ist eine Autorin, die sich durch den in ihren Werken immer spürbaren, aber nie aufdringlichen emanzipatorischen Ansatz unter Fantasy-Lesern nicht nur Freunde gemacht hat. Dabei zählt sie zu den wenigen Autorinnen, denen es gelingt, diesen Ansatz bruchlos in das jeweilige Setting einzubetten, die Welt glaubwürdig zu gestalten und mit überzeugenden Figuren zu bevölkern – und das Ganze, ohne sich allzu sehr an bekannte Vorbilder (bzw. das eine, vor allem bekannte Vorbild) anzulehnen. Von daher kann man nur hoffen, dass sie noch lange weiterschreibt – denn immerhin hat sie bereits bewiesen, dass es möglich ist, ein mehrbändiges Fantasy-Epos nicht nur stimmig, sondern auch innerhalb eines zeitlich vertretbaren Rahmens zu Ende zu bringen.
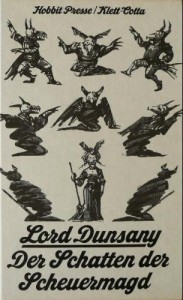 Auch wenn es an Zeit & Muße mangelt, ihn mit einem richtigen Text zu würdigen, wollen wir nicht in Vergessenheit geraten lassen, dass sich heute der Geburtstag von Edward John Moreton Drax Plunkett, dem 18. Baron Dunsany – vermutlich besser bekannt als Lord Dunsany – zum 135. mal jährt. Dunsany ist mit Geschichten wie The Hoard of the Gibbelins (1912), Sammlungen wie die um The Gods of Pegāna (1905) oder um Joseph Jorkens (1925-57) und Romanen wie The King of Elfland’s Daughter (1924) einer der Gründerväter der Fantasy, die allerdings nur einen Teil seines umfangreichen Schaffens ausmacht. Obwohl auch bei uns einige seiner Erzählungen und Romane erschienen sind (z.B. Jorkens borgt sich einen Whisky (1957), Die Königstochter aus Elfenland (1978), Der Schatten der Scheuermagd (1986)), dürfte der Mann, dessen Einflüsse im Werk von J.R.R. Tolkien über Ursula K. Le Guin bis hin zu Neil Gaiman zu spüren sind, hierzulande nur noch Lesern und Leserinnen bekannt sein, die sich länger und/oder intensiver mit dem Genre und seiner Historie beschäftigt haben.
Auch wenn es an Zeit & Muße mangelt, ihn mit einem richtigen Text zu würdigen, wollen wir nicht in Vergessenheit geraten lassen, dass sich heute der Geburtstag von Edward John Moreton Drax Plunkett, dem 18. Baron Dunsany – vermutlich besser bekannt als Lord Dunsany – zum 135. mal jährt. Dunsany ist mit Geschichten wie The Hoard of the Gibbelins (1912), Sammlungen wie die um The Gods of Pegāna (1905) oder um Joseph Jorkens (1925-57) und Romanen wie The King of Elfland’s Daughter (1924) einer der Gründerväter der Fantasy, die allerdings nur einen Teil seines umfangreichen Schaffens ausmacht. Obwohl auch bei uns einige seiner Erzählungen und Romane erschienen sind (z.B. Jorkens borgt sich einen Whisky (1957), Die Königstochter aus Elfenland (1978), Der Schatten der Scheuermagd (1986)), dürfte der Mann, dessen Einflüsse im Werk von J.R.R. Tolkien über Ursula K. Le Guin bis hin zu Neil Gaiman zu spüren sind, hierzulande nur noch Lesern und Leserinnen bekannt sein, die sich länger und/oder intensiver mit dem Genre und seiner Historie beschäftigt haben.
Für eine ausführlichere Würdigung Lord Dunsanys anlässlich seines Geburtstags empfehlen wir einen Besuch bei Skalpell und Katzenklaue.
Bibliotheka Phantastika erinnert an John Gardner, der heute 80 Jahre alt geworden wäre. Der am 21. Juli 1933 in Batavia im us-amerikanischen Bundesstaat New York geborene Romancier, Essayist, Literaturkritiker und Universitätsprofessor John Champlin Gardner, Jr. war eigentlich alles andere als ein typischer Genre-Autor, auch wenn er immer mal wieder phantastische Elemente in seine Romane und Erzählungen eingebaut und sozusagen mit der Phantastik geflirtet hat. Einmal hat er aber dann doch einen ernsthaften Ausflug in die Gefilde der phantastischen Literatur unternommen – und diesem Ausflug verdankt die Fantasy eines ihrer ungewöhnlichsten Werke.
Grendel (1971) ist eine Nacherzählung der Beowulf-Saga, allerdings aus der Sicht des Monsters. Wobei Grendel als “Monster” nur sehr eindimensional charakterisiert wäre. Ja, es stimmt, das wilde, einsame Geschöpf, das mit seiner Mutter in einer Höhle lebt, besitzt einen animalischen Tötungstrieb, den es auch oft und gerne auslebt. Doch gleichzeitig ist Grendel ein hochintelligentes Wesen, das die Sprache der Menschen erlernen kann und letztlich zu einem Verständnis der Welt gelangt, das man einem Monster gewiss nicht zutrauen würde. Dass es zwischen den sich immer weiter ausbreitenden und ihre ersten staatsähnlichen Gebilde errichtenden Menschen und Grendel zu einem Zusammenstoß kommt, ist mehr oder weniger unausweichlich. Dass dieser Zusammenstoß blutig ist und eine Folge aus Ereignissen in Gang setzt, in deren Verlauf Grendel immer wieder Menschen tötet und die Methalle des Königs verwüstet, an deren Ende aber sein eigener Tod steht, liegt in der Natur Grendels – und in der der Menschen.
Denn auch wenn Grendels triebhafte Wildheit, seine Mordlust und sein Hass verhindern, dass er in der Geschichte zum good guy wird, kommen die Menschen mit ihrer Verschlagenheit, ihrer Habgier und ihrer Grausamkeit kaum besser weg. Und so kann man am Ende eigentlich nur Mitleid empfinden, wenn das ach so schreckliche – und gleichzeitig so freiheitsliebende – Monster die prophetischen Worte spricht: “Poor Grendel’s had an accident … so may you all.”
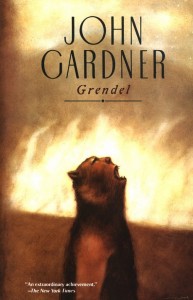 John Gardner hat den Menschen mit Grendel (dt. Grendel (1989 bzw. – mit einer dieses Mal dankenswerterweise nicht peinlichen Covergestaltung – 2009)) einen Spiegel vorgehalten, der uns so hässlich zeigt, wie wir viel zu häufig waren, sind und vermutlich auch in Zukunft sein werden. Und das Ganze im Rahmen eines in kraftvoller Sprache erzählten, zwischen boshafter Ironie und Schwermut changierenden Fantasyromans, der nebenbei auch den in Bezug auf Fantasy immer wieder gerne geäußerten Eskapismusvorwurf eindrucksvoll widerlegt.
John Gardner hat den Menschen mit Grendel (dt. Grendel (1989 bzw. – mit einer dieses Mal dankenswerterweise nicht peinlichen Covergestaltung – 2009)) einen Spiegel vorgehalten, der uns so hässlich zeigt, wie wir viel zu häufig waren, sind und vermutlich auch in Zukunft sein werden. Und das Ganze im Rahmen eines in kraftvoller Sprache erzählten, zwischen boshafter Ironie und Schwermut changierenden Fantasyromans, der nebenbei auch den in Bezug auf Fantasy immer wieder gerne geäußerten Eskapismusvorwurf eindrucksvoll widerlegt.
Es ist schwer zu sagen, ob John Gardner sich im späteren Verlauf seines Schriftstellerlebens noch einmal so eindeutig dem Genre zugewandt hätte, und ob das Ergebnis wieder ähnlich überzeugend ausgefallen wäre. Doch diese Überlegungen sind müßig, denn am 14. September 1982 ist er mit seinem Motorrad verunglückt und noch am Unfallort seinen Verletzungen erlegen.
Bibliotheka Phantastika gratuliert Liliana Bodoc, die heute 55 Jahre alt wird. Mit ihrer dreibändigen Saga de los Confines (dt. Die Grenzländersaga) hat die am 21. Juli 1958 in Santa Fe, der Haupstadt der gleichnamigen argentinischen Provinz, geborene Liliana Bodoc ein in mehrfacher Hinsicht ungewöhnliches Werk geschaffen; während das Setting und etliche inhaltliche Komponenten deutlich an die Mythen und Sagen der indianischen Ureinwohner Mittel- und Südamerikas angelehnt sind und der Erzählduktus in vielerlei Hinsicht an den für die lateinamerikanische phantastische Literatur typischen Magischen Realismus erinnert, bedient sich der eigentliche Plot eines Musters, das man so oder so ähnlich auch aus der angloamerikanischen Fantasy kennt. Das Ergebnis ist eine Trilogie, die einerseits sehr neu, frisch und “anders” wirkt, andererseits ein bisschen zwischen allen Stühlen sitzt.
Inhaltlich lässt sich La Saga de los Confines am ehesten als Fantasyversion der Eroberung Mittel- und Südamerikas durch die spanischen Konquistadoren bezeichnen – allerdings mit ein paar bedeutsamen Abweichungen. Im ersten Band Los Días del Venado (2000) entdecken die Astronomen der Fruc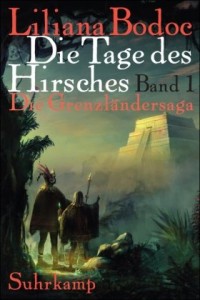 htbaren Länder dunkle Vorzeichen, die auf eine Bedrohung aus der Alten Welt von jenseits des Meers hinzuweisen scheinen. Und tatsächlich erweist sich die alte Legende, nach der Misaianes, der Sohn des Ewigen Hasses, eines Tages ein Heer schicken wird, um die Fruchtbaren Länder zu erobern, nur zu bald als wahr. Anfangs sieht es ganz so aus, als hätten die Verteidiger keine Chance gegen die eisengerüsteten, auf seltsamen Tieren reitenden Soldaten, doch schließlich gelingt es ihnen, das Blatt zu wenden. Was allerdings Misaianes nicht daran hindert, fünf Sonnenjahre später eine zweite Flotte zu schicken – und mit ihr eine ganz besondere Waffe in Form der Schattenfrau. Die Auseinandersetzung mit besagter Schattenfrau, die den Samen des Ewigen Hasses in den Fruchtbaren Ländern streuen will, spielt im zweiten Band Los Días de la Sombra (2002) eine wesentliche Rolle. Im dritten Band Los Días del Fuego (2004) unternimmt Misaianes dann einen weiteren Versuch, mit einer noch gewaltigeren Flotte die Bewohner der Fruchtbaren Länder unter seine Knute zu zwingen – doch so, wie es möglich ist, die Saat der Gewalt von einem Kontinent zum anderen zu tragen, ist es auch möglich, den Samen des Widerstands in die Alte Welt zu bringen … mit überraschenden Folgen.
htbaren Länder dunkle Vorzeichen, die auf eine Bedrohung aus der Alten Welt von jenseits des Meers hinzuweisen scheinen. Und tatsächlich erweist sich die alte Legende, nach der Misaianes, der Sohn des Ewigen Hasses, eines Tages ein Heer schicken wird, um die Fruchtbaren Länder zu erobern, nur zu bald als wahr. Anfangs sieht es ganz so aus, als hätten die Verteidiger keine Chance gegen die eisengerüsteten, auf seltsamen Tieren reitenden Soldaten, doch schließlich gelingt es ihnen, das Blatt zu wenden. Was allerdings Misaianes nicht daran hindert, fünf Sonnenjahre später eine zweite Flotte zu schicken – und mit ihr eine ganz besondere Waffe in Form der Schattenfrau. Die Auseinandersetzung mit besagter Schattenfrau, die den Samen des Ewigen Hasses in den Fruchtbaren Ländern streuen will, spielt im zweiten Band Los Días de la Sombra (2002) eine wesentliche Rolle. Im dritten Band Los Días del Fuego (2004) unternimmt Misaianes dann einen weiteren Versuch, mit einer noch gewaltigeren Flotte die Bewohner der Fruchtbaren Länder unter seine Knute zu zwingen – doch so, wie es möglich ist, die Saat der Gewalt von einem Kontinent zum anderen zu tragen, ist es auch möglich, den Samen des Widerstands in die Alte Welt zu bringen … mit überraschenden Folgen.
Die faszinierendste Komponente von Liliana Bodocs Grenzländersaga – auf Deutsch als Die Tage des Hirsches (2008), Die Tage des Schattens und Die Tage des Feuers (beide 2009) erschienen – ist zweifellos das Setting: die Fruchtbaren Länder mit ihren (zumindest für die meisten deutschsprachigen Leser und Leserinnen) vermutlich sehr exotisch wirkenden Kulturen, ihren Stämmen, Astronomen und Erdzauberern. Hinzu kommt eine ungewohnt poetische Sprache und ein im Vergleich zur angloamerikanischen Fantasy ungewöhnlicher Erzählduktus voller märchenhafter Begebenheiten, Abschweifungen, Handlungssprünge und Geschichten in der Geschichte. Darüber hinaus bietet sich hier die Möglichkeit, einen etwas anderen bzw. deutlich verfremdeten Blick auf ein Stück realer irdischer Geschichte zu werfen. All das hat aber letztlich nicht ausgereicht, um aus der Grenzländersaga in Deutschland mehr als einem Achtungserfolg zu machen. Was darauf hindeuten könnte, dass die deutschsprachigen Fantasyleser und -leserinnen mit allzuviel Exotik und zu deutlichen Abweichungen von den üblichen Erzählkonventionen mehrheitlich eben doch nicht so richtig was anfangen können. Die, auf die das nicht zutrifft, können (und sollten) sich hingegen darüber freuen, dass mit La Saga de los Confines mal wieder eine wirklich ungewöhnliche, ein bisschen andere Fantasytrilogie auf Deutsch – und zwar vollständig – erschienen ist.
Bibliotheka Phantastika gratuliert Erin Morgenstern, eigentlich Erin Christiansen, die heute 35 Jahre alt wird. Viele Werke gibt es von der am 08.07.1978 in Marshfield, Massachusetts, geborenen Erin Morgenstern noch nicht zu lesen. 2011 erst erschien ihr Erstlingswerk The Night Circus (dt. Der Nachtzirkus), das auf malerische Weise den kreativen Geist der Autorin zeigt und in die schwarzweiße Welt des Nachtzirkus entführt. Eine melancholische Verbindung aus Kunst und Literatur, die einen nicht so schnell wieder loslässt.
Anlässlich von Erin Morgensterns Geburtstag laden wir euch ein, das Portrait der Autorin zu besuchen.