Das zweite Jahr, in dem wir euch jeden Monat ein hoffentlich interessantes Buch besonders ans Herz legen möchten, starten wir klassisch: Der Auftakt-Band von David Anthony Durhams Acacia-Trilogie ist epische Fantasy – Königsmord, Invasion und Rachepläne bestimmen die Handlung, aufflackernde Magie, das Hineinwachsen in Rollen und ein Blick auf die Welt durch viele Augen und in mehreren Handlungssträngen lassen erzählerisch Vertrautes anklingen. Doch sollte man sich von der vordergründigen Ähnlichkeit zu anderen Fantasy-Zyklen und vor allem, nicht zuletzt aufgrund der Figurenkonstellation, zu George R. R. Martins Lied von Eis und Feuer auf keinen Fall täuschen lassen.
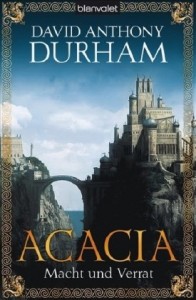 Wenn Durham seinem Reich Acacia, dem vertraut wirkenden, aber wackelnden zivilisatorischen Mittelpunkt der Welt, Insel- oder Steppenkulturen gegenüberstellt, fügen diese sich in das Weltgeschehen ein, ohne wie aufgemalte Exotismen zu wirken. Wenn er Figuren aufbaut, die ein Coming-of-age erleben, dann schlagen sie oft unerwartete, aber immer nachvollziehbare Wege ein, vor allem auch in Bezug auf Geschlechterrollen – als Paradebeispiel sei Corrin Akaran genannt, die zunächst das Schicksal etlicher Fantasy-Prinzessinnen zu teilen scheint, sich aber auf gänzlich andere Art als ihre Geschwister und gewissermaßen auch effektiver zu behaupten weiß.
Wenn Durham seinem Reich Acacia, dem vertraut wirkenden, aber wackelnden zivilisatorischen Mittelpunkt der Welt, Insel- oder Steppenkulturen gegenüberstellt, fügen diese sich in das Weltgeschehen ein, ohne wie aufgemalte Exotismen zu wirken. Wenn er Figuren aufbaut, die ein Coming-of-age erleben, dann schlagen sie oft unerwartete, aber immer nachvollziehbare Wege ein, vor allem auch in Bezug auf Geschlechterrollen – als Paradebeispiel sei Corrin Akaran genannt, die zunächst das Schicksal etlicher Fantasy-Prinzessinnen zu teilen scheint, sich aber auf gänzlich andere Art als ihre Geschwister und gewissermaßen auch effektiver zu behaupten weiß.
An der Politik, die in Macht und Verrat geführt wird und die weit entfernt von der häufig stark vereinfachten “Fantasy-Politik” ist, und am Auge für Zusammenhänge erkennt man Durhams Ansätze, die er mit Sicherheit aus den historischen Romanen mitgebracht hat, in denen er vor seinem ersten Ausflug in die Fantasy zu Hause war.
Es gibt also viele Gründe, sich Acacia anzuschauen, und um nicht einer kommenden Rezension vorauszugreifen, möchte ich hier vor allem noch einen Grund hervorheben: David Anthony Durhams Erzählstil hat Qualitäten, die im modernen Fantasy-Roman nur vereinzelt zu finden sind und dadurch geradezu ungewöhnlich scheinen: Wo andere alles zu breiten Szenen auswalzen und den Leser mit cineastischer Bildgewalt bombardieren, pflegt Durham einen häufig narrativen Stil und zeigt mal eben ganz gekonnt, wie mitreißend geraffte und gestraffte Ereignisse sein können und dass in einen dicken Roman ein Handlungsbogen passt, für den andere ein paar Bände verbraten hätten. Für eine Kostprobe dieses elegant fließenden Stils genügt es, einfach die ersten Seiten zu lesen, in denen man den Weg eines Attentäters vom hohen Norden herab an den Königshof verfolgt.
Darüber murren, dass etwas zu kurz gekommen ist, muss man trotzdem nicht: Neben dem vielfältigen Figurenspektrum gibt es auch Beschreibungen der Welt und ihrer Kulturen und prägnante Dialoge (teils, nicht minder prägnant, ebenfalls in geraffter Form). Konsequenterweise findet die größte Bildgewalt von Macht und Verrat dann auch außerhalb der beschriebenen Handlung statt – dass Durham sie trotzdem im Kopf des Lesers heraufbeschwören kann, sollte Grund genug sein, den Roman auszuprobieren. Man greift damit garantiert zu einem der interessantesten Autoren der gegenwärtigen Fantasy.
Acacia – Macht und Verrat (ISBN: 978-3-442-24494-2) ist der erste Band einer Trilogie, die mit Die Fernen Lande fortgesetzt wird. Vom Abschlussband The Sacred Band steht die Übersetzung noch aus.

Erstaunlich, wie unterschiedlich man doch dieselben Punkte wahrnehmen kann. Mir erschien Durhams Stil regelrecht lieblos, weil auf viele Beschreibungen schlichtweg verzichtet wird. Und ganz so puristisch sollte man es nun wirklich nicht halten. Denn es sind vor allem die Charaktere, die darunter leiden. Durham bedient sich auf inflationäre Weise der indirekten Rede und erstickt damit jeden Versuch einer Annäherung im Keim – auf mich wirken sie wie Statisten, flach und klischeebeladen und nicht selten unglaubwürdig.
Hi Corvus,
schön, dass du den Roman gelesen hast. Ganz nachvollziehen kann ich deine Kritikpunkte allerdings nicht.
Durhams Stil mag zwar Geschmackssache sein, er bietet aber auf jeden Fall eine angenehme Abwechslung von der “show, don’t tell”-Konvention moderner Fantasy, wenn man sich darauf einlässt.
Gerade die Kritik an den handelnden Personen kann ich nicht nachvollziehen, denn Durham legt augenscheinlich sehr viel Wert auf seine Figuren und gibt der Charakterzeichnung auch viel Raum in seinem Roman, sodass für mich nicht von “flach” gesprochen werden kann.
Na ja… Ich halte es durchaus für sinnvoll, dass derzeit das “show, dont’t tell”-Prinzip in der phantastischen Literatur dominiert. Es ermöglicht einfach, viel tiefer in die Geschichte einzutauchen, schon allein deshalb, weil man gezwungen ist, sich seinen eigenen Raum auf die Geschehnisse zu machen. Durham beschreibt weniger als dass er behauptet – und darunter leidet in meinen Augen vor allem die Atmosphäre. Nichts, was geschieht, berührt mich. Dasselbe gilt auch für die Charaktere, die nur aus der Distanz beschrieben werden – die Binnensicht fehlt völlig. Unter anderen Umständen wäre mir Dariels Piratenleben vielleicht glaubhaft vorgekommen, so wirkt es jedoch arg romantisiert und kitschig, so wie Dariel selbst idealistisch bis zur Unglaubwürdigkeit ist wie fast alle seine Geschwister. Meenas Wandlung zur genialen Schwertkämpferin innerhalb weniger Monate ist hingegen schlichtweg nicht mehr glaubhauft.
Das Buch wurde vor gut einem Jahr auf fantasy-forum.net im Rahmen einer Leserunde besprochen. Die vorherrschende Meinung war dieselbe. Einfach mal bei Interesse reinschauen; hier gibt’s eine Übersicht über die einzelnen themen: http://fantasy-forum.net/showthread.php?t=4898
Ich habe das Gefühl, dass du dir ein wenig selbst widersprichst – einerseits möchtest du dir nach eigener Aussage deinen “eigenen Reim auf die Geschehnisse (…) machen”, andererseits kritisierst du, dass Durham für deine Begriff zu wenig vorgibt (wobei ich deine Kritik im Detail nicht ganz nachvollziehen kann, denn dass etwa die Binnensicht völlig fehlt, kann man nicht behaupten – man erfährt durchaus einiges darüber, was in den handelnden Figuren vorgeht).
Möchtest du als Leser also nun viel mitdenken, oder möchtest du doch lieber alles vom Autor möglichst eindeutig präsentiert bekommen?
Was nun deine konkreten inhaltlichen Kritikpunkte betrifft: Bist du dir so sicher, dass der Eindruck eines arg romantisierten Piratendaseins bei Dariel nicht genau das ist, was Durham bezweckt?
Dariel wird in meinen Augen als noch relativ unreifer junger Mann gezeichnet, dem (anders als etwa seinen Schwestern) durch die väterliche Beschützergestalt, die sich seiner angenommen hat, das Hineingestoßenwerden in die raue Wirklichkeit innerlich erspart geblieben ist. Auch nach dem Verlust seines Ersatzvaters sucht er ja immer wieder nach solchen “väterlichen” Figuren, erst unterwegs mit Leeka (bei dem er ja z.B. explizit überlegt, ob er wohl Enkelkinder hat), dann später in noch weit höherem Maße bei seinem älteren Bruder, zu dem er aufschaut.
Dass so jemand, der die längste Zeit seines Lebens emotional wohlbehütet gewesen ist, die Piraterie als großes Abenteuer empfindet (und sie aus diesem Blickwinkel auch an den Leser vermittelt wird), kommt mir nur konsequent vor.
Was Meenas Schwertkämpferkarriere betrifft – gut, die verläuft sehr flott, aber immerhin wird sie auch schon vor ihrer dahingehenden Ausbildung als sportlich und körperlich tüchtig geschildert, so dass ihre Entwicklung zumindest für Genreverhältnisse nicht über die Gebühr unglaubwürdig daherkommt. Das geht in der Fantasy mit all ihren zu wackeren Kämpfern heranwachsenden Küchenjungen und Schafhirten oft derart holterdipolter, dass Durhams Schilderung bei weitem nicht das Unglaubwürdigste ist, was einem auf dem Sektor begegnen kann. Insofern würde ich eher dem Genre insgesamt den Vorwurf machen, hier an einem bestimmten eher märchenhaft angehauchten Heldenbild zu kranken, als speziell Durham eine besonders unrealistische Umsetzung dieses Motivs zu unterstellen.
Schön, dass man hier das Recht auf seine eige Meinung hat, ohne dass die eigene Kritikfähigkeit in Frage gestellt wird.
Ich sagte bereits, dass Durham eher behauptet als beschreibt. Aus der Distanz seiner Erzählweise liefert er die Bewertung der Geschehnisse bisweilen gleich mit. Hier charakterisieren sich die Hauptpersonen nicht allein durch ihr Innenleben und ihre Interaktion mit der Umwelt – hier meldet ich bisweilen der auktoriale ERzähler (wenn auch recht dezent) zu Wort und gibt dem Leser die Gedankengänge ein, auf die sie kommen sollen.
Der Mangel an Beschreibungen hat daher nichts damit zu tun, dass ich mir keinen Reim auf die spärlichen Informationen machen kann oder will. Auch intensiv beschriebene Settings wie auch Charaktere können den Leser immer wieder überraschen, weil es schlichtweg darauf ankommt, auf welcher Ebene die Geschichte spielt. So kann das Innenleben einer Hauptperson zwar allseits bekannt sein, dabei aber von irrationalen Gefühlen geprägt sein, dass man immer wieder dazu gezwungen ist, die Person in einem anderen Licht zu sehen. Das ist also nicht das Problem.
Die eher spärliche Beschreibungen der Charaktere legen den Schluss nahe, dass Durham sie nicht als treibende Kräfte der Handlung oder gar als Identifikationsfiguren konzipiert hat (weshalb der Vergleich mit GRRM in meinen Augen hinkt), sondern als Fenster zu einer Welt, die bei aller Kritik wunderbar konzipiert ist. Bei Durham geht es darum, die eher spärlich dahingeworfenen Angaben zu einem Grundgerüst zusammenzusetzen, doch mitdenken kann man auch, wenn der Hintergrund bereits detaillierter ausgearbeitet wurde und dieser erste Schritt wegfällt. Manchmal funktioniert es sogar erst dann, weil bestimmte Ideen, etwa die Ausbreitung eines undurchdringlichen Netzes aus Lügen und Intrigen, akribischer Vorbereitungen bedürfen. Es kommt ganz einfach auf die Art der Dinge an, die thematisiert werden sollen. Durhams Welt wirkt für mich nur wie ein Rohbau, in dem sich schlicht und einfach noch kein pulsierendes Leben abspielen kann, weil die wesentlichen Voraussetzungen fehlen. Ein Beispiel dafür wäre die spärliche Binnensicht der Charaktere.
Dass Charakterentwicklungen in anderen Romanen noch unrealistischer erscheinen als in Acacia, ist in meinen Augen kein Argument. Ich vergleiche das Buch schließlich nicht mit Eragon, sondern will es für sich alleine bewerten. Meenas Wandlung ist unglaubwürdig, egal, welchen Maßstab man anlegt.
Bezüglich Dariel: Es mag ja sein, dass er das Piratenleben als Abentuer empfindet – das Problem ist, dass es auch aus der Distanz des Erzählers als Abenteuer beschrieben wird. Hier hatte ich schlichtweg den Eindruck, als sei die Situation wiklich wie beschrieben. Ich erwarte jedoch, dass sich der Erzähler einer Wertung enthält.
Ich erwarte jedoch, dass sich der Erzähler einer Wertung enthält.
Damit wären wir aber letztlich wieder bei dem Punkt, den Fremdling schon, wenn auch in etwas anderer Form, angesprochen hat, nämlich bei einer bestimmten Erwartungshaltung an den Erzählstil, die in meinen Augen ein wenig mit deiner in Bezug auf den Inhalt erhobenen Forderung kollidiert, das Buch nur aus sich heraus zu bewerten.
Denn die (auch hinsichtlich der Wertung) zurückgenommene Instanz des personalen Er-Erzählers, der mit filmisch genauen Beschreibungen arbeitet und den Leser dadurch quasi über die immer in irgendeiner Form stattfindende Lenkung hinwegtäuscht, ist ja nur deshalb das Modell, das “man erwartet”, weil sie in einer spezifischen Erzähltradition in den letzten Jahren immer stärker zum Standard geworden ist. Das mag man begrüßen oder bedauern, aber auf alle Fälle prägt die weite Verbreitung dieser Erzähltechnik die Lesegewohnheiten und sorgt, wie du oben ja auch bewiesen hast, zumindest für implizite Vergleiche.
Nicht ich habe den Vergleich zu Martin gezogen – das haben schon andere getan. Ich habe lediglich dazu Stellung genommen und letztlich die Aussage der Rezensentin bestätigt, dass man ihn und Durham trotz vordergründiger Ähnlichkeiten nicht direkt vergleichen kann.
Die zunehmende Verdrängung des auktorialen Erzählers aus der phantastischen Literatur halte ich ebenso wie die damit verbundene, steigende Tendenz zum Prinzip “show, don’t tell” für überaus sinnvoll. Bei vielen Autoren wie etwa Guy G. Kay habe ich das Gefühl, bevormundet zu werden, weil er seine Beschreibungen oft mit Wertungen versieht, die keine Zweifel zulassen. Dass eine unterbewusste Lenkung auch dann stattfindet, wenn wir es mit einem konsequenten personalen Erzähler zu tun haben, leugne ich gar nicht, doch sind die Aussagen hier weniger endgültig und werden dem Leser nicht “vor den Latz geknallt”, wenn man es halbwegs geschickt anstellt. Womit sich die Frage nach dem Mitdenken erübrigt: Der Leser wird weitaus stärker durch einen auktorialen Erzähler bevormundet als durch geschickt subtil eingeflochtene allgemeine Informationen.
Nicht alles, was mit gängigen Trends und Konventionen bricht, ist automatisch besser. In diesem Falle leidet vor allem die Intensität der Erzählung darunter.
Hm. Also für mich passt zum einen “subtil” überhaupt nicht mit “show, don’t tell” und dem personalen Erzähler zusammen. Im Gegenteil, das empfinde ich als eine (ja, je nachdem, was man wie erzählen will, durchaus wirkungsvolle) Einschränkung der erzählerischen Möglichkeiten, die es sowohl den AutorInnen als auch den LeserInnen relativ leicht macht. Einfache Regeln, einfaches Schreiben, einfaches Lesen.
Muss nicht schlecht sein. Funktioniert, keine Frage. Aber das als einzig wahre Möglichkeit zu sehen … da wäre es mir viel zu schade um die Vielfalt. Und die Art von Intensität, die man mit diesen Regeln herstellen kann, ist bei Weitem nicht die Einzige, die es gibt (aber wieder: die einfachste/direkteste für alle Beteiligten).
Und man macht sich meiner Ansicht nach was vor – aber du hast ja gesagt, dass du die Tatsache nicht leugnest – wenn man sich vom personalen Erzähler weniger “manipuliert” fühlt. Ich empfinde es genau andersrum. Der personale Erzähler ist eine (wiederum: wirkungsvolle) Manipulation. Eine von vielen. Schreiben ist manipulieren, Lesen ist manipuliert werden. 😉
Ich sehe da aber lediglich eine geschmackliche Vorliebe, wenn man lieber “möglichst versteckt” manipuliert wird. Und diese Vorliebe ist durch Trends und Entwicklungen geprägt. Irgendwie rational als besser begründen lässt sie sich aber mE nicht.
Ich bin just mit Band 1 der »Acacia«-Trio fertig geworden und fand den Roman gelungen. Eigentlich habe ich vor einigen Jahren damit aufgehört, mehrteilige, sogenannte High- oder Epic-Fantasy zu lesen. Durham wurde mir aber empfohlen, und so gab ich ihm eine Chance.
Gerade das, was in hiesigen Fantasy-Lesekreisen und auch in den Kommentaren hier, oftmals als Mängel von »Acacia«angekreidet wird, gehört für mich zu den Stärken des Romanes: kein Larifari, keine lang ausgewalzte Gefühlsduselei und Bauchnabelschau. Nüchterner, sparsamer Stil, der sich auf Handlungen, Ereignisse und Entwicklungen konzentriert; dadurch mag die Sprache und Darstellungsweise des Buches für manche sicherlich zu distanziert und kühl wirken, was ich verstehen kann. Mir gefiel aber, wie die Handlung schnell voran schritt (einfach mal 9 Jahre überspringen und dann in einigen Rückblenden/Erinnerungen gerafft schildern, ›YEAH!‹, andere Autoren hätten da einen ganzen 500-Seiter rausgehauen!).
Normalerweise bekomme ich die Krätze bei Fantasy mit Adels-, Monarchen-, Militär- und Auserwählten-Schmu, aber wie Durham
{Hab beim Schreiben versehentlich ›TAB‹ und gleich danach ›ENTER‹ getippt.}
Normalerweise bekomme ich die Krätze bei Fantasy mit Adels-, Monarchen-, Militär- und Auserwählten-Schmu, aber Durham bürstet das Ganze für meinen Geschmack genug gegen den Strich, und traut sich zudem, erfreulich erwachsene Themen auszubreiten.
Werde mir Teil 2 und 3 der Trio sicherlich auch noch besorgen.
(Gelesen als englisches eBook.)