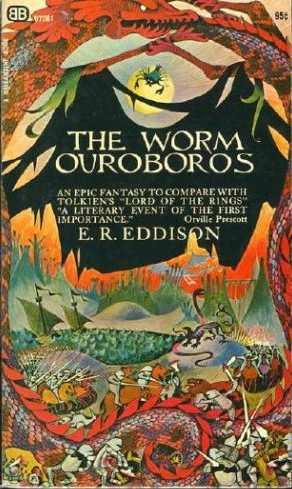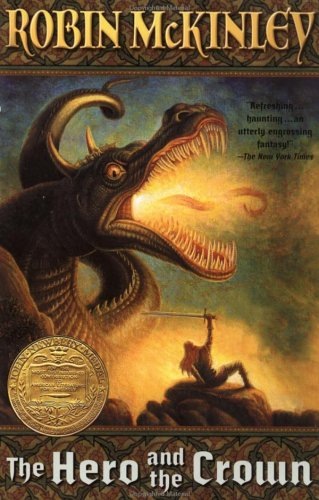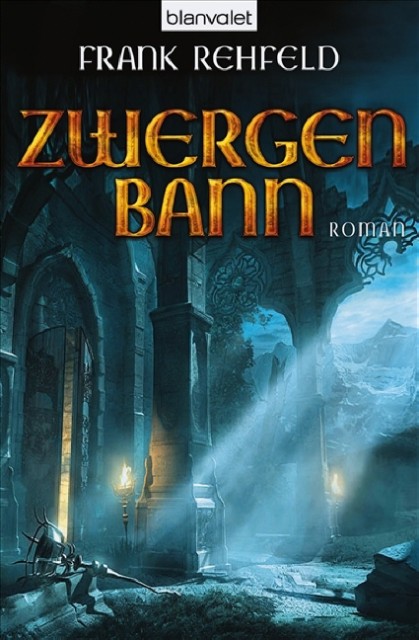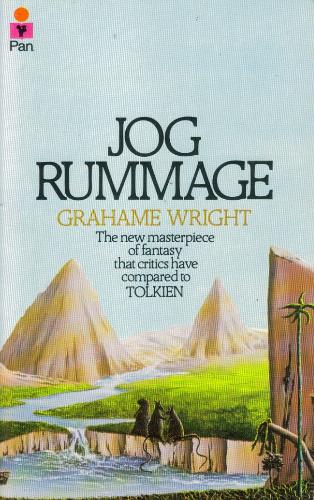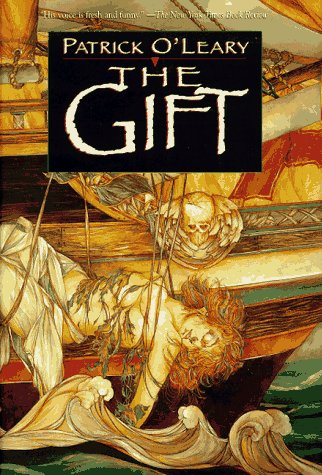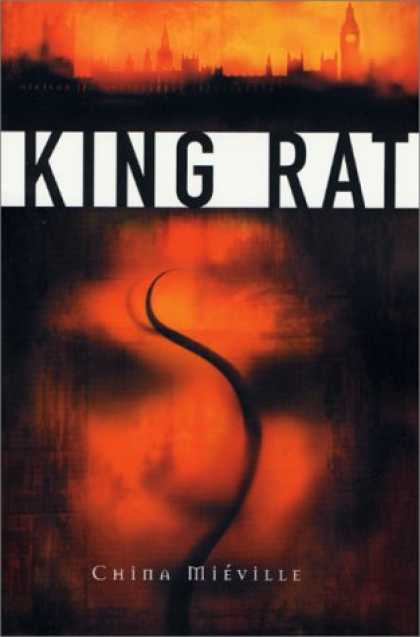Bibliotheka Phantastika erinnert an E. R. Eddison, der heute vor 130 Jahren geboren wurde. Auch wenn sein Name einem Großteil der heutigen Fantasyleserschaft vermutlich kaum noch etwas sagen wird, nimmt der hauptberuflich lange Zeit als Beamter im britischen Handelsministerium tätige Eric Rücker Eddison (geb. am 24. November 1882 in Adel, Yorkshire, England, gest. am 18. August 1945 in Marlborough, Wiltshire) zu recht einen prominenten Platz in der Ahnengalerie der Fantasy ein. Und das, obwohl sein Oeuvre vergleichsweise schmal und sein eigentliches Hauptwerk unvollendet geblieben ist. Sowohl in Eddisons Leben wie in seinem Werk gibt es einige bedenkenswerte Parallelen zu J.R.R. Tolkien, auf die an dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden kann. Beiden gemein ist sicher die Rückwärtsgewandtheit, die Sehnsucht nach einer Welt, die zu dem Zeitpunkt, als sie ihre Werke schrieben, längst Vergangenheit war. Ihr Umgang mit diesem Thema ist allerdings vollkommen unterschiedlich.
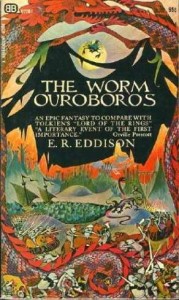 Nirgends wird dies deutlicher, als in Eddisons erstem und bis heute bekanntestem Roman The Worm Ouroboros: A Romance (1922; dt. Der Wurm Ouroboros (1981 bzw. 1993)). Von einer auf der Erde beginnenden, aber nie abgeschlossenen Rahmenhandlung um einen Mann namens Lessingham zusammengehalten – bzw. nicht zusammengehalten –, erzählt er die Geschichte des Krieges zwischen den Herren des Dämonenlandes und dem König des Hexenlandes auf einer erdähnlichen Welt namens Mercury (Merkurien), wobei man sich von den Begriffen nicht irreführen lassen sollte; die Demons (Dämonen), Witches (Hexen), Goblins (Kobolde) etc.pp. sind alle von menschlicher Gestalt. Die Guten in diesem Spektakel – deren Heldenhaftigkeit allerdings durchaus fragwürdige Züge trägt – sind Lord Juss, Goldry Bluszco, Lord Spitfire und Brandoch Daha, die Fürsten des Dämonenlandes, der Böse ist Gorice XI. (bzw. XII.), der König des Hexenlandes – und die interessantesten Charaktere sind Gorices Armeeführer Corund, Corsus und Corinius mit ihren eher menschlichen und nachvollziehbaren Problemen und der in seiner Loyalität schwankende Lord Gro aus Koboldland. Das Ganze ist in einer ebenso archaischen wie barocken Sprache inszeniert und nimmt mit seinem Kampf zwischen gut und böse oder dem (in diesem Fall auf die Spitze getriebenen) zyklischen Geschichtsbild thematisch einen Großteil dessen vorweg, was man in den meisten später erschienenen, der Heroic Fantasy oder Sword & Sorcery zugehörigen Werken finden kann. Dass die nur für ihre Ehre und den Kampf lebenden, im wahrsten Sinne des Wortes rein hedonistischen “Helden” ein problematisches Konstrukt sind, ist unbestritten. Dass The Worm Ouroboros vor allem aufgrund seiner einzigartigen Sprache (die nur in der zweiten deutschen Übersetzung adäquat wiedergegeben wird), sowie seiner Funktion als Genrekonventionen vorwegnehmender bzw. schaffender Vorläufer eines beträchtlichen Teils der modernen Fantasy eine Wiederentdeckung – gerne mit kritischem Auge – mehr als verdient hätte, allerdings auch.
Nirgends wird dies deutlicher, als in Eddisons erstem und bis heute bekanntestem Roman The Worm Ouroboros: A Romance (1922; dt. Der Wurm Ouroboros (1981 bzw. 1993)). Von einer auf der Erde beginnenden, aber nie abgeschlossenen Rahmenhandlung um einen Mann namens Lessingham zusammengehalten – bzw. nicht zusammengehalten –, erzählt er die Geschichte des Krieges zwischen den Herren des Dämonenlandes und dem König des Hexenlandes auf einer erdähnlichen Welt namens Mercury (Merkurien), wobei man sich von den Begriffen nicht irreführen lassen sollte; die Demons (Dämonen), Witches (Hexen), Goblins (Kobolde) etc.pp. sind alle von menschlicher Gestalt. Die Guten in diesem Spektakel – deren Heldenhaftigkeit allerdings durchaus fragwürdige Züge trägt – sind Lord Juss, Goldry Bluszco, Lord Spitfire und Brandoch Daha, die Fürsten des Dämonenlandes, der Böse ist Gorice XI. (bzw. XII.), der König des Hexenlandes – und die interessantesten Charaktere sind Gorices Armeeführer Corund, Corsus und Corinius mit ihren eher menschlichen und nachvollziehbaren Problemen und der in seiner Loyalität schwankende Lord Gro aus Koboldland. Das Ganze ist in einer ebenso archaischen wie barocken Sprache inszeniert und nimmt mit seinem Kampf zwischen gut und böse oder dem (in diesem Fall auf die Spitze getriebenen) zyklischen Geschichtsbild thematisch einen Großteil dessen vorweg, was man in den meisten später erschienenen, der Heroic Fantasy oder Sword & Sorcery zugehörigen Werken finden kann. Dass die nur für ihre Ehre und den Kampf lebenden, im wahrsten Sinne des Wortes rein hedonistischen “Helden” ein problematisches Konstrukt sind, ist unbestritten. Dass The Worm Ouroboros vor allem aufgrund seiner einzigartigen Sprache (die nur in der zweiten deutschen Übersetzung adäquat wiedergegeben wird), sowie seiner Funktion als Genrekonventionen vorwegnehmender bzw. schaffender Vorläufer eines beträchtlichen Teils der modernen Fantasy eine Wiederentdeckung – gerne mit kritischem Auge – mehr als verdient hätte, allerdings auch.
1926 veröffentliche Eddison mit Styrbiorn the Strong (dt. Styrbjörn der Starke (1996)) die Nacherzählung einer alten isländischen Sage; der nur am Ende ins Phantastische abkippende Roman ist eine Verbeugung vor seiner lebenslangen Faszination für die nordischen Sagas, der er auch mit der Übersetzung einer weiteren Saga (Egil’s Saga (1930)) noch einmal Ausdruck verliehen hat.
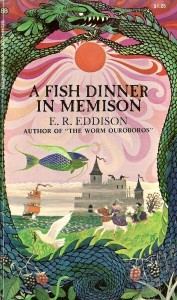 1935 erschien mit Mistress of Mistresses der erste, handlungschronologisch allerdings letzte Band der Zimiamvian Trilogy (deren Bände jedoch in beliebiger Reihenfolge gelesen werden können), sechs Jahre später gefolgt von A Fish Dinner in Memison. Der unvollendet gebliebene dritte Band The Mezentian Gate wurde erst 1958 (und damit 13 Jahre nach Eddisons Tod) veröffentlicht, und viele Jahre später gab es mit Zimiamvia: A Trilogy (1992) auch noch einen Sammelband. Die Zimiamvische Trilogie (Die Herrin Zimiamvias, Ein Fischessen in Memison (beide 1982), Das Tor des Mezentius (1983)) ist ein wesentlich komplexeres Werk als der Wurm und mit diesem einerseits durch die Figur Lessinghams, andererseits durch die Tatsache, dass Zimiamvia so etwas wie die Nachwelt oder das Jenseits Merkuriens ist, verbunden. An die Stelle heldenhafter Kämpfe treten machiavellische Intrigen und amouröse Abenteuer, wobei sich aber auch hier wieder zwei universelle Prinzipien (die Eddison Zeus und Aphrodite nennt) gegenüberstehen. Die komplizierte Handlung – in deren Verlauf unter anderem auch die Erde bzw. deren Bezug zu Zimiamvia eine Rolle spielt –, deren Hintergründe sich erst nach und nach enthüllen, lässt es um so bedauerlicher erscheinen, dass Eddison durch seinen frühen Tod weder den dritten Band fertigstellen, noch weitere (geplante) Bände der Sequenz schreiben konnte. Natürlich vertritt Eddison auch hier wieder eine fragwürdige Philosophie, in der Ruhm und Schönheit alles sind und alles andere nichts ist. Andererseits nimmt er erneut Themen vorweg, die in der Fantasy mittlerweile zu einem Teil des Standardrepertoires gehören. Und zumindest sprachlich hat er diese Themen auf seither nicht mehr erreichte Weise behandelt. Was natürlich auch bedeutet, dass Leser und Leserinnen, die von den heute aktuellen Erzählkonventionen des Genres geprägt sind, sich die Lektüre des Worm Ouroboros oder der Zimiamvian Trilogy regelrecht erarbeiten müssen. Beim Worm gibt es immerhin eine adäquate Übersetzung (die mit dem ihr vorangestellten Vorwort und den zahlreichen Anmerkungen im Text als vorbildlich für die Präsentation eines Klassikers betrachtet werden kann), die Übersetzung der Zimiamvian Trilogy wird Eddisons – im Vergleich zum Worm weniger archaischer – Sprachgewalt leider nicht ganz gerecht.
1935 erschien mit Mistress of Mistresses der erste, handlungschronologisch allerdings letzte Band der Zimiamvian Trilogy (deren Bände jedoch in beliebiger Reihenfolge gelesen werden können), sechs Jahre später gefolgt von A Fish Dinner in Memison. Der unvollendet gebliebene dritte Band The Mezentian Gate wurde erst 1958 (und damit 13 Jahre nach Eddisons Tod) veröffentlicht, und viele Jahre später gab es mit Zimiamvia: A Trilogy (1992) auch noch einen Sammelband. Die Zimiamvische Trilogie (Die Herrin Zimiamvias, Ein Fischessen in Memison (beide 1982), Das Tor des Mezentius (1983)) ist ein wesentlich komplexeres Werk als der Wurm und mit diesem einerseits durch die Figur Lessinghams, andererseits durch die Tatsache, dass Zimiamvia so etwas wie die Nachwelt oder das Jenseits Merkuriens ist, verbunden. An die Stelle heldenhafter Kämpfe treten machiavellische Intrigen und amouröse Abenteuer, wobei sich aber auch hier wieder zwei universelle Prinzipien (die Eddison Zeus und Aphrodite nennt) gegenüberstehen. Die komplizierte Handlung – in deren Verlauf unter anderem auch die Erde bzw. deren Bezug zu Zimiamvia eine Rolle spielt –, deren Hintergründe sich erst nach und nach enthüllen, lässt es um so bedauerlicher erscheinen, dass Eddison durch seinen frühen Tod weder den dritten Band fertigstellen, noch weitere (geplante) Bände der Sequenz schreiben konnte. Natürlich vertritt Eddison auch hier wieder eine fragwürdige Philosophie, in der Ruhm und Schönheit alles sind und alles andere nichts ist. Andererseits nimmt er erneut Themen vorweg, die in der Fantasy mittlerweile zu einem Teil des Standardrepertoires gehören. Und zumindest sprachlich hat er diese Themen auf seither nicht mehr erreichte Weise behandelt. Was natürlich auch bedeutet, dass Leser und Leserinnen, die von den heute aktuellen Erzählkonventionen des Genres geprägt sind, sich die Lektüre des Worm Ouroboros oder der Zimiamvian Trilogy regelrecht erarbeiten müssen. Beim Worm gibt es immerhin eine adäquate Übersetzung (die mit dem ihr vorangestellten Vorwort und den zahlreichen Anmerkungen im Text als vorbildlich für die Präsentation eines Klassikers betrachtet werden kann), die Übersetzung der Zimiamvian Trilogy wird Eddisons – im Vergleich zum Worm weniger archaischer – Sprachgewalt leider nicht ganz gerecht.
Category: Reaktionen
 Wir gedenken Boris Strugazkis, der gestern im Alter von 79 Jahren verstorben ist. Die Romane der Brüder Arkadi (1925-1991) und Boris Strugatzki gehören für mich zu den Meilensteinen meines Leselebens; ihre scharfen, klugen Satiren, ihr feiner bis absurder Humor, ihr politisches Engagement und ihre unablässige philosophische Suche nach dem Menschlichen in der Science Fiction machen sie zu den bedeutendsten Autoren der sowjetischen SF.
Wir gedenken Boris Strugazkis, der gestern im Alter von 79 Jahren verstorben ist. Die Romane der Brüder Arkadi (1925-1991) und Boris Strugatzki gehören für mich zu den Meilensteinen meines Leselebens; ihre scharfen, klugen Satiren, ihr feiner bis absurder Humor, ihr politisches Engagement und ihre unablässige philosophische Suche nach dem Menschlichen in der Science Fiction machen sie zu den bedeutendsten Autoren der sowjetischen SF.
Doch nicht nur für sowjetische Zeitgenossen waren die Strugatzkis eine Offenbarung: auch in der ehemaligen DDR sind einige Werke der Brüder (in zensierter Form) erschienen und haben kritischen Lesern ermöglicht, innerhalb einer Zensurdiktatur von einer anderen Welt und einer anderen Ordnung zu träumen. Unter dem Mantel der Science Fiction gelang es ihnen, politische und gesellschaftskritische Themen zu behandeln und in einen öffentlichen Diskurs zu bringen.
Wir laden euch ein, in unseren Strugatzki-Rezensionen zu stöbern und hineinzutauchen in das Mittagsuniversum – oder eine der vielen anderen Welten, die Boris und Arkadi Strugatzki geschaffen haben.
Bibliotheka Phantastika gratuliert Robin McKinley, die heute ihren 60. Geburtstag feiern kann. Die am 16. November 1952 in Warren, Ohio, geborene Autorin richtet ihre Geschichten in erster Linie an ein junges Publikum, hat aufgrund ihres Umgangs mit traditionellen Motiven aber auch für erwachsene LeserInnen interessante Aspekte zu bieten. McKinley gehört zu den AutorInnen, die sich vorrangig der Neufassung von (Kunst-)Märchen verschrieben haben, denen sie dabei jedoch häufig einen geerdeten, realistischen Anstrich gibt oder sie mit neuen Akzenten anreichert. Diesem Muster folgt sie bereits in ihrem ersten Roman Beauty (1978, dt. Die Schöne und das Ungeheuer (1986)), einer Nacherzählung von Die Schöne und das Biest, einem Märchen, dem sich McKinley 1997 mit Rose Daughter sogar ein zweites Mal annäherte.
Unter ihren Märchenadaptionen sticht außerdem Deerskin (1993, dt. Tochter des Schattens (1994)) hervor, das sich mit den Themen Inzest und Missbrauch befasst, vor denen eine Prinzessin nicht nur in die Wildnis, sondern auch in ein geistiges Niemandsland flieht, aus dem sie sich selbst mit der Hilfe einer Göttin retten muss.
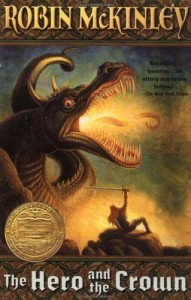 Dass McKinley mit ihren Frauenfiguren ihrer Zeit voraus war, zeigte sie auch mit ihren beiden Damar-Romanen The Blue Sword (1982, dt. Das blaue Schwert (1988) und The Hero and the Crown (1984, dt. Die Heldenkrone (1991)), die das Schicksal der jungen Harry verfolgen, die aus einem für sie ohnehin nicht sonderlich vielversprechenden Leben zwischen teetrinkende Diplomaten und Gouvernanten in einem Grenzstädtchen einer Kolonialmacht entführt wird. Beim wilden (und gar nicht so primitiven) Bergvolk macht sie eine Wandlung durch, die schließlich für beide Völker eine ausschlaggebende Rolle spielt, wird jedoch nicht zur sanftmütigen Friedensstifterin, sondern greift zur Waffe und kann sich als Kriegerin bewähren, und das ist nicht die einzige Überraschung, für die Robin McKinley in den Damar-Erzählungen (die durch zwei Kurzgeschichten ergänzt wurden) sorgt. Und auch, wenn es sich dabei nicht um Märchen-Interpretationen handelt, spielen erzählte Geschichten, Mythen und ihre Tradierung auch hier eine handlungstragende Rolle.
Dass McKinley mit ihren Frauenfiguren ihrer Zeit voraus war, zeigte sie auch mit ihren beiden Damar-Romanen The Blue Sword (1982, dt. Das blaue Schwert (1988) und The Hero and the Crown (1984, dt. Die Heldenkrone (1991)), die das Schicksal der jungen Harry verfolgen, die aus einem für sie ohnehin nicht sonderlich vielversprechenden Leben zwischen teetrinkende Diplomaten und Gouvernanten in einem Grenzstädtchen einer Kolonialmacht entführt wird. Beim wilden (und gar nicht so primitiven) Bergvolk macht sie eine Wandlung durch, die schließlich für beide Völker eine ausschlaggebende Rolle spielt, wird jedoch nicht zur sanftmütigen Friedensstifterin, sondern greift zur Waffe und kann sich als Kriegerin bewähren, und das ist nicht die einzige Überraschung, für die Robin McKinley in den Damar-Erzählungen (die durch zwei Kurzgeschichten ergänzt wurden) sorgt. Und auch, wenn es sich dabei nicht um Märchen-Interpretationen handelt, spielen erzählte Geschichten, Mythen und ihre Tradierung auch hier eine handlungstragende Rolle.
McKinley, die heute in Großbritannien bei ihrem Ehemann Peter Dickinson lebt, mit dem sie gemeinsam die Anthologien Water und Fire (beide 2009) veröffentlicht hat, ist den Märchenmotiven und starken Frauenfiguren über Jahre hinweg treu geblieben. 2003 veröffentlichte sie mit Sunshine (dt. Atem der Nacht, 2010), der Geschichte einer unwahrscheinlichen Annäherung zwischen einer Bäckerin und einem Vampir, zwei Jahre vor Twilight einen Roman mit sehr ähnlicher Thematik, die jedoch eine völlig andere Umsetzung erfährt und eine symbiotische, anfangs zweckmäßige Beziehung in den Mittelpunkt der auf einer Parallelwelt angesiedelten Handlung stellt. Für den Roman steht auch eine Fortsetzung im Raum, allerdings hat sich McKinley aktuell erst einmal wieder den jüngeren LeserInnen mit einer Affinität für Fabelwesen zugewandt (Dragon Haven (2007) und Pegasus (2010)).
Bibliotheka Phantastika gratuliert Frank Rehfeld, der heute 50 Jahre alt wird. Wie viele seiner Kollegen und Kolleginnen, die in den 80er Jahren oder früher damit begannen, Horror, SF oder Fantasy zu schreiben, hat auch der am 14. November 1962 in Viersen geborene Frank Rehfeld seine ersten schriftstellerischen Gehversuche im Bereich des Heftromans gemacht, wo in der Reihe Silber Grusel Krimi 1984 sein Erstling “Das unheimliche Glasauge” erschien – und zwar wie es sich damals für die Heftszene gehörte unter einem knackigen Pseudonym: Frank Thys. Dieses Pseudonym verwendete er nicht nur für weitere Romane in der gleichen Reihe, sondern u.a. auch für seine beiden Romane zur Bastei-Reihe Fantasy (1985/86) und seine Beiträge zur (vom Erfolg der Indiana-Jones-Filme inspirierten) Serie Die Abenteurer – Auf der Suche nach den letzten Rätseln der Erde (1992/93).
Unter seinem richtigen Namen steuerte Frank Rehfeld vier Romane zur kurzlebigen SF-Heftserie Star Gate – Tor zu den Sternen bei (die nichts mit dem gleichnamigen Roland-Emmerich-Film bzw. der sich daran anschließenden TV-Serie zu tun hat), und ganz ohne Namensnennung war er an der offiziell und hauptsächlich von Wolfgang Hohlbein verfassten Serie Der Hexer beteiligt.
Die Bekanntschaft mit Wolfgang Hohlbein, mit dem er bis heute befreundet ist, sollte aber noch andere Folgen haben, denn 1987/88 verfasste er zusammen mit Hohlbein fünf Bände der sechsteiligen Saga von Garth und Torian und kam damit zu seinen ersten Veröffentlichungen im Taschenbuch, denen bald weitere folgen sollten. Nach dem Fantasy-Zweiteiler Arcana (Das Tal der schwarzen Bestien (1990) und Die Zitadelle am Rande der Welt (1991)) verlegte sich Rehfeld von wenigen Ausnahmen abgesehen jedoch zunächst einmal auf das Verfassen von Romanen zu Fernsehserien wie Knight Rider, Hercules und anderen.
1999 kehrte er mit dem wieder zweiteiligen Zyklus Die Legende von Arcana zur Fantasy zurück. Die Dämmerschmiede (1999) ist dabei ein Prequel zu den Anfang der 90er Jahre erschienenen Romanen, während es sich bei Die Drachenpriester (2000) um eine deutlich 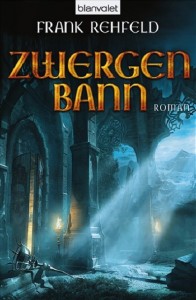 überarbeitete Version besagter Romane handelt. 2006 folgte mit Blue Moon ein Roman zum gleichnamigen Fantasy-Kartenspiel, und 2009 erschien mit Zwergenfluch der Auftakt einer mehrbändigen Saga, in der er sich einem der seit einigen Jahren vor allem in Deutschland beliebten “Tolkien-Völker” zuwandte und die alte Mär von den Zwergen, die zu tief graben, damit abwandelte, dass sie sich in ihrer unterirdischen Welt einer übermächtigen und zunächst fremdartigen Bedrohung gegenübersehen. Nach einer ersten, mit Zwergenbann (2009) und Zwergenblut (2010) fortgesetzten Trilogie, die sich dem abenteuerlichen Überlebenskampf der kurzbeinigen Helden widmete, folgten mit Elbengift (2011) und Elbensturm (2012) die ersten beiden Bände einer zweiten Trilogie, in der nicht nur die Elben und ihre Geschichte eine prominentere Rolle einnehmen, sondern Frank Rehfeld auch wieder zum bereits in früheren Werken aufgegriffenen Thema der Welten- und Dimensionstore zurückkehrt. Und falls die Heldentaten des bärbeißigen Zwergenkriegers Barlok damit zu Ende erzählt sein sollten, lässt das nächste phantastische Abenteuer sicher nicht lange auf sich warten. In diesem Sinne – herzlichen Glückwunsch, Frank!
überarbeitete Version besagter Romane handelt. 2006 folgte mit Blue Moon ein Roman zum gleichnamigen Fantasy-Kartenspiel, und 2009 erschien mit Zwergenfluch der Auftakt einer mehrbändigen Saga, in der er sich einem der seit einigen Jahren vor allem in Deutschland beliebten “Tolkien-Völker” zuwandte und die alte Mär von den Zwergen, die zu tief graben, damit abwandelte, dass sie sich in ihrer unterirdischen Welt einer übermächtigen und zunächst fremdartigen Bedrohung gegenübersehen. Nach einer ersten, mit Zwergenbann (2009) und Zwergenblut (2010) fortgesetzten Trilogie, die sich dem abenteuerlichen Überlebenskampf der kurzbeinigen Helden widmete, folgten mit Elbengift (2011) und Elbensturm (2012) die ersten beiden Bände einer zweiten Trilogie, in der nicht nur die Elben und ihre Geschichte eine prominentere Rolle einnehmen, sondern Frank Rehfeld auch wieder zum bereits in früheren Werken aufgegriffenen Thema der Welten- und Dimensionstore zurückkehrt. Und falls die Heldentaten des bärbeißigen Zwergenkriegers Barlok damit zu Ende erzählt sein sollten, lässt das nächste phantastische Abenteuer sicher nicht lange auf sich warten. In diesem Sinne – herzlichen Glückwunsch, Frank!
Bibliotheka Phantastika erinnert an Naomi Mitchison, die heute 115 Jahre alt geworden wäre. Auch wenn ihr Name hierzulande vermutlich bereits wieder in Vergessenheit geraten ist, dürfte kein Zweifel daran bestehen, dass Naomi Mitchison (geboren am 01. November 1897 in Edinburgh, Schottland, als Naomi Margaret Mary Haldane) zu den originellsten und wichtigsten englischsprachigen Autorinnen des 20. Jahrhunderts zu zählen ist. In ihrem langen Leben hat sie ein umfangreiches Werk geschaffen, dem bislang auch im englischen Sprachraum nicht die kritische Würdigung zuteil geworden ist, die es verdient hätte – was nicht zuletzt damit zusammenhängen könnte, dass Mitchison als überzeugte Feministin und Sozialistin Positionen vertreten hat, mit denen sie sich beim konservativen Establishment nicht unbedingt beliebt gemacht hat.
In besagtem umfangreichen Werk finden sich auch einige Romane und Erzählungen mit mehr oder minder starken phantastischen Elementen, etwa gleich in ihrem Erstling The 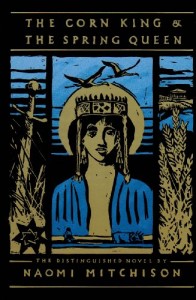 Conquered (1923; dt. Jenseits des Sieges (1952)), einem historischen Roman über die Eroberung Galliens durch Caesar, in dem ein Seher weit mehr ist als er scheint. Auch The Corn King and the Spring Queen (1931; dt. Kornkönig und Frühlingsbraut (1985)) ist ein historischer Roman mit Fantasyelementen. Die Geschichte der Hexe Erif Dher und ihres anfangs ungeliebten Ehemannes, des Kornkönigs Tarrik, die es aus ihrem an der Küste des Schwarzen Meeres gelegenen (fiktiven) Königreich Marob ins Sparta des dritten vorchristlichen Jahrhunderts verschlägt, dürfte nicht nur einer der ersten historischen Fantasyromane überhaupt sein, sondern auch ein zu Unrecht unterschätzter Klassiker des Genres. Etliche von Mitchisons Stories mit phantastischem Einschlag finden sich in der Sammlung The Fourth Pig (1936), während die Sammlung Images of Africa (1980; dt. Geschichten aus Afrika (1986)) phantastische Erzählungen enthält, die im Stil alter Volkssagen verfasst sind.
Conquered (1923; dt. Jenseits des Sieges (1952)), einem historischen Roman über die Eroberung Galliens durch Caesar, in dem ein Seher weit mehr ist als er scheint. Auch The Corn King and the Spring Queen (1931; dt. Kornkönig und Frühlingsbraut (1985)) ist ein historischer Roman mit Fantasyelementen. Die Geschichte der Hexe Erif Dher und ihres anfangs ungeliebten Ehemannes, des Kornkönigs Tarrik, die es aus ihrem an der Küste des Schwarzen Meeres gelegenen (fiktiven) Königreich Marob ins Sparta des dritten vorchristlichen Jahrhunderts verschlägt, dürfte nicht nur einer der ersten historischen Fantasyromane überhaupt sein, sondern auch ein zu Unrecht unterschätzter Klassiker des Genres. Etliche von Mitchisons Stories mit phantastischem Einschlag finden sich in der Sammlung The Fourth Pig (1936), während die Sammlung Images of Africa (1980; dt. Geschichten aus Afrika (1986)) phantastische Erzählungen enthält, die im Stil alter Volkssagen verfasst sind.
Travel Light (1952; dt. Eine Reise durch die Zeit (1987)) ist ein sowohl inhaltlich wie sprachlich zauberhafter Fantasyroman, der die Reise der von ihrer Stiefmutter ungeliebten Königstochter Halla durch ein von Bären, Drachen, Zwergen und Trollen bewohntes nordisches Märchenland schildert und dabei auf liebevolle Weise allzu abgenutzte Fantasyklischees parodiert, während To the Chapel Perilous (1955; dt. König Artus lässt schön grüßen (1986)) eine originelle, ein bisschen postmoderne Adaption des Artus-Mythos darstellt, in der die Medien eine ungewohnt große Rolle spielen, und Early in Orcadia (1987) eine in prähistorischer Zeit auf den den Orkney-Inseln angesiedelte Geschichte erzählt.
Schon 1935 hatte Naomi Mitchison sich mit We Have Been Warned im Gewand eines Near-Future-Thrillers, in dem es um die Unterdrückung der englischen Linken geht, der SF zumindest halbwegs zugewandt. Bei Memoirs of a Space Woman (1962; dt. Memoiren einer Raumfahrerin (1980)) den Erinnerungen der Kommunikationsspezialistin Mary, die auf immer neuen Planeten mit Aliens der unterschiedlichsten Couleur Kontakt aufnehmen muss, handelt es sich dann ebenso um lupenreine SF, wie bei Solution Three (1975; dt. Lösung Drei (1984)) – hier geht es um Klone auf einer ziemlich kaputten Erde – und Not By Bread Alone (1983), in dem die Probleme geschildert werden, die aus der kostenlosen Verteilung von Nahrungsmitteln überall auf der Welt entstehen.
Naomi Mitchisons Romane und Erzählungen waren fast immer Vehikel ihrer Überzeugungen und Ideen, was ihnen häufig einen allegorischen Charakter verleiht. Dessen ungeachtet hat die am 11. Januar 1999 im gesegneten Alter von 101 Jahren verstorbene Autorin sich in vielen Fällen mit Themen befasst, die auch heute noch interessant sind. Und gelegentlich sind ihr – etwa mit The Corn King and the Spring Queen, Travel Light, To the Chapel Perilous oder Memoirs of a Space Woman – sogar kleine Meisterwerke gelungen.
Bibliotheka Phantastika erinnert an Grahame Wright, der heute 65 Jahre alt geworden wäre. Deutschsprachige Leser und Leserinnen, denen der Name nichts sagt, befinden sich in bester Gesellschaft, denn hierzulande dürfte der am 30. Oktober 1947 in Leicester, Leicestershire, England, geborene Wright gänzlich unbekannt sein – was nicht weiter verwunderlich ist, schließlich hat er nur einen einzigen Roman veröffentlicht, der zudem nie auf Deutsch erschienen ist. Doch auch in seinem Heimatland bzw. im englischen Sprachraum ist Wright mehr oder weniger vergessen, und es sind praktisch keine Informationen über ihn zu finden. Immerhin lässt sich sein 1974 erschienener, 1977 als TB – und danach nie mehr – nachgedruckter Roman Jog Rummage noch problemlos antiquarisch auftreiben.
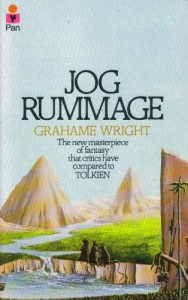 Und das wiederum ist ein Glücksfall für alle Leser und Leserinnen, die bereit sind, sich auf ein ungewöhnliches – und ziemlich einzigartiges – Leseerlebnis einzulassen, denn Jog Rummage ist ein kleines Juwel des Genres. Rummage, der titelgebende Held der Geschichte und klügste aller Jogs, ein Dichter und Gelehrter, der seine Welt mit neugierigen Augen und hellwachem Geist betrachtet, lebt zusammen mit seinem besten Freund Geovard, dem tapfersten aller Krieger, und den übrigen Jogs am Ufer der “gently lapping sea”, die in einer merkwürdigen, düsteren, vom “Moon” und dem “Great Star” erhellten und immer wieder von “Swoops” bedrohten Welt, die Jogs und ihre traditionellen Feinde, die Rats, voneinander trennt. Als diese Feindschaft zum Krieg eskaliert, ist es an Rummage und Geovard, diesen Krieg zu beenden – nur, um anschließend gemeinsam mit Meltamor, dem “Emperor of Rats”, in die Dunkelheit aufzubrechen und das Rätsel der gefährlichen Swoops und des Monsters Horribilis zu lösen. Parallel dazu erzählt Jog Rummage die Geschichte von Elizabeth, einem in mehrfacher Hinsicht schwer gezeichneten jungen Mädchen mit reger Phantasie, und ihrem Vater, dem das Leben ebenfalls übel mitgespielt hat. Natürlich berühren sich die beiden Geschichten – und das hat Konsequenzen …
Und das wiederum ist ein Glücksfall für alle Leser und Leserinnen, die bereit sind, sich auf ein ungewöhnliches – und ziemlich einzigartiges – Leseerlebnis einzulassen, denn Jog Rummage ist ein kleines Juwel des Genres. Rummage, der titelgebende Held der Geschichte und klügste aller Jogs, ein Dichter und Gelehrter, der seine Welt mit neugierigen Augen und hellwachem Geist betrachtet, lebt zusammen mit seinem besten Freund Geovard, dem tapfersten aller Krieger, und den übrigen Jogs am Ufer der “gently lapping sea”, die in einer merkwürdigen, düsteren, vom “Moon” und dem “Great Star” erhellten und immer wieder von “Swoops” bedrohten Welt, die Jogs und ihre traditionellen Feinde, die Rats, voneinander trennt. Als diese Feindschaft zum Krieg eskaliert, ist es an Rummage und Geovard, diesen Krieg zu beenden – nur, um anschließend gemeinsam mit Meltamor, dem “Emperor of Rats”, in die Dunkelheit aufzubrechen und das Rätsel der gefährlichen Swoops und des Monsters Horribilis zu lösen. Parallel dazu erzählt Jog Rummage die Geschichte von Elizabeth, einem in mehrfacher Hinsicht schwer gezeichneten jungen Mädchen mit reger Phantasie, und ihrem Vater, dem das Leben ebenfalls übel mitgespielt hat. Natürlich berühren sich die beiden Geschichten – und das hat Konsequenzen …
Man hat von Verlagsseite diesem nicht allzu umfangreichen Roman gewiss keinen Gefallen getan, als man ihn auf dem Titelbild der TB-Ausgabe als “The new masterpiece of fantasy that critics have compared to Tolkien” bezeichnet hat, denn mit J.R.R. Tolkien und seiner Art von Fantasy hat Jog Rummage eher wenig gemein. Da wären Namen wie Richard Adams oder Mervyn Peake denn doch etwas passender gewesen. Obwohl man Wright auch damit nicht ganz gerecht werden würde, denn allen echten oder vermeintlichen Parallelen oder Einflüssen zum Trotz ist Jog Rummage ein überaus eigenständiges, in vielerlei Hinsicht einzigartiges Werk, das auch sprachlich überzeugt und Themen anschneidet, die in der Fantasy ansonsten selten behandelt wurden und werden.
Grahame Wright war knapp 27, als Jog Rummage veröffentlicht wurde. Der Roman mag noch kein echtes Meisterwerk sein, aber ein vielversprechender Auftakt zur Karriere eines Autors, dem man nach diesem Erstling allerhand hätte zutrauen können, ist er allemal. Doch Wright hat keinen zweiten Roman geschrieben. Er hat noch nicht einmal mehr das Erscheinen der TB-Ausgabe erlebt, denn am 10. April 1977 ist er – noch keine 30 Jahre alt – verstorben.
 Bibliotheka Phantastika gratuliert Stephen King, der heute 65 Jahre alt wird. Als der am 21. September 1947 geborene King 1977 seinen ersten Roman Carrie veröffentlichte, ahnte vermutlich noch niemand, dass er einer der weltweit bekanntesten Autoren im Horror- und Phantastikbereich werden würde. Mit derzeit mehr als 60 veröffentlichten Roman, einer ebenfalls großen Anzahl Kurzgeschichten und etlichen Verfilmungen seiner Werke, ist Stephen King nicht mehr aus den Köpfen der Menschen wegzudenken.
Bibliotheka Phantastika gratuliert Stephen King, der heute 65 Jahre alt wird. Als der am 21. September 1947 geborene King 1977 seinen ersten Roman Carrie veröffentlichte, ahnte vermutlich noch niemand, dass er einer der weltweit bekanntesten Autoren im Horror- und Phantastikbereich werden würde. Mit derzeit mehr als 60 veröffentlichten Roman, einer ebenfalls großen Anzahl Kurzgeschichten und etlichen Verfilmungen seiner Werke, ist Stephen King nicht mehr aus den Köpfen der Menschen wegzudenken.
Anlässlich seines heutigen Geburtstags haben wir ihm daher ein wohlverdientes Autoren-Portrait in der Bibliotheka Phantastika spendiert, und die wichtigsten Eckdaten seiner Karriere für alle Neugierigen noch einmal zusammen gefasst.
Bibliotheka Phantastika gratuliert Patrick O’Leary, der heute 60 Jahre alt wird. Als der am 13. September in Saginaw, Michigan, geborene O’Leary um die Jahrtausendwende herum mit drei Romanen und einer Handvoll Kurzgeschichten ins Rampenlicht trat, wurde er von vielen Kritikern als einer der vielversprechendsten neuen SF- und Fantasyautoren bezeichnet, dem eine große Karriere prophezeit oder zumindest zugetraut wurde.
O’Learys Erstling, der ebenso bizarre wie originelle Zeitreiseroman Door Number Three (1995; dt. Die dritte Tür (1998)) macht es seiner Leserschaft durch die sprunghafte, nicht durchgehend chronologisch erzählte Handlung allerdings nicht leicht.
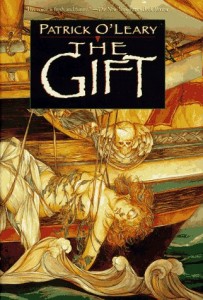 Zwei Jahre später folgte The Gift (dt. Hüter der Nacht (2000)), und dieser Fantasyroman (mit einer angedeuteten SF-Komponente) ist nicht nur deutlich zugänglicher, sondern auch ganz anders, als man es nach Door Number Three vielleicht erwartet hätte – und eines der zu Unrecht übersehenen Juwelen des Genres. Dabei fängt The Gift ganz harmlos damit an, dass auf einem Segelschiff in einer Flaute ein Mann – der einfach nur “the Teller” bzw. “der Erzähler” genannt wird – den Seeleuten eine Geschichte zu erzählen beginnt. Sie handelt von Ungeheuern und von einem Alchimisten, der das Böse zu neuem Leben erweckt hat und anschließend als sein Hüter mit ihm durch die Welt zieht. Und von Simon und Tim, zwei jungen Männern, die aus unterschiedlichen, aber jeweils nachvollziehbaren Gründen den Hüter bekämpfen wollen – was sich als weit schwieriger erweist, als anfangs gedacht. Was auf den ersten Blick nach einem Standardplot klingt, erweist sich in der Umsetzung – die durch unzählige Abschweifungen und teilweise völlig zusammenhanglos wirkende, eingeflochtene Anekdoten des Erzählers gekennzeichnet ist – als clever konstruierte Erzählung, die sich ganz zentral der Frage widmet, welche Bedeutung Geschichten für den Menschen haben. The Gift mag leise und unspektakulär scheinen, aber der Roman lotet die Möglichkeiten des Genres deutlich mehr aus als viele wesentlich bombastischer daherkommende Werke.
Zwei Jahre später folgte The Gift (dt. Hüter der Nacht (2000)), und dieser Fantasyroman (mit einer angedeuteten SF-Komponente) ist nicht nur deutlich zugänglicher, sondern auch ganz anders, als man es nach Door Number Three vielleicht erwartet hätte – und eines der zu Unrecht übersehenen Juwelen des Genres. Dabei fängt The Gift ganz harmlos damit an, dass auf einem Segelschiff in einer Flaute ein Mann – der einfach nur “the Teller” bzw. “der Erzähler” genannt wird – den Seeleuten eine Geschichte zu erzählen beginnt. Sie handelt von Ungeheuern und von einem Alchimisten, der das Böse zu neuem Leben erweckt hat und anschließend als sein Hüter mit ihm durch die Welt zieht. Und von Simon und Tim, zwei jungen Männern, die aus unterschiedlichen, aber jeweils nachvollziehbaren Gründen den Hüter bekämpfen wollen – was sich als weit schwieriger erweist, als anfangs gedacht. Was auf den ersten Blick nach einem Standardplot klingt, erweist sich in der Umsetzung – die durch unzählige Abschweifungen und teilweise völlig zusammenhanglos wirkende, eingeflochtene Anekdoten des Erzählers gekennzeichnet ist – als clever konstruierte Erzählung, die sich ganz zentral der Frage widmet, welche Bedeutung Geschichten für den Menschen haben. The Gift mag leise und unspektakulär scheinen, aber der Roman lotet die Möglichkeiten des Genres deutlich mehr aus als viele wesentlich bombastischer daherkommende Werke.
Zu Anfang des neuen Jahrtausends folgte Other Voices, Other Doors (2001; eine Sammlung von Kurzgeschichten und Essays) und ein Jahr später mit The Impossible Bird (2002) ein zweiter, wiederum recht abgedrehter SF-Roman. Danach wurde es lange Zeit still um Patrick O’Leary; erst 2009 erschien mit The Black Heart ein weiterer Band mit Kurzgeschichten quer durch alle Genres. Aus der O’Leary prophezeiten großen Karriere ist – zumindest bis jetzt – noch nichts geworden, was möglicherweise auch daran liegt, dass er keine Serien oder Zyklen schreibt und sich seine Themen fernab des gerade angesagten Mainstreams sucht. Gerade das könnte ihn wiederum für manche Leser und Leserinnen interessant machen.
Vor etwas über einer Woche hat London das Rennen um die Austragung des Worldcon 2014 gemacht. Nun ist da zwar noch ein ganzes Weilchen hin, aber man kann sich schon mal freuen und Pläne schmieden.
Zum letzten Mal wurde der Worldcon 2005 in Europa abgehalten, genauer gesagt in Glasgow, das heißt also, dass man in der Regel nur einmal pro Jahrzehnt die Gelegenheit zur Teilnahme hat, wenn man nicht gleich extra über den großen Teich fliegen will.
Was und wen gibt es da zu sehen?
AutorInnen aus aller Welt, naheliegenderweise wohl zum Großteil britische, aber auch an europäischen Worldcons nehmen erstaunlich viele US-AutorInnen teil, halten Lesungen, sitzen in Panels und Diskussionsrunden zu allen erdenklichen Themen rund um SF und Fantasy, geben Autogramme und stehen zum Gespräch bereit. Eine Artshow, Veranstaltungen zu Themen über dem Tellerrand (wie Comics, Filme oder Rollenspiel), Abendveranstaltungen mit Kostümprämierung und anderem Schnickschnack und Partys gehören mit Sicherheit auch wieder zum Programm. Außerdem wird natürlich der Hugo-Award verliehen (und als Teilnehmer gehört man zu den Abstimmenden). Dank der anwesenden Händler kommt man auch garantiert mit einem Koffer voller Bücher nach Hause zurück.
Ich war auch 2005 in Glasgow und schreibe mir den Termin vom 14.-18. August 2014 bestimmt in den Kalender: die amerikanische Fan-Kultur, die zu diesem Ereignis in abgemilderter Form zu uns herüberschwappt (und nur bedingt mit Cons hierzulande vergleichbar ist), muss man einmal (oder eben auch zweimal) erlebt haben. Genauso wie die vielen Gespräche mit Gleichgesinnten, die man dort führen kann, Treffen mit Leuten, die man sonst nur aus Foren & Co. kennt, Begegnungen mit einer Lieblingsautorin beim Frühstück, weil sie im selben Hotel wie man selbst nächtigt, oder am Vorabend direkt vor George R.R. Martin in der Registrierungsschlange zu stehen – und von dem neuen Input, das man aus Fragestunden, Diskussionen und Gesprächen mit nach Hause nimmt, wird man vermutlich noch eine ganze Weile zehren.
Bis für 2014 das Programm und eine vollständigere Gästeliste erscheinen, wird es noch eine Weile dauern – verfolgen kann man das unter anderem auf der Webseite zum Loncon 3. Bibliotheka Phantastika wird auf jeden Fall mit einem Reporterteam vertreten sein. Wer kommt noch?
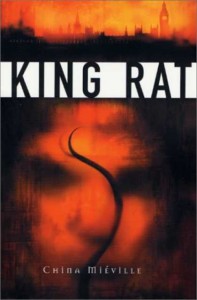 Mit einem Tag Verspätung gratuliert die Bibliotheka Phantastika China Miéville, der gestern seinen 40. Geburtstag feierte.
Mit einem Tag Verspätung gratuliert die Bibliotheka Phantastika China Miéville, der gestern seinen 40. Geburtstag feierte.
Der mit King Rat bekannt gewordene Autor wurde am 06. September 1972 in England geboren. Er fällt immer wieder durch seine ungewöhnlichen Settings und Charaktere auf, verweigert sich der eskapistischen Konzeption von Fantasy und arbeitet daran, ein Buch in jedem Genre abzuliefern.
Fans von Miéville wissen die Qualitäten seiner ungewöhnlichen Erzählungen längst zu schätzen, daher empfehlen wir Neulingen (aber auch Fans, die gerne mehr über den Autor erfahren möchten) einen dringenden Blick in das ausführliche Portrait dieses Autors!