Bibliotheka Phantastika erinnert an William Morris, dessen Geburtstag sich heute zum 180. Mal jährt. Der am 24. März 1834 in Walthamstow, Essex, geborene William Morris war vieles – Autor, Dichter und Künstler, Verleger und enger Freund der Präraffaeliten um Dante Gabriel Rossetti und Edward Burne-Jones, Mitbegründer der englischen Socialist League und Verfasser der sozialistischen Utopie News from Nowhere, or An Epoch of Rest (1890; dt. Kunde von 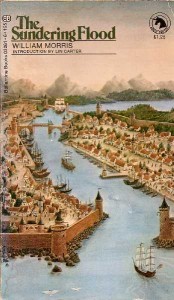 Nirgendwo (1900) und gerade erst von einem unserer Lieblingsverlage neu aufgelegt) – doch an dieser Stelle soll uns nur seine Rolle als einer der unumstrittenen Gründerväter der modernen Fantasy interessieren. Wobei das eine sich nicht so ohne weiteres vom anderen trennen lässt, denn einer der Gründe, warum Morris in seinen letzten Lebensjahren Werke geschaffen hat, die man mit einer gewissen Berechtigung als eskapistische Wunscherfüllungsphantasien bezeichen könnte, dürfte vermutlich seine Enttäuschung über die Entwicklung der englischen sozialistischen Bewegung gewesen sein.
Nirgendwo (1900) und gerade erst von einem unserer Lieblingsverlage neu aufgelegt) – doch an dieser Stelle soll uns nur seine Rolle als einer der unumstrittenen Gründerväter der modernen Fantasy interessieren. Wobei das eine sich nicht so ohne weiteres vom anderen trennen lässt, denn einer der Gründe, warum Morris in seinen letzten Lebensjahren Werke geschaffen hat, die man mit einer gewissen Berechtigung als eskapistische Wunscherfüllungsphantasien bezeichen könnte, dürfte vermutlich seine Enttäuschung über die Entwicklung der englischen sozialistischen Bewegung gewesen sein.
Einen allerersten Prosa-Ausflug in zumindest so etwas Ähnliches wie Fantasy-Gefilde hatte Morris allerdings schon sehr viel früher mit der allegorisch angehauchten Geschichte “The Hollow Land” (1856; dt. “Das hohle Land” (1985)) unternommen, und auch The House of the Wolfings (1889) und The Roots of the Mountains (1889) – zwei noch in einem pseudo-historischen Setting angesiedelte Romane, in denen sich stilistisch und inhaltlich bereits andeutete, wohin die Reise wenig später gehen sollte – sind noch vor News from Nowhere – jenem Werk, in dem er seinen Ideen von einem idealen sozialistischen Staat in Romanform Ausdruck verliehen hat – erschienen.
Doch erst The Story of the Glittering Plain, or the Land of Living Men (1891; dt. Das schimmernde Land (1985)) lässt sich trotz der nordischen Namen und Elemente als Fantasy im modernen Sinne betrachten, denn die Geschichte spielt zumindest teilweise in einer Sekundär- oder Anderswelt. Das titelgebende schimmernde Land ist ein von Unsterblichen bewohntes Utopia, das angeblich nur schwer zu erreichen ist. Letzteres gelingt dem Helden Hallblithe allerdings erstaunlich leicht – doch vor Ort erweist sich das Utopia alsbald mehr als ein Gefängnis als alles andere, sodass Hallblithe alles daran setzt, das Land, das so lange das Ziel seiner Träume war, so schnell wie möglich wieder zu verlassen.
Auch Walter, der Held von The Wood Beyond the World (1894; dt. Die Zauberin jenseits der Welt (1984)), verlässt seine Heimatstadt, um in jenes Land zu gelangen, das er zu Hause in seinen Visionen gesehen hat, und wie in The Glittering Plain sind die fantastischen Gefilde nur mittels einer Seereise zu erreichen. Als er – nach einem Schiffbruch und einer langen Reise über Berge und durch Wüsten – dort ankommt, verstrickt er sich rasch in das Beziehungsgeflecht aus der über Hexenkräfte verfügenden Herrscherin, ihrem zwergenhaften Diener, ihrer jungen Schutzbefohlenen und ihrem derzeitigen Liebhaber, der wie Walter ein Auge auf die junge Maid geworfen hat. Nach einigem Hin und Her gelingt es Walter und der jungen Maid zu fliehen … und kurz darauf geraten sie ganz zufällig in eine Stadt, deren Bevölkerung geschworen hat, den nächsten Fremden, der dort auftaucht, zu ihrem König zu machen.
In seinem nächsten Roman The Well at the World’s End (1896; dt. Die Quelle am Ende der Welt (1981)) sollte William Morris nicht nur die Schwächen – wie etwa das allzu aufgesetzt wirkende Ende – von The Wood Beyond the World überwinden, sondern er stattete den Roman darüber hinaus mit einer geschlossenen einheitlichen Geographie aus, statt die magischen Gefilde an bisher unbekannten Küsten unserer Welt anzusiedeln. The Well at the World’s End erzählt die Geschichte von Ralph, dem jüngsten Sohn des ziemlich bedeutungslosen Königs von Upmead, der auszieht, um Ruhm und Ehre zu gewinnen, und dem es – nachdem er viele Hindernisse überwunden und ebensoviele Abenteuer überstanden hat – nicht nur gelingt, aus der titelgebenden Quelle (deren Wasser eine lebensverlängernde Wirkung hat) zu trinken, sondern auch mit einer angemessenen Gemahlin heimzukehren. Doch ehe er triumphal heimkehren kann, muss er in die entlegensten Winkel der Welt reisen, und auch die Magie, die anfangs kaum wahrzunehmen ist, spielt zeitweise eine wesentlich größere Rolle. Am Ende fügt sich schließlich alles zusammen – alles, was Ralph auf seinem Weg zur Quelle getan hat, erlangt eine eigene Bedeutung und führt zu Entwicklungen, die seine Heimkehr in jeder Hinsicht zu einem Triumhzug machen und dem Buch zu einem mehr als befriedigenden Abschluss verhelfen.
The Well at the World’s End sollte der letzte seiner Fantasyromane sein, dessen Veröffentlichung Morris noch miterleben konnte, denn The Water of the Wondrous Isles (1897) und The Sundering Flood (1897; dt. Das Reich am Strom (1980)) wurden erst nach seinem Tod am 03. Oktober 1896 veröffentlicht. Keiner von beiden kann mit einem ähnlich phantastischen Panorama aufwarten, bei dem dem Land eine ähnlich tragende Rolle zuteil wird, wie dies bei The Well at the World’s End der Fall war. Während die “wundersamen Inseln” in einem großen See liegen 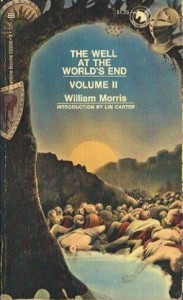 und eher wie Fremdkörper als wie ein Teil eines großen, einheitlichen Weltentwurfs wirken, geht es in The Sundering Flood um ein vom deutschen Titel sehr treffend bezeichnetes, überschaubares pseudo-mittelalterliches Reich an einem Strom. Immerhin gibt es in The Water of the Wondrous Isles etliche phantastische Elemente wie ein quasi von Geisterhand angetriebenes Boot oder eine gestaltwandlerische Hexe, die die Angewohnheit hat, ihr missfallende Menschen in Tiere zu verwandeln, wohingegen der Fantasygehalt von The Sundering Flood eher marginal ist, wenn man von Dingen wie dem nicht alternden Mentor des Helden oder seinem magischen Schwert absieht.
und eher wie Fremdkörper als wie ein Teil eines großen, einheitlichen Weltentwurfs wirken, geht es in The Sundering Flood um ein vom deutschen Titel sehr treffend bezeichnetes, überschaubares pseudo-mittelalterliches Reich an einem Strom. Immerhin gibt es in The Water of the Wondrous Isles etliche phantastische Elemente wie ein quasi von Geisterhand angetriebenes Boot oder eine gestaltwandlerische Hexe, die die Angewohnheit hat, ihr missfallende Menschen in Tiere zu verwandeln, wohingegen der Fantasygehalt von The Sundering Flood eher marginal ist, wenn man von Dingen wie dem nicht alternden Mentor des Helden oder seinem magischen Schwert absieht.
Was William Morris – dessen Werke sowohl C.S. Lewis wie auch J.R.R. Tolkien nach eigener Aussage beeinflusst haben – in die Fantasy eingebracht hat, ist das Motiv der Queste – und die Welt (das englische Landscape trifft es wesentlich besser – man bedenke auch die Bedeutung und Häufigkeit von Landschaftsdarstellungen auf den Titelbildern vor allem englischer Fantasyromane in den 70er, 80er und 90er Jahren), die in ihrer Beschaffenheit und Gesamtheit eine wesentliche Rolle in der Geschichte spielt. Stilistisch sind vor allem seine ersten beiden dem Genre zuzurechnenden Romane für heutige Verhältnisse ziemlich harter Stoff, weil er sich in ihnen noch an einem “mittelalterlichen”, an Thomas Malory angelehnten Sprach- und Erzählduktus versucht. The Well at the World’s End hingegen ist auch heute noch mit Vergnügen lesbar, wenn man bereit ist, sich auf eine gewisse Langatmigkeit und Märchenhaftigkeit einzulassen und mit Figuren zu leben, deren Charaktereigenschaften recht überschaubar sind.
In den USA hat es William Morris vor allem Lin Carter und der Ballantine-Adult-Fantasy-Reihe zu verdanken, dass seine Werke Ende der 60er/Anfang der 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts noch einmal ins Blickfeld der Öffentlichkeit gerückt wurden. Und dass es immerhin vier seiner fünf Fantasyromane zu einer Übersetzung ins Deutsche gebracht haben und darüberhinaus mit Die goldene Maid (1986) noch ein Sammelband mit Erzählungen erschienen ist, bei dem es sich um eine Originalzusammenstellung zu handeln scheint, ist beeindruckend. Es zeigt allerdings auch ein bisschen, wie sehr sich die Fantasylandschaft in Deutschland seit den 80er Jahren verändert hat, denn das Morris’ Werke heutzutage hier noch einmal veröffentlicht würden, scheint schlicht undenkbar.
-
Rezensionen
-
Die fünf neuesten Rezensionen
Die jüngsten Kommentare
- Carlos Feliciano on Zum 100. Geburtstag von Kenneth Bulmer
- Kevin Korak on Zum 70. Geburtstag von Bernard Cornwell
- Klassiker-Reread: Esther Rochons „Der Träumer in der Zitadelle“ (3/3) – Sören Heim – Lyrik und Prosa on Zum 65. Geburtstag von Esther Rochon
- Neiden on Zum Gedenken an Hans Bemmann
- gero on Zum 65. Geburtstag von Gillian Bradshaw

Wer Tolkien ausgeschöpft hat, wird in Morris einen gewissen Trost finden!
(bei uns hat er einen festen Platz in der Sammlung!)