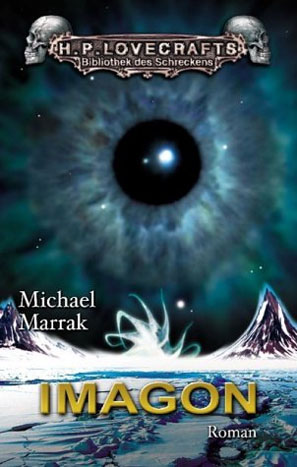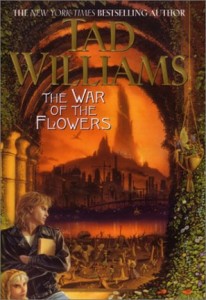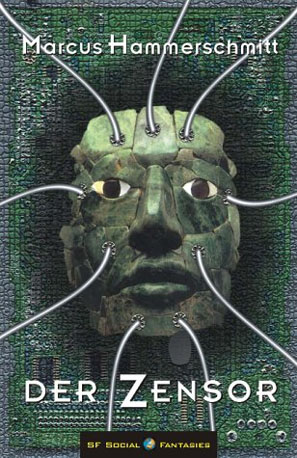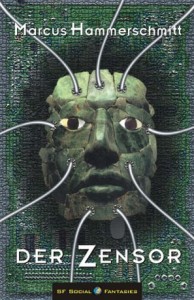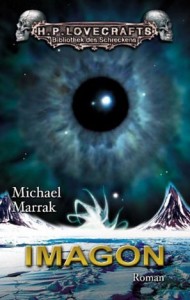 Poul Silis ist Geophysiker und hasst den Winter, den Schnee und besonders die Kälte. Doch ausgerechnet er wird nach Grönland ins ewige Eis beordert, um mit einer Gruppe von Wissenschaftlern einen mutmaßlichen Meteoriteneinschlag zu untersuchen. Zahlreiche Menschen wollen das grelle Licht eines Himmelskörpers gesehen haben, und es befindet sich auch ein riesiger Krater im Eis. Von einem Meteoriten aber gibt es keine Spur. Stattdessen werden Schrecken lebendig, die älter als die Erdgeschichte sind.
Poul Silis ist Geophysiker und hasst den Winter, den Schnee und besonders die Kälte. Doch ausgerechnet er wird nach Grönland ins ewige Eis beordert, um mit einer Gruppe von Wissenschaftlern einen mutmaßlichen Meteoriteneinschlag zu untersuchen. Zahlreiche Menschen wollen das grelle Licht eines Himmelskörpers gesehen haben, und es befindet sich auch ein riesiger Krater im Eis. Von einem Meteoriten aber gibt es keine Spur. Stattdessen werden Schrecken lebendig, die älter als die Erdgeschichte sind.
-Abscheu und Neugier. Grauen und Faszination.
Ich stand vor dem Aqunaki und kam nicht umhin, ihn unverhohlen anzustarren, im Sternenlicht jede Hautfalte zu studieren, jede seiner Bewegungen zu verfolgen und jedes Geräusch wahrzunehmen, das diese bizarre Kreatur erzeugte.-
Kap. 15., S. 271
Imagon aus der Reihe “H. P. Lovecrafts Bibliothek des Schreckens” ist ein phantastischer Horrorroman, der in der von Lovecraft geschaffenen Welt des Cthulu Mythos spielt.
Der erste Satz beginnt mit: “Ich hasse den Winter”, und schon ist der Einstieg geschafft. Die darauffolgenden Seiten saugen den Leser förmlich in die Person Pouls und ziehen ihn mit in den Strudel der Ereignisse.
Poul ist eine angenehme Identifikationsfigur, und man leidet um so mehr mit ihm, als daß er eine ganz normale Person ist und aus seiner Sicht alles richtig macht, aber dennoch nicht seinem Schicksal entfliehen kann.
Marraks Schreibstil ist flüssig und in seinen Beschreibungen sehr lebendig. Insbesondere die plastische Darstellung der Örtlichkeiten entführt den Leser mit Leichtigkeit an die verschiedenen Handlungsorte. Im Gegensatz zu anderen Autoren, die in Lovecrafts Tradition schreiben, versucht er nicht, dessen Stil zu kopieren. Auch die Handlung ist nicht nur ein einfacher Austausch von Personen und Orten, sondern zeugt von eigener Kreativität. Die Handlungsstränge sind komplex, enthalten überaschende Wendungen und sind nicht linear aufgebaut. Selbst wenn man Lovecrafts Werke gut kennt, lassen sich die Geschehnisse kaum erahnen.
Wer allerdings noch nie mit der Welt der Alten Götter und von Cthulu in Berührung gekommen ist, kann schon ein wenig von den verschiedenen Wesen und ihren Beziehungen zueinander verwirrt werden. Besonders die Auflösung verlangt vom Leser höchste Aufmerksamkeit und geistige Flexibilität.
Insgesamt hat Marrak einen sehr spannenden Phantastikroman geschrieben, der es wert ist, in die Reihe der Lovecraftwelt aufgenommen zu werden. Mit den rund 400 Seiten ist er gerade lang genug, um in die dargestellte Welt einzutauchen und sich mit der Hauptperson zu identifizieren, aber kurz genug, um Längen zu vermeiden.