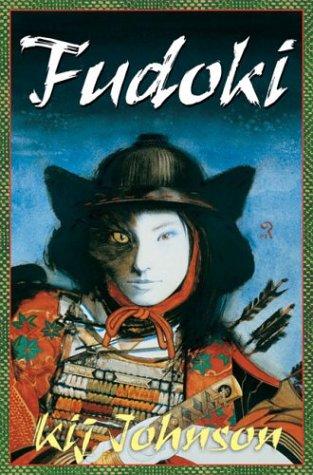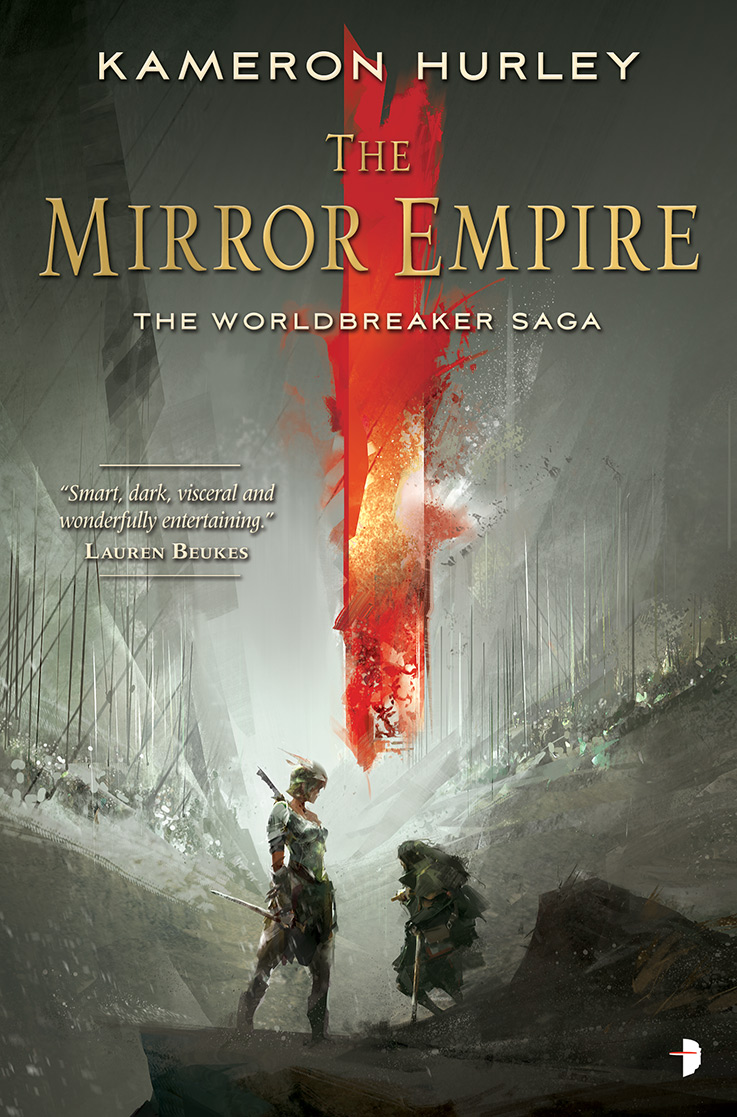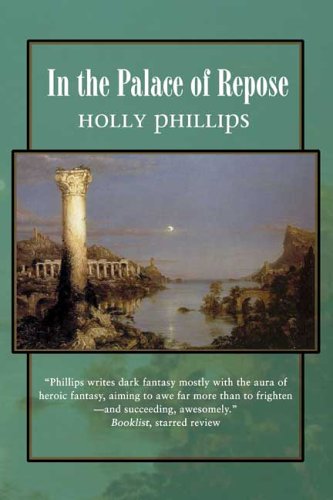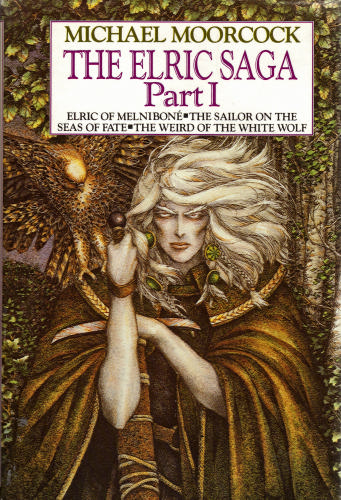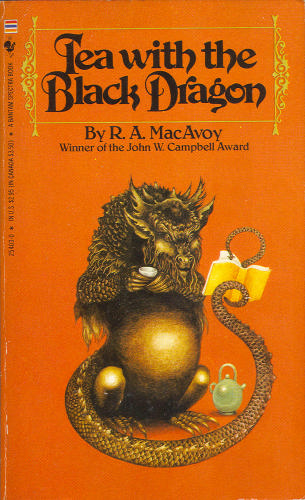Bibliotheka Phantastika gratuliert Kij Johnson, die heute ihren 55. Geburtstag feiert. Auch wenn das Werk der am 20. Januar 1960 in Harlan, Iowa, USA, geborenen Autorin bis auf eine (bislang unvollendete) Roman-Trilogie (mit in sich abgeschlossenen Bänden) vor allem aus Kurzgeschichten besteht, gehört sie thematisch und stilistisch zu einem spannenden Randbereich des Genres. Thematisch, weil viele ihrer Geschichten um das Thema “Tier und Mensch” kreisen. Obwohl die Geschichten häufig aus der Sicht von Tieren erzählt sind, gehen sie weg von der typischen Tierfantasy; stattdessen beziehen sie sich oft auf Mythen und erkunden nicht nur das Verhältnis von Tier und Mensch, sondern spüren durch die Kontrastfolie der tierischen Perspektive der conditio humana nach. Stilistisch, weil Johnson einen auf den ersten Blick nüchternen, aber keineswegs unsichtbaren Stil pflegt, der den erzählerischen Vorbildern treu bleibt und dadurch viel Atmosphäre vermittelt.
Die Romane The Fox Woman (2000, dt. Die Fuchsfrau (2005)) und Fudoki (2003) sind in einem magischen, historischen Japan angesiedelt und gehören zu einer ursprünglich auf drei Bände geplanten Reihe, die sich der grundlegenden Themen Liebe, Krieg und Tod annimmt und die penibel recherchiert in japanischen Erzähltraditionen verankert ist.
The Fox Woman geht verschiedenen Arten von Liebe auf poetisch-erkundende Weise auf den Grund und erzählt in Tagebuchform mit einer Drei-Perspektiven-Struktur von einem unglücklichen love triangle mit (gestaltwandelndem) Fuchs. Die Geschichte bleibt klein und häuslich (trotz politischer Machenschaften im Hintergrund), so dass am Ende den wechselnden Jahreszeiten genauso viel Bedeutung zukommt wie den Fährnissen des adligen Hausherren, seiner Frau und der Füchsin, die sich unerklärlicherweise in ihn verliebt hat.
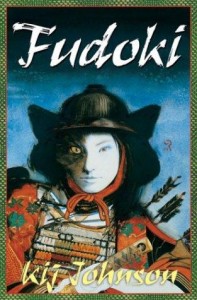 Zu mehr Action kommt es im zweiten Band Fudoki, der die Wanderschaft einer in eine Kriegerin verwandelten Katze nachverfolgt, deren Geschichte im Tagebuch einer Prinzessin festgehalten wird. Der dritte Teil, der sich dem Thema Tod widmen sollte, ist bis heute nicht erschienen.
Zu mehr Action kommt es im zweiten Band Fudoki, der die Wanderschaft einer in eine Kriegerin verwandelten Katze nachverfolgt, deren Geschichte im Tagebuch einer Prinzessin festgehalten wird. Der dritte Teil, der sich dem Thema Tod widmen sollte, ist bis heute nicht erschienen.
Stattdessen hat Kij Johnson Kurzgeschichten und Novellas veröffentlicht – etliche davon ebenfalls wieder in der asiatischen Mythologie verankert, und die meisten mit Tieren in einer zentralen Rolle –, die sich häufig auf Nominierungslisten für gewichtige Genre-Preise wiederfanden (und sie im Falle des Hugo und Nebula Awards 2011 bzw. 2009 auch gewannen). Gesammelt sind die jüngeren Geschichten 2012 als At the Mouth of the River of Bees erschienen. Und überraschenderweise kann man eine Auswahl davon auch auf Deutsch unter dem Titel Pinselstriche auf glattem Reispapier (2014) genießen.
Tag: Jubiläen
Bibliotheka Phantastika gratuliert Robert Silverberg, der heute 80 Jahre alt wird. Man macht gewiss nichts falsch, wenn man den am 15. Januar 1935 in New York City geborenen Robert Silverberg als SF-Urgestein und einen der wichtigsten noch lebenden SF-Autoren des 20. Jahrhunderts bezeichnet; zum einen, weil er im Verlauf seiner langen Karriere, die mit der Veröffentlichung der Kurzgeschichte “Gorgon Planet” (in Nebula Science Fiction 7, Februar 1954) begonnen hat, unglaublich fleißig war und mehr als hundert SF-Romane (plus diverse Sachbücher plus jede Menge anderer Romane unter teils bekannten, teils noch nicht bekannten Pseudonymen), sowie eine schier unüberschaubare Zahl von Erzählungen veröffentlicht hat, zum anderen, weil er in der von 1967 bis 1976 dauernden zweiten Phase dieser Karriere eine ganze Reihe thematisch breit gefächerter Romane – von Thorns (1967; dt. Der Gesang der Neuronen (1972)) und Hawksbill Station (1968; dt. Verbannte der Ewigkeit (1973)) über The Man in the Maze (1969; dt. Exil im Kosmos (1971), ungek. NÜ als Der Mann im Labyrinth (1982)), Downward to the Earth (1970; dt. Die Mysterien von Belzagor (1973)), Tower of Glass (1970; dt. Kinder der Retorte (1975)) oder The Book of Skulls (1971; dt. Bruderschaft der Unsterblichen (1980)) bis hin zu Dying Inside (1972; dt. Es stirbt in mir (1975)), The Stochastic Man (1975; dt. Der Seher (1978)) und Shadrach in the Furnace (1976; dt. Schadrach im Feuerofen (1979)) – verfasst hat, die das Genre entscheidend bereichert und mitgeprägt haben. Nach diesem qualitativ und quantitativ (in der besagten Zeitspanne entstanden mehr als 20 Romane und rund 60 Erzählungen!) schier unglaublichen Output hat sich Silverberg vier Jahre lang von der SF zurückgezogen – und zurückgekehrt ist er mit einem Roman, der zwar SF ist, sich aber beinahe wie Fantasy liest.
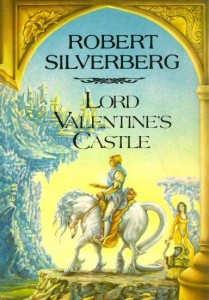 Lord Valentine’s Castle (1980) ist eine fast schon klassisch zu nennende planetary romance und spielt auf dem Riesenplaneten Majipoor, der der ganzen sich anschließenden Sequenz dann auch ihren Titel verleihen sollte. Majipoor wurde vor langer Zeit von Menschen und nichtmenschlichen Völkern kolonialisiert, die mittlerweile allerdings den größten Teil ihrer technologischen Errungenschaften vergessen haben und sich die Welt mit den Ureinwohnern Majipoors – deren wichtigste die gestaltwandlerischen Piurivar oder Metamorphen sind – teilen. Der Roman erzählt die Geschichte des jungen Valentine, der unweit der Hafenstadt Pidruit erwacht und sich an nichts als seinen Namen erinnern kann. Er schließt sich einer Gruppe umherziehender Artisten an, lernt jonglieren und lebt mehr oder weniger in den Tag hinein. Doch nachts hat er seltsame Träume, und da diese Träume immer intensiver werden und Träume an sich auf Majipoor eine besondere Bedeutung haben, macht er sich auf, seine Vergangenheit zu erforschen – und gelangt zu ebenso erstaunlichen wie erschreckenden Erkenntnissen … In Lord Valentine’s Castle spielt der Planet Majipoor eine mindestens genauso wichtige Rolle wie der Plot. Und dieses futuristisch-archaische und ungemein bunte und exotische Setting breitet Robert Silverberg auf meisterhafte Weise vor seinen Lesern und Leserinnen aus, führt sie im Zuge von Valentines Reise an faszinierende Orte mit enormen Schauwerten. Es ist kein Wunder, dass die amerikanische SF-Kritik von Silverbergs Rückkehr zum Genre eher enttäuscht war, denn dem vergleichsweise langsam und entspannt erzählten Roman fehlt jene Düsternis, die in fast allen Werken aus Silverbergs zweiter Schaffensphase zu finden ist. Er ist einfach nur ein “heller”, aber überaus lesenswerter Abenteuerroman, wie man ihn sonst am ehesten im Œuvre von Jack Vance finden kann, und wurde witzigerweise 1981 mit dem Locus Award als bester Fantasyroman ausgezeichnet.
Lord Valentine’s Castle (1980) ist eine fast schon klassisch zu nennende planetary romance und spielt auf dem Riesenplaneten Majipoor, der der ganzen sich anschließenden Sequenz dann auch ihren Titel verleihen sollte. Majipoor wurde vor langer Zeit von Menschen und nichtmenschlichen Völkern kolonialisiert, die mittlerweile allerdings den größten Teil ihrer technologischen Errungenschaften vergessen haben und sich die Welt mit den Ureinwohnern Majipoors – deren wichtigste die gestaltwandlerischen Piurivar oder Metamorphen sind – teilen. Der Roman erzählt die Geschichte des jungen Valentine, der unweit der Hafenstadt Pidruit erwacht und sich an nichts als seinen Namen erinnern kann. Er schließt sich einer Gruppe umherziehender Artisten an, lernt jonglieren und lebt mehr oder weniger in den Tag hinein. Doch nachts hat er seltsame Träume, und da diese Träume immer intensiver werden und Träume an sich auf Majipoor eine besondere Bedeutung haben, macht er sich auf, seine Vergangenheit zu erforschen – und gelangt zu ebenso erstaunlichen wie erschreckenden Erkenntnissen … In Lord Valentine’s Castle spielt der Planet Majipoor eine mindestens genauso wichtige Rolle wie der Plot. Und dieses futuristisch-archaische und ungemein bunte und exotische Setting breitet Robert Silverberg auf meisterhafte Weise vor seinen Lesern und Leserinnen aus, führt sie im Zuge von Valentines Reise an faszinierende Orte mit enormen Schauwerten. Es ist kein Wunder, dass die amerikanische SF-Kritik von Silverbergs Rückkehr zum Genre eher enttäuscht war, denn dem vergleichsweise langsam und entspannt erzählten Roman fehlt jene Düsternis, die in fast allen Werken aus Silverbergs zweiter Schaffensphase zu finden ist. Er ist einfach nur ein “heller”, aber überaus lesenswerter Abenteuerroman, wie man ihn sonst am ehesten im Œuvre von Jack Vance finden kann, und wurde witzigerweise 1981 mit dem Locus Award als bester Fantasyroman ausgezeichnet.
Obwohl Silverberg zunächst weitere Majipoor-Abenteuer ausgeschlossen hatte, schrieb er in den folgenden zwei Jahren etliche Erzählungen, die dann in dem Band Majipoor Chronicles (1982) gesammelt wurden. Sie setzen den ersten Band keineswegs direkt fort, sondern bieten – eingebettet in eine Rahmenhandlung um Valentines Vertrauten Hissune – kaleidoskopartige Einblicke in die ältere und jüngere Vergangenheit Majipoors und führen sogar hinaus auf den Großen Ozean, der mehr als eine Hemisphere der riesigen Welt bedeckt.
Valentines Geschichte wird schließlich in Valentine Pontifex (1983) wieder aufgegriffen und weitererzählt. In diesem Band sieht sich der Titelheld in seiner neuen Rolle mannigfaltigen Problemen wie Missernten, einer Verschwörung der Gestaltwandler und dem ungewöhnlichen Verhalten wilder Tiere gegenüber. Valentine wird klar, dass der seit 8000 Jahren auf Majipoor herrschende Friede in Gefahr ist, und deshalb muss er eine Entscheidung von allergrößter persönlicher Tragweite treffen …
Diese drei ersten Bände des Majipoor-Zyklus sind wie fast alle Romane Silverbergs (und etliche seiner Kurzgeschichtensammlungen) zuvor auch ins Deutsche übersetzt worden. Da sie mehrfach – teilweise unter neuen Titeln – neu aufgelegt wurden, soll es an dieser Stelle genügen, ihre erste und neueste deutsche Ausgabe zu nennen (detaillierter aufgeschlüsselt gibt es das Ganze in einem Kommentar). Band eins ist erstmals 1980 (als Krieg der Träume), zuletzt 2012 (als Neuübersetzung unter dem Titel Lord Valentine) erschienen, Band zwei erstmals 1985 (gesplittet als Die Majipoor-Chroniken 1 und 2), zuletzt 2013 (als NÜ unter dem Titel Die Bibliothek von Majipoor), Band drei erstmals 1985 (auch gesplittet als Die Wasserkönige von Majipoor und Valentine Pontifex) und letztmals 1995 (als Valentine Pontifex).
Es dauerte zwölf Jahre, bis Robert Silverberg mit The Mountains of Majipoor (1995; dt. Die Berge von Majipoor (1996)) wieder nach Majipoor zurückgekehrt ist, um die Geschichte von Prinz Harpirias zu erzählen, der sich auf eine gefährliche Mission in die eisige Tundra des Nordens begeben muss. Auch in diesem, 500 Jahre nach den Geschehnissen der ersten drei Bände spielenden Roman überzeugt Majipoor wieder als exotisches Setting, allerdings fehlt der Geschichte (möglicherweise dem geringeren Umfang geschuldet) ein bisschen die epische Breite, in der ein solchen Setting erst so richtig zur Geltung kommt.
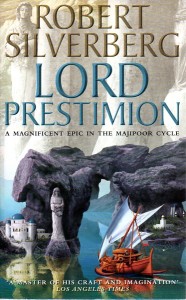 Besagte epische Breite findet sich dann wieder in der aus den Bänden Sorcerers of Majipoor (1997; dt. Die Zauberer von Majipoor (1998), auch als König der Erinnerungen (2003)), Lord Prestimion (1999; dt. Lord Prestimion (2003)) und The King of Dreams (2001; dt. König der Träume (2004)) bestehenden Prestimion Trilogy (in der Heyne-Ausgabe unter dem Obertitel Die Legenden von Majipoor). In dieser tausend Jahre vor Valentines Zeit spielenden Trilogie, in deren Mittelpunkt mit dem titelgebenden Prestimion ein Mann steht, der vom Anwärter auf das Amt des Coronals zum Coronal wird und sich erwartungsgemäß mit allerlei Fährnissen unterschiedlichster Natur herumschlagen muss, vollzieht der Majipoor-Zyklus den Übergang von der abenteuerlich-exotischen SF zur Fantasy, denn auch wenn z.B. Prestimion selbst Magie und deren Wirkung anfangs skeptisch gegenübersteht, lässt es sich nicht leugnen, dass sie in diesen Romanen existiert. Und natürlich bildet Majippor auch hier wieder eine beeindruckende Kulisse, denn noch immer lässt sich auf dieser Welt etwas Neues, bislang Ungesehenes entdecken.
Besagte epische Breite findet sich dann wieder in der aus den Bänden Sorcerers of Majipoor (1997; dt. Die Zauberer von Majipoor (1998), auch als König der Erinnerungen (2003)), Lord Prestimion (1999; dt. Lord Prestimion (2003)) und The King of Dreams (2001; dt. König der Träume (2004)) bestehenden Prestimion Trilogy (in der Heyne-Ausgabe unter dem Obertitel Die Legenden von Majipoor). In dieser tausend Jahre vor Valentines Zeit spielenden Trilogie, in deren Mittelpunkt mit dem titelgebenden Prestimion ein Mann steht, der vom Anwärter auf das Amt des Coronals zum Coronal wird und sich erwartungsgemäß mit allerlei Fährnissen unterschiedlichster Natur herumschlagen muss, vollzieht der Majipoor-Zyklus den Übergang von der abenteuerlich-exotischen SF zur Fantasy, denn auch wenn z.B. Prestimion selbst Magie und deren Wirkung anfangs skeptisch gegenübersteht, lässt es sich nicht leugnen, dass sie in diesen Romanen existiert. Und natürlich bildet Majippor auch hier wieder eine beeindruckende Kulisse, denn noch immer lässt sich auf dieser Welt etwas Neues, bislang Ungesehenes entdecken.
Nach dieser Trilogie hat Robert Silverberg noch eine Handvoll Erzählungen über Majipoor geschrieben, die inzwischen in dem Band Tales of Majipoor (2013) gesammelt wurden.
Bereits kurz nach den ersten drei Ausflügen nach Majipoor hat Robert Silverberg sich mit Gilgamesh the King (1984; auch als Gilgamesh (2005); dt. König Gilgamesch (1987, auch als König Gilgamesch von Uruk (1996)), einer Nacherzählung der epischen Geschichte des legendären sumerischen Gottkönigs, auch an “richtiger” Fantasy 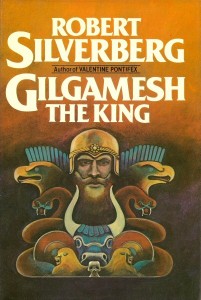 versucht, und das Ergebnis ist sehr überzeugend ausgefallen. Im Nachfolgeband To the Land of the Living (1989; dt. Das Land der Lebenden (1996)), einem fix-up aus drei zuvor einzeln erschienenen Novellen, verquickt er seine Version des Gilgamesch-Epos mit dem Setting des von Janet Morris geschaffenen Shared-World-Universums Heroes in Hell, was teilweise überraschend gut funktioniert und letztlich dem Buch eine bittere Pointe verleiht. Denn Gilgamesch, der zeit seines Lebens das Land der Toten gesucht hat, um dort mit seinem Freund Enkidu zusammen zu sein, versucht jetzt alles, um ins Land der Lebenden zurückzukehren (nicht zuletzt, weil er Enkidu in der Hölle nicht gefunden hat).
versucht, und das Ergebnis ist sehr überzeugend ausgefallen. Im Nachfolgeband To the Land of the Living (1989; dt. Das Land der Lebenden (1996)), einem fix-up aus drei zuvor einzeln erschienenen Novellen, verquickt er seine Version des Gilgamesch-Epos mit dem Setting des von Janet Morris geschaffenen Shared-World-Universums Heroes in Hell, was teilweise überraschend gut funktioniert und letztlich dem Buch eine bittere Pointe verleiht. Denn Gilgamesch, der zeit seines Lebens das Land der Toten gesucht hat, um dort mit seinem Freund Enkidu zusammen zu sein, versucht jetzt alles, um ins Land der Lebenden zurückzukehren (nicht zuletzt, weil er Enkidu in der Hölle nicht gefunden hat).
Abgesehen von diesen Abstechern in die Beinahe-Fantasy bzw. Fantasy ist Robert Silverberg der SF seit seiner Rückkehr ins Genre treu geblieben und auch heute noch – zumindest als Kurzgeschichtenautor – aktiv.
Bibliotheka Phantastika gratuliert Joy Chant, die heute 70 Jahre alt wird. Es hat eine Menge Autoren und Autorinnen gegeben, die nur für kurze Zeit einen Beitrag zum Genre geleistet haben (wie man nicht zuletzt anhand dieser Geburtstagspostings immer mal wieder feststellen kann). Bei einigen ist das wirklich bedauerlich, wie beispielsweise bei der am 13. Januar 1945 in London geborenen Eileen Joyce Chant (verheiratete Rutter), deren schmales Œuvre aus gerade einmal drei Fantasyromanen, einem Band mit Nacherzählungen keltischer Sagen und zwei Stories besteht. Interessanterweise spielen die drei Fantasyromane zwar alle auf der gleichen Welt – genauer: auf dem Kontinent Vandarei –, unterscheiden sich jedoch inhaltlich, thematisch und stilistisch deutlich voneinander.
Chants Erstling Red Moon and Black Mountain (1970; dt. Roter Mond und Schwarzer Berg (1978)) ist ein Jugendbuch, in dem es die Geschwister Oliver, Nicholas und Penelope aus dem zeitgenössischen England in das Fantasyland Kedrinh verschlägt, wo ihnen in einem epischen Kampf zwischen den Mächten des Guten und des Bösen wichtige Rollen zufallen. In England beim Tolkien-Verlag Allen & Unwin erschienen (und in den USA im Rahmen der Ballantine Adult Fantasy nachgedruckt), wurde und wird dem Roman von manchen Seiten gelegentlich der Vorwurf gemacht, ein Herr-der-Ringe-Plagiat zu sein, und es gibt tatsächlich ein paar Parallelen zwischen den beiden Werken – und mindestens genauso viele inhaltliche Unterschiede. Was Joy Chant zweifellos geschafft hat, war, einen Roman zu schreiben, der den “Geist” Tolkiens bzw. des Herr der Ringe atmet wie nur wenige andere. Einen Roman, der in einer Welt angesiedelt ist, die sie bereits in ihrer Kindheit und Jugend entworfen hat (ohne Tolkien gelesen zu haben), wie sie mehrfach glaubhaft versichert hat. Glaubhaft nicht zuletzt deshalb, weil der faszinierendste Teil des Buches Olivers Geschichte ist, der beim magischen “Transport” nach Kedrinh von seinen beiden jüngeren Geschwistern getrennt wird und bei den Hurnei, einem Stamm des Reitervolks der Khentor landet, wo er zu einem jungen Mann heranwächst und dabei mit einer faszinierenden Kultur vertraut wird.
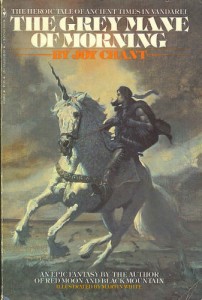 Die Khentor (oder Khentorei) stehen auch im Mittelpunkt von Joy Chants zweitem Roman The Grey Mane of Morning (1977; dt. Der Mond der brennenden Bäume (1981)), einem viele Jahrhunderte vor den Geschehnissen des vorangegangenen Bandes angesiedelten Prequel, das nur den groben Hintergrund mit Red Moon teilt. Seit Menschengedenken zieht der Stamm der Alnei durch die riesigen Ebenen und leistet den Goldenen – einem Volk, das in ummauerten Städten lebt – alljährlich Tribut. Manchmal besteht dieser Tribut auch in einer jungen Frau, doch als die Goldenen, die von den Alnei als Halbgötter betrachtet werden, ausgerechnet Nai, eine Priesterin und Tochter des Stammesführers rauben, setzen sie Dinge in Bewegung, mit denen sie niemals gerechnet hatten. Denn Mor’anh, “der Speer des Himmels” und Nais Bruder, stellt die alten Traditionen in Frage und versucht alles, um seine Schwester zurückzuholen. Mor’anh und seine Konfrontation mit dem ihm Unbegreiflichen, die Fragen, die er sich stellt – etwa über die Bedeutung des Schicksals – und sein trotz mancher Irrtümer und Fehlschläge unbedingter Wille, seine Schwester zu retten, machen den Reiz diese Buches aus, das man – eingedenk der Lebensumstände und “Philosophie” der Alnei – fast als den (vermutlich ersten) ökologischen Fantasyroman bezeichnen könnte. Deutlich weniger episch angelegt als der erste Roman ist The Grey Mane of Morning ein faszinierendes Werk über ein Volk, das in dieser Form in der Fantasy ansonsten kaum zu finden ist.
Die Khentor (oder Khentorei) stehen auch im Mittelpunkt von Joy Chants zweitem Roman The Grey Mane of Morning (1977; dt. Der Mond der brennenden Bäume (1981)), einem viele Jahrhunderte vor den Geschehnissen des vorangegangenen Bandes angesiedelten Prequel, das nur den groben Hintergrund mit Red Moon teilt. Seit Menschengedenken zieht der Stamm der Alnei durch die riesigen Ebenen und leistet den Goldenen – einem Volk, das in ummauerten Städten lebt – alljährlich Tribut. Manchmal besteht dieser Tribut auch in einer jungen Frau, doch als die Goldenen, die von den Alnei als Halbgötter betrachtet werden, ausgerechnet Nai, eine Priesterin und Tochter des Stammesführers rauben, setzen sie Dinge in Bewegung, mit denen sie niemals gerechnet hatten. Denn Mor’anh, “der Speer des Himmels” und Nais Bruder, stellt die alten Traditionen in Frage und versucht alles, um seine Schwester zurückzuholen. Mor’anh und seine Konfrontation mit dem ihm Unbegreiflichen, die Fragen, die er sich stellt – etwa über die Bedeutung des Schicksals – und sein trotz mancher Irrtümer und Fehlschläge unbedingter Wille, seine Schwester zu retten, machen den Reiz diese Buches aus, das man – eingedenk der Lebensumstände und “Philosophie” der Alnei – fast als den (vermutlich ersten) ökologischen Fantasyroman bezeichnen könnte. Deutlich weniger episch angelegt als der erste Roman ist The Grey Mane of Morning ein faszinierendes Werk über ein Volk, das in dieser Form in der Fantasy ansonsten kaum zu finden ist.
Von den weiten Ebenen des Nordens und den auf Davladi genannten Einhörnern reitenden Khentorei geht es in When Voiha Wakes (1983; dt. Wenn Voiha erwacht (1984)) ins Reich Halilak, in dessen dörflichen Siedlungen Frauen das Sagen haben. Auch hier sorgen alte Traditionen dafür, dass die Dinge immer so bleiben, wie sie sind – was einem jungen Mann, der sich zum Künstler berufen fühlt, einige Probleme bereitet, denn in Halilak können Männer allenfalls Handwerker, aber niemals Künstler werden. When Voiha Wakes ist ein kleiner, stiller Roman, dessen Protagonisten nichtsdestotrotz unter den Widrigkeiten ihres Lebens leiden (und stellt natürlich die gewohnten Geschlechterverhältnisse auf den Kopf).
Und damit war Joy Chants Ausflug in die Fantasy dann auch schon beendet, denn bei The High Kings (1983; dt. Könige der Nebelinsel (1984)) handelt es sich um eine – großzügig und großartig illustrierte – Sammlung von Nacherzählungen alter keltischer Legenden aus der Zeit vor König Artus.
Auch wenn man den Romanen – vor allem in Sachen Erzählduktus – anmerkt, in welcher Zeit sie entstanden sind, lassen sie sich dank Joy Chants stilistischen Fähigkeiten auch heute noch gut lesen – vor allem im Original. Was die deutschen Ausgaben angeht, muss man in dieser Hinsicht bei Der Mond der brennenden Bäume ein paar Abstriche machen, denn in diesem Fall kommt die Übersetzung an den Stil des Originals leider nicht heran.
Bibliotheka Phantastika gratuliert Kameron Hurley, die heute ihren 35. Geburtstag feiert. Ihre bislang vier erschienenen Romane sind einerseits vor allem etwas für unverzagte Leser und Leserinnen, die in ihrem Genre gern einen oder gleich mehrere ganz neue Ansätze und jede Menge Skurriles zu schätzen wissen, andererseits begegnet man der am 12. Januar 1980 in Washington State, USA, geborenen Autorin beinahe zwangsläufig, sobald man sich im Internet mit englischsprachiger Phantastik befasst, denn Kameron Hurley bloggt sich kreuz und quer durch die entsprechende Blogosphäre und wurde dafür 2014 auch mit zwei Hugo Awards ausgezeichnet (für ihren Essay We have always fought und als Best Fan Writer).
Ihre vorrangigen Themen, vor allem den Wunsch nach Loslösung von historischen und tatsächlichen Geschlechterrollen, packt sie auch in ihren Romanen an. So setzt schon ihre erste Trilogie, The Bel Dame Apocrypha, diesbezüglich Maßstäbe: Man verfolgt in den Bänden God’s War (2011), Infidel (2011) und Rapture (2012) nicht nur die Taten der selbst für ihren Berufsstand unorthodoxen Assassinin – oder Bel Dame – Nyxnissa, die als Paukenschlag in der Eröffnungsszene gleich mal ihre Gebärmutter verscherbelt, sondern befindet sich auch im politisch aufgeladenen Setting eines Lost-Colony-Planeten mit einer hochreligiösen, mittelöstlich angehauchten Gesellschaft, die allerdings von Frauen beherrscht wird, und in der Männer höchstens als Kanonenfutter herhalten, aber keine höheren gesellschaftlichen Funktionen einnehmen. Für den zusätzlichen Schuss Extravaganz sorgt die Hauptressource der Welt: Fahrzeuge, Fabriken und andere Technologie – alles wird von Insekten angetrieben. Durch dieses postapokalyptische, von einem heiligen Krieg zerrissene Terrain schlägt sich Nyx mit ihren Gefährten als Kopfgeldjägerin, die Abtrünnige und Terroristen zur Strecke bringt – Stoff für eine unkonventionelle, aber vor allem im ersten Band plotmäßig noch sehr mäandernde Geschichte.
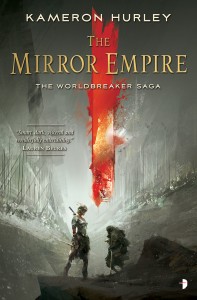 Mit ihrem neuen Projekt ist Kameron Hurley angetreten, um die epische Fantasy auf eine sehr ähnliche Weise aufzumischen: Der erste Band der Worldbreaker Saga, The Mirror Empire (2014), geht mit multiplen POV-Charakteren und der üblichen Ausgangslage aus Reichen im Krieg, Herrscherdynastien und drohender Katastrophe zwar ziemlich typisch für moderne Epic Fantasy los, aber ansonsten bleibt kein Stein auf dem anderen: Hurley arbeitet mit eigenem Gendersystem und neuen Pronomen, und ihr kriselndes Reich Dhai ist alles, aber kein mittelaltertümelndes Fantasy-Europa. Der für September angekündigte zweite Band Empire Ascendant wird nach dem starken Tobak des Auftaktbandes zeigen, ob die Story mit dem Programm mithalten kann, aber es ist zweifellos ein äußerst spannender Versuch, die Fantasy ganz anders anzupacken. Was dann auch das Stichwort in Sachen deutsche Übersetzung sein dürfte: Die ist, wie nicht anders zu erwarten, bisher nicht in Sicht.
Mit ihrem neuen Projekt ist Kameron Hurley angetreten, um die epische Fantasy auf eine sehr ähnliche Weise aufzumischen: Der erste Band der Worldbreaker Saga, The Mirror Empire (2014), geht mit multiplen POV-Charakteren und der üblichen Ausgangslage aus Reichen im Krieg, Herrscherdynastien und drohender Katastrophe zwar ziemlich typisch für moderne Epic Fantasy los, aber ansonsten bleibt kein Stein auf dem anderen: Hurley arbeitet mit eigenem Gendersystem und neuen Pronomen, und ihr kriselndes Reich Dhai ist alles, aber kein mittelaltertümelndes Fantasy-Europa. Der für September angekündigte zweite Band Empire Ascendant wird nach dem starken Tobak des Auftaktbandes zeigen, ob die Story mit dem Programm mithalten kann, aber es ist zweifellos ein äußerst spannender Versuch, die Fantasy ganz anders anzupacken. Was dann auch das Stichwort in Sachen deutsche Übersetzung sein dürfte: Die ist, wie nicht anders zu erwarten, bisher nicht in Sicht.
Bibliotheka Phantastika gratuliert Jessica Amanda Salmonson, die heute 65 Jahre alt wird. Die am 06. Januar 1950 als Jesse Amos Salmonson in Seattle, Washington, geborene Jessica Amanda Salmonson betrat die professionelle amerikanische Phantastikszene Ende der 70er Jahre mit einem ordentlichen Paukenschlag. Was insofern überraschend war, als sie zuvor nur ein paar Geschichten in kleinauflagigen semiprofessionellen Magazinen – wie z.B. dem seit 1973 von ihr selbst herausgegebenen The Literary Magazine of Fantasy and Terror (in dem sie auch offen über ihre Erfahrungen bei der zeitgleichen Verwandlung von Jesse in Jessica berichtete) – und Fanzines veröffentlicht hatte. Die Kontakte, die sie dabei als Autorin und Herausgeberin knüpfen konnte, dürften ihr den ersten Auftritt auf der großen professionellen Bühne allerdings spürbar erleichtert haben, denn sie debütierte dort nicht mit einem Roman, sondern einer Anthologie.
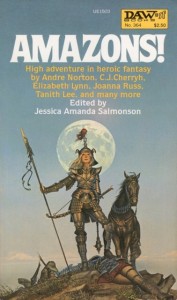 Amazons! (1979; dt. Amazonen! (1981)) hatte einen eindeutigen und von Salmonson im Vorwort klar benannten programmatischen Anspruch: Im Mittelpunkt der in der Anthologie enthaltenen Geschichten sollten ausschließlich Heldinnen stehen und einen Gegenpol zu den von wenigen Ausnahmen abgesehen fast ausschließlich männlichen Protagonisten der Sword & Sorcery bilden, wobei die Heldinnen glaubwürdige Frauenfiguren sein sollten, die mehr als “men with tits” waren. Was heutzutage angesichts mehrerer phantastischer Subgenres, die sich inhaltlich auf eine überwiegend weibliche Leserschaft ausgerichtet haben, nicht mehr sonderlich aufregend klingt, war damals fast schon revolutionär, denn Ende der 70er Jahre hatte die (mehr oder weniger) tolkieneske Questenfantasy trotz der Erfolge eines Terry Brooks und Stephen R. Donaldson die Sword & Sorcery noch nicht endgültig als dominierendes Fantasy-Subgenre abgelöst, und Letztere war sowohl auf der Autoren- wie der Figurenebene fest in männlicher Hand. Erstaunlicherweise hat Amazons! den vorgegebenen programmatischen Anspruch mehr als eingelöst und das Subgenre um ein paar interessante und kompetent erzählte Variationen altbekannter (und nicht ganz so altbekannter) Motive bereichert, was der Anthologie nicht nur den World Fantasy Award eingebracht hat, sondern sie zu einer der besten Sword-&-Sorcery-Anthologien überhaupt macht.
Amazons! (1979; dt. Amazonen! (1981)) hatte einen eindeutigen und von Salmonson im Vorwort klar benannten programmatischen Anspruch: Im Mittelpunkt der in der Anthologie enthaltenen Geschichten sollten ausschließlich Heldinnen stehen und einen Gegenpol zu den von wenigen Ausnahmen abgesehen fast ausschließlich männlichen Protagonisten der Sword & Sorcery bilden, wobei die Heldinnen glaubwürdige Frauenfiguren sein sollten, die mehr als “men with tits” waren. Was heutzutage angesichts mehrerer phantastischer Subgenres, die sich inhaltlich auf eine überwiegend weibliche Leserschaft ausgerichtet haben, nicht mehr sonderlich aufregend klingt, war damals fast schon revolutionär, denn Ende der 70er Jahre hatte die (mehr oder weniger) tolkieneske Questenfantasy trotz der Erfolge eines Terry Brooks und Stephen R. Donaldson die Sword & Sorcery noch nicht endgültig als dominierendes Fantasy-Subgenre abgelöst, und Letztere war sowohl auf der Autoren- wie der Figurenebene fest in männlicher Hand. Erstaunlicherweise hat Amazons! den vorgegebenen programmatischen Anspruch mehr als eingelöst und das Subgenre um ein paar interessante und kompetent erzählte Variationen altbekannter (und nicht ganz so altbekannter) Motive bereichert, was der Anthologie nicht nur den World Fantasy Award eingebracht hat, sondern sie zu einer der besten Sword-&-Sorcery-Anthologien überhaupt macht.
Fast das Gleiche lässt sich auch über Amazons II (1982; dt. Neue Amazonen-Geschichten (1983)) sagen, und auch die beiden thematisch etwas breiter angelegten Anthologien Heroic Visions (1983) und Heroic Visions II (1986) zählen zu den besseren Vertretern ihrer Art.
Zwischenzeitlich hatte Jessica Amanda Salmonson bewiesen, dass auch als Autorin mit ihr zu rechnen war, denn ihre mit Tomoe Gozen (1981; rev. als: The Disfavored Hero (1999)) begonnene und mit The Golden Naginata (1982) und Thousand Shrine Warrior (1984) fortgesetzte Tomoe Gozen Saga erwies sich als inhaltlich und erzählerisch überzeugend umgesetzte Variante ihres in Amazons! formulierten Anspruchs. Tomoe Gozen ist eine (an eine vermutlich historische Persönlichkeit angelehnte – zumindest wird im Heike Monogatari eine Tomoe Gozen erwähnt und ausführlich beschrieben) Kriegerin, die in einem magischen Parallelwelt-Japan namens Naipon mannigfaltige Abenteuer erlebt und es dabei nicht nur mit Samurais und Ninjas, sondern auch mit Magiern, Monstern und allerlei mythischen Kreaturen zu tun bekommt. Was Tomoe Gozen als Sword-&-Sorcery-Heldin (und bei den drei Romanen handelt es sich eindeutig um Sword & Sorcery) von ihren männlichen Kollegen unterscheidet, ist vor allem, dass sie eine Samurai ist. Das bedeutet, dass sie nach einem rigiden Ehrenkodex lebt und handelt – auch wenn das gelegentlich zu Entscheidungen führt, die ihr Herz anders treffen würde. Die glaubwürdige Hauptfigur, der authentisch wirkende Hintergrund und nicht zuletzt Salmonsons stilistische Fähigkeiten machen die Tomoe Gozen Saga zu einem der späten Höhepunkte der Sword & Sorcery, die eindruckvoll zeigt, was in diesem vermeintlich so eng begrenzten Subgenre möglich ist.
In Deutschland hat sich Tomoe Gozens Auftritt leider nicht ganz so glücklich gestaltet. Zwar wurden die ersten beiden Romane als Tomoe die Samurai (1984) und Die goldene Naginata (1985) übersetzt (und – als kleine Anekdote am Rande – mit den Titelbildern ausgestattet, die die Originalausgaben der beiden Amazons-Anthologien geziert hatten), 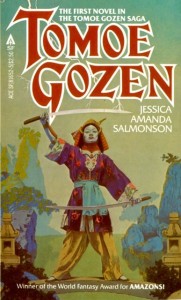 doch zumindest die Übersetzung von Die goldene Naginata war stellenweise gekürzt. Warum? Aus dem gleichen Grund, aus dem nie eine Übersetzung von Thousand Shrine Warrior erschienen ist: In der Tomoe Gozen Saga geht es auch für Sword-&-Socery-Verhältnisse stellenweise recht brutal und blutig zu, und daher hat man im zweiten Band der Trilogie ein paar allzu drastische Stellen herausgekürzt und von der Übersetzung des dritten Bands Abstand genommen. Was angesichts des Stellenwerts, den Grim & Gritty heutzutage auf dem Markt genießt (und was da anscheinend völlig problemlos durchgewunken wird), einmal mehr zeigt, wie sehr sich die Zeiten geändert haben.
doch zumindest die Übersetzung von Die goldene Naginata war stellenweise gekürzt. Warum? Aus dem gleichen Grund, aus dem nie eine Übersetzung von Thousand Shrine Warrior erschienen ist: In der Tomoe Gozen Saga geht es auch für Sword-&-Socery-Verhältnisse stellenweise recht brutal und blutig zu, und daher hat man im zweiten Band der Trilogie ein paar allzu drastische Stellen herausgekürzt und von der Übersetzung des dritten Bands Abstand genommen. Was angesichts des Stellenwerts, den Grim & Gritty heutzutage auf dem Markt genießt (und was da anscheinend völlig problemlos durchgewunken wird), einmal mehr zeigt, wie sehr sich die Zeiten geändert haben.
An die Klasse der Tomoe Gozen Saga kommt der 1982 nahezu zeitgleich mit dem zweiten Band der Trilogie erschienene Einzelroman The Swordswoman zwar nicht heran, aber die Geschichte der jungen Erin Wyler, die aus einem unglücklichen Leben auf der Erde gerissen wird und auf eine (wiederum asiatisch geprägte) Parallelwelt namens Endsworld gerät, auf der sie sich einen Platz erkämpfen muss, ist dennoch lesenswert. Mehr als nur lesenswert ist Ou Lu Khen and the Beautiful Madwoman (1985; dt. Die scheue Schöne (1988)), ein Roman, der sich spürbar von Salmonsons vorherigen Werken unterscheidet. Denn die Geschichte des Bauern Ou Lu Khen und seiner Begleiterin Mai Su ist keine Sword & Sorcery, sondern am ehesten eine etwas andere Fantasyqueste, die sie zu den Grabstätten der Lost Dynasty des historischen China führt, den Überresten eines Reiches, das so böse war, dass es aus der Historie des Landes schlicht verschwunden ist. Was ihre Queste – neben der allem Weltlichen ziemlich entrückten Mai Su – so anders und ziemlich einzigartig macht, ist die Tatsache, dass die beiden von Lu Khens kleiner Schwester und seinem Urgroßvater verfolgt werden – und alle vier wiederum von dem ehrlosen Schurken Harada Fumiaka, dem Lu Khen ein Boot gestohlen hat. Auch wenn sich das ein bisschen nach humoristischer Fantasy anhört, ist es keine, sondern eine wirklich originelle Abenteuergeschichte mit gelegentlichen amüsanten Einsprengseln.
Nach diesem Roman hat Jessica Amanda Salmonson sich von der Fantasy im engeren Sinn ab- und dem Horror bzw. der klassischen Gespenstergeschichte zugewandt. Auch wenn einige ihrer Kurzgeschichtensammlungen wie z.B. A Silver Thread of Madness (1988) und The Dark Tales (2002) noch (zumeist früher entstandene) Fantasystories enthalten, sind die Geschichten in John Collier and Fredric Brown Went Quarrelling Through My Head (1989), The Mysterious Doom and Other Ghostly Tales of the Pacific Northwest (1992), The Eleventh Jaguarundi and Other Mysterious Persons (1995) und The Deep Museum: Ghost Stories of a Melancholic (2003) größtenteils dem Horror zuzurechnen; dies gilt auch für den Roman Anthony Shriek (1992). Zudem hat sie etliche Anthologien mit klassischen, zumeist vergessenen Gespenstergeschichten herausgegeben und mit The Encyclopedia of Amazons: Women Warriors from Antiquity to the Modern Era (1991) ein Sachbuch über historische bzw. historisch verbürgte Amazonen verfasst.
Mittlerweile veröffentlicht sie – genau wie in ihren Anfangstagen – fast nur noch in Fanzines oder bei spezialisierten Kleinverlagen.
Außerdem wollen wir die Gelegenheit nutzen, an Robert Stallman zu erinnern, der heute 85 Jahre alt geworden wäre. Wie bei vielen seiner Autorenkollegen und -kolleginnen ist auch der Stern des am 06. Januar 1930 in Kankakee, Illinois, geborenen Robert Lester Stallman, der hauptberuflich als Literaturkritiker und Englischprofessor tätig war, nur kurz am Himmel der phantastischen Literatur aufgeglüht und rasch wieder erloschen. Bei ihm hat das allerdings einen tragischen Grund, denn er ist bereits am 01. August 1980 – knapp fünf Monate nach der Veröffentlichung seines Erstlings The Orphan, dem ersten Band von The Book of the Beast – im Alter von fünfzig Jahren verstorben. Dass er anschließend zweimal hintereinander posthum für den John W. Campbell Award for Best New Writer nominiert wurde, sagt Einiges darüber aus, welchen Eindruck The Book of the Beast (bzw. vor allem The Orphan) in der amerikanischen Phantastikszene gemacht hat.
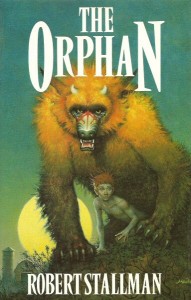 The Orphan erzählt die Geschichte eines gestaltwandlerischen Tiers, eines Werwesens, das menschliche Gestalt annehmen muss, wenn es inmitten der Menschen leben will – und genau diesen Drang verspürt es. Das Tier hat keinerlei Erinnerung daran, wo es herkommt, und fühlt sich allein auf der Welt. Es versteht die Menschen und ihre Gewohnheiten nicht, und es hat nur eine sehr begrenzte Kontrolle über seinen jeweiligen menschlichen … nennen wir ihn Avatar, der sich seinerseits des dunklen Etwas’ und dessen merkwürdigen Begierden in seinem Innern schämt. Das ist bei seinem ersten Avatar Little Robert, einem kleinen Jungen, der auf einer Farm irgendwo in den ländlichen Gebieten des amerikanischen mittleren Westens heranwächst, noch kein sonderlich großes Problem, doch als das Tier Little Robert aus bestimmten Gründen hinter sich lassen muss und sein nächster Avatar ein Teenager ist, der mit seinen ganz eigenen erwachenden Begierden zu kämpfen hat, sieht das schon anders aus.
The Orphan erzählt die Geschichte eines gestaltwandlerischen Tiers, eines Werwesens, das menschliche Gestalt annehmen muss, wenn es inmitten der Menschen leben will – und genau diesen Drang verspürt es. Das Tier hat keinerlei Erinnerung daran, wo es herkommt, und fühlt sich allein auf der Welt. Es versteht die Menschen und ihre Gewohnheiten nicht, und es hat nur eine sehr begrenzte Kontrolle über seinen jeweiligen menschlichen … nennen wir ihn Avatar, der sich seinerseits des dunklen Etwas’ und dessen merkwürdigen Begierden in seinem Innern schämt. Das ist bei seinem ersten Avatar Little Robert, einem kleinen Jungen, der auf einer Farm irgendwo in den ländlichen Gebieten des amerikanischen mittleren Westens heranwächst, noch kein sonderlich großes Problem, doch als das Tier Little Robert aus bestimmten Gründen hinter sich lassen muss und sein nächster Avatar ein Teenager ist, der mit seinen ganz eigenen erwachenden Begierden zu kämpfen hat, sieht das schon anders aus.
The Orphan ist ein ziemlich einzigartiges und schwer zu klassifizierendes Buch; es ist zum einen ein Horrorroman mit (nur marginal in Erscheinung tretendem) SF-Hintergrund, zum anderen ein Entwicklungsroman und last but not least ein Roman über die Lebensumstände in den USA der 30er Jahre – sprich: zur Zeit der Großen Depression. Stallmans clevere Prämisse – die gegenseitige Abhängigkeit von Tier und menschlichem Avatar, vor allem aber die Unmöglichkeit, das andere Selbst vollständig zu kontrollieren – verleiht dem Roman eine innere Spannung, die mindestens ebenso fesselnd ist wie die in der Außenwelt stattfindenden Konflikte. Das bleibt auch im zweiten, bereits etwas schwächeren Band The Captive (1981) so, in dem das Tier u.a. in seiner wahren Gestalt in Gefangenschaft gerät und ausgestellt wird, während im noch einmal deutlich schwächeren, auch mit strukturellen Problemen behafteten dritten Band The Beast (1982) das Tier endlich auf einen weiblichen Artgenossen stößt – was allerdings nicht bedeutet, dass schlagartig alles gut wird …
Auch wenn The Captive und The Beast nicht an die Qualität von The Orphan heranreichen – was vermutlich nicht zuletzt damit zu tun haben dürfte, dass Stallman aufgrund seines frühen Todes vor allem den letzten Band nicht mehr überarbeiten konnte – sei The Book of the Beast allein aufgrund des hervorragenden ersten Bandes all denjenigen Lesern und Leserinnen ans Herz gelegt, die mal etwas ganz anderes lesen wollen. Und sie können das sogar auf Deutsch tun, denn die Trilogie ist als Der Findling, Der Gefangene und Der Nachkomme (alle 1982) unter dem Obertitel Werwelt (der dann auch der Titel für den 1986 erschienenen Sammelband war) auch hierzulande (in der damaligen “schwarzen” Goldmann-Fantasyreihe) veröffentlicht worden.
Bibliotheka Phantastika gratuliert Susan Shwartz, die heute 65 Jahre alt wird. Die am 31. Dezember 1949 in Youngstown, Ohio, geborene Susan Martha Shwartz zählt zu den Autoren und Autorinnen, die eine gewisse Zeit in der Phantastikszene recht aktiv waren und dann wieder mehr oder weniger in der Versenkung verschwunden sind. Wobei sie auch in ihrer aktivsten Phase immer nur im Nebenberuf geschrieben und ihr Geld hauptberuflich an der Wall Street verdient hat.
Ihr Debut als Autorin feierte sie 1980 mit der Kurzgeschichte “The Fires of Her Vengeance” in der von Marion Zimmer Bradley herausgegebenen Anthologie The Keeper’s Price and Other Stories, auf die rasch weitere Geschichten – teils SF, teils Fantasy – in Magazinen wie Analog oder Fantasy Book und in weiteren Bradley-Anthologien folgten. Ihr erster Roman war eine Space Opera (White Wing (1985), mit Sharian Lewitt als Gordon Kendall), doch danach wandte sie sich in ihren Romanen mehrere Jahre lang fast ausschließlich der Fantasy zu.
Byzantium’s Crown bildet den Auftakt der mit den Bänden The Woman of Flowers (beide 1987) und Queensblade (1988) fortgesetzten Trilogie Heirs to Byzantium, die auf einer alternativen Erde spielt, auf der Octavian die Seeschlacht von Actium gegen Marcus Antonius verloren und Letzterer daraufhin mit Cleopatra ein ägyptisch-byzantinisches Reich gegründet hat. Dessen Hauptstadt Byzanz wurde zum Mittelpunkt einer Welt, auf der Magie existiert und die alten Götter überlebt haben, wohingegen das Christentum nur eine Sekte mit marginalem Einfluss ist. Jahrhunderte später muss der Thronerbe Prinz Marric aus dem Reich fliehen (da ihm seine Stiefmutter das Erbe streitig machen will) und gerät dadurch in Abenteuer, die ihn bis auf die britischen Inseln führen, auf denen die Druiden immer noch mächtig sind.
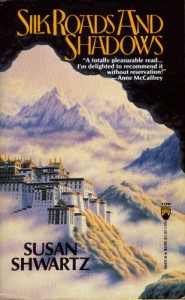 Auch Silk Roads and Shadows (1988) beginnt in einem alternativen Byzanz, das sich jedoch kaum vom historischen Byzanz unterscheidet (wenn man davon absieht, dass auch in dieser Welt wieder Magie existiert). Von hier aus macht sich Prinzessin Alexandra, die Schwester des Kaisers, mit ein paar Begleitern nach Osten auf – sie will in China Seidenraupen stehlen, da die byzantinischen Seidenraupen von ihrer Tante, der machthungrigen Zauberin Theodora (die am liebsten selbst auf dem Kaiserthron sitzen würde), vernichtet wurden. Unterwegs bekommt Alexandra es nicht nur mit den Verfolgern zu tun, die ihre Tante hinter ihr herschickt, sondern begegnet auch dem geheimnisvollen König der ebenso geheimnisvollen Stadt Shamballah, der ihr erklärt, dass ihre einzige Chance, ihre Reise zu überleben und erfolgreich zu bendeen, darin besteht, den Diamantweg zu beschreiten – sprich, die magischen Disziplinen des Vajrayana-Buddhismus zu erlernen … Farbige, exotische Settings, eine abenteuerliche Handlung, und die überzeugende innere Entwicklung Alexandras machen aus Silk Roads and Shadows einen lesenswerten Fantasyroman mit einer vielleicht ein wenig zu modern denkenden Heldin (aber das kennt man ja auch aus diversen historischen Romanen).
Auch Silk Roads and Shadows (1988) beginnt in einem alternativen Byzanz, das sich jedoch kaum vom historischen Byzanz unterscheidet (wenn man davon absieht, dass auch in dieser Welt wieder Magie existiert). Von hier aus macht sich Prinzessin Alexandra, die Schwester des Kaisers, mit ein paar Begleitern nach Osten auf – sie will in China Seidenraupen stehlen, da die byzantinischen Seidenraupen von ihrer Tante, der machthungrigen Zauberin Theodora (die am liebsten selbst auf dem Kaiserthron sitzen würde), vernichtet wurden. Unterwegs bekommt Alexandra es nicht nur mit den Verfolgern zu tun, die ihre Tante hinter ihr herschickt, sondern begegnet auch dem geheimnisvollen König der ebenso geheimnisvollen Stadt Shamballah, der ihr erklärt, dass ihre einzige Chance, ihre Reise zu überleben und erfolgreich zu bendeen, darin besteht, den Diamantweg zu beschreiten – sprich, die magischen Disziplinen des Vajrayana-Buddhismus zu erlernen … Farbige, exotische Settings, eine abenteuerliche Handlung, und die überzeugende innere Entwicklung Alexandras machen aus Silk Roads and Shadows einen lesenswerten Fantasyroman mit einer vielleicht ein wenig zu modern denkenden Heldin (aber das kennt man ja auch aus diversen historischen Romanen).
Auch in ihren folgenden Romanen wandte Susan Shwartz sich eher selten benutzten Settings oder Themen zu: In Imperial Lady (1989, mit Andre Norton) erzählt sie von den Abenteuern einer chinesischen Prinzessin zur Zeit der Han-Dynastie, und in Empire of the Eagle (1993, mit Andre Norton) von denen einer Gruppe römischer Legionäre, die nach ihrer Niederlage in der Schlacht bei Carrhae in die Sklaverei verkauft werden und nach Zentralasien geraten; The Grail of Hearts (1992), der es unter dem Titel Der Wald von Broliande (1995) als einziger ihrer Romane zu einer deutschen Ausgabe gebracht hat, ist eine feministisch geprägte Version von Wagners Parsifal, während Shards of Empire (1996) und Cross and Crescent (1997) einmal mehr Byzanz zum Schauplatz haben, wobei dieses Mal die Schlacht bei Manzikert bzw. der erste Kreuzzug für den historischen Hintergrund sorgen.
Parallel zu ihren Romanen hat Susan Shwartz zwischen 1980 und 1999 auch noch mehrere Dutzend Kurzgeschichten verfasst und sieben Anthologien herausgegeben. Immerhin eine davon – Hecate’s Cauldron (1982) – wurde als Hexengeschichten (1985) auch hierzulande veröffentlicht. Inzwischen hat sie sich fast ausschließlich auf das Schreiben von SF-Romanen verlegt, von denen seit der Jahrtausendwende eine gute Handvoll erschienen sind.
Bibliotheka Phantastika gratuliert Holly Phillips, die heute 45 Jahre alt wird. Ihre allerersten literarischen Gehversuche machte die am 25. Dezember 1969 in Nelson in der kanadischen Provinz British Columbia geborene Holly Phillips im kanadischen Phantastik-Magazin On Spec, wo – beginnend mit “No Such Thing As an Ex-Con” – von 2000 bis 2002 ein knappes halbes Dutzend ihrer Geschichten erschienen. Weitere Stories in kleinauflagigen Magazinen und Kleinverlagsanthologien folgten; eine davon wurde nicht nur für den International Horror Guild Award nominiert, sondern wenig später auch zur Titelgeschichte ihrer ersten Kurzgeschichtensammlung In the Palace of Repose (2005).
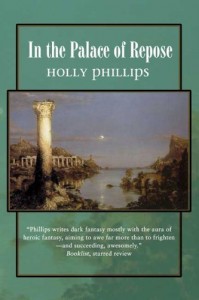 Besagte Sammlung – in der neben zwei Nachdrucken sieben Erstveröffentlichungen enthalten sind – deckt fast die gesamte Bandbreite moderner Phantastik von beinahe (aber eben nicht ganz) “klassischer” Fantasy bis hin zum Slipstream ab und überzeugt nicht zuletzt dadurch, wie souverän Holly Phillips ihre teils altbekannte Topoi variierenden, teils mit originellen Ideen aufwartenden Stories auch stilistisch umsetzt. Dies dürfte mit dazu beigetragen haben, dass In the Palace of Repose 2006 für den World Fantasy Award nominiert wurde.
Besagte Sammlung – in der neben zwei Nachdrucken sieben Erstveröffentlichungen enthalten sind – deckt fast die gesamte Bandbreite moderner Phantastik von beinahe (aber eben nicht ganz) “klassischer” Fantasy bis hin zum Slipstream ab und überzeugt nicht zuletzt dadurch, wie souverän Holly Phillips ihre teils altbekannte Topoi variierenden, teils mit originellen Ideen aufwartenden Stories auch stilistisch umsetzt. Dies dürfte mit dazu beigetragen haben, dass In the Palace of Repose 2006 für den World Fantasy Award nominiert wurde.
In mehreren Beiträgen der Sammlung taucht das Motiv der Entfremdung auf (am stärksten in “The Other Grace”); daher ist es nicht weiter verwunderlich, dass es auch in Holly Phillips’ erstem Roman The Burning Girl (2006) eine zentrale Rolle spielt. Die Entfremdung, die die junge, zumeist nur Rye genannte Synästhetikerin Ryder Coleman empfindet, ist angesichts der Tatsache, dass sie unter Amnesie und am ganzen Körper auftretenden, immer wieder blutenden Läsionen leidet, leicht nachzuvollziehen. Und ihre zurückkehrenden Erinnerungen, die besagen, dass sie von Aliens entführt und zu einer Waffe gemacht wurde, machen ihr das Leben nicht unbedingt leichter … Das Ganze ergibt eine düstere Urban-Fantasy-Variante mit SF- und Horroreinsprengseln, die ein bisschen unter Pacing-Problemen leidet, bei der der Plot aber ohnehin eine untergeordnete Rolle spielt.
Auch in Holly Phillips’ zweitem Roman The Engine’s Child (2008) steht eine junge Frau im Mittelpunkt der Handlung: Moth ist ein Kind der Gezeitenslums und somit eine Ausnahme unter den Lehrlingen eines religiösen Ordens, der mit rigiden Mitteln die Gesellschaft bzw. das ganze Leben auf der Insel Rasnan kontrolliert. Was Gründe hat, denn um Rasnan herum gibt es nichts als einen riesigen Ozean, und die Menschen, die dort (mit Mitteln und aus Gründen, die das Setting – je nach Lesart bzw. der Überzeugung bestimmter Figuren – mal als SF, mal als Fantasy verorten) Zuflucht gefunden haben, können nirgendwo sonst leben. Sie leben allerdings unterschiedlich gut, je nachdem, zu welcher gesellschaftlichen Gruppierung sie gehören. Angesichts ihres unterprivilegierten Hintergrunds ist es kein Wunder, dass Moth rebellische Gedanken hegt – und da sie die (magische?) Macht des Mundab genannten Ozeans nutzen kann, haben ihre Pläne durchaus Aussicht auf Erfolg. Allerdings kann zwischen der Entwicklung eines Plans und dessen Umsetzung viel passieren … The Engine’s Child ist kein einfacher Roman, denn Hintergrund, Setting und der eigentliche Plot sind deutlich komplexer als hier angedeutet und werden von etlichen Gegensatzpaaren geprägt. Dessen umgeachtet ist der Roman stilistisch wieder brillant erzählt, was es einem leichter macht, mit der nicht immer nur sympathischen Heldin klarzukommen.
Parallel zu ihren Romanen und danach hat Holly Phillips weitere Stories veröffentlicht – ein paar davon wurden in dem Band At the Edge of Waking (2012) gesammelt – doch insgesamt ist ihr Ausstoß in den letzten Jahren deutlich geringer geworden. Ob das mit ihrem Gesundheitszustand zu tun hat (bereits in den 90er Jahren wurde bei ihr Fibromyalgie diagnostiziert) oder damit, dass der Markt für ihre ziemlich weit weg vom derzeit angesagten Fantasy-Mainstream angesiedelten Geschichten und Romane kleiner geworden ist, lässt sich aus der Ferne nicht beurteilen. Was die Tatsache an sich nicht weniger bedauerlich macht.
Bibliotheka Phantastika gratuliert Michael Moorcock, der heute 75 Jahre alt wird. Auch wenn der am 18. Dezember 1939 in Mitcham (damals noch eine Stadt in der englischen Grafschaft Surrey, mittlerweile ein Stadtteil von Greater London) geborene Michael John Moorcock auf dem deutschen Buchmarkt aktuell nicht (mehr) präsent ist (oder genauer: nur in Form einer Comicadaption seines bekanntesten Helden und in Second-Hand-Ausgaben) und ein großer Teil der jüngeren deutschsprachigen Fantasyleserinnen und -leser mit dem Namen möglicherweise gar nichts mehr anfangen kann, ändert das nichts an seiner Bedeutung vor allem für die englische, aber letztlich für die gesamte angloamerikanische SF- und Fantasy-Szene. Egal, ob als Herausgeber des SF-Magazins New Worlds (1964-69), das er praktisch zu einem Sprachrohr der britischen New Wave machte, als Schöpfer des Konzepts des “Ewigen Helden” (dessen erste und bekannteste Inkarnation Elric von Melniboné anfangs ein schlichter Anti-Conan war, der seine ersten Auftritte 1961/62 auf den Seiten des Magazins Science Fantasy erlebte, und dessen Stories erst nachträglich in das Konzept des Ewigen Helden ein- und aus diesem Grund auch teilweise umgearbeitet wurden, was die Elric-Saga zu einem bibliographischen Alptraum macht) und des Multiversums (das in seinem ersten SF-Roman The Sundered Worlds (Magazinveröffentlichung 1962/63 in Science Fiction Adventures, Buchveröffentlichung 1965 bzw. als The Blood Red Game 1970) zum ersten Mal als Begriff auftaucht und als Hintergrund für seine SF- und Fantasywelten dient) oder als Verfasser teilweise locker mit dem Metazyklus um den Ewigen Helden verknüpfter, teilweise davon unabhängiger höchst unterschiedlicher Romane und Zyklen, als da beispielsweise wären: die Kane of Old Mars Trilogy (1965, ein Burroughs-Pastiche unter dem Pseudonym Edward P. Bradbury), der 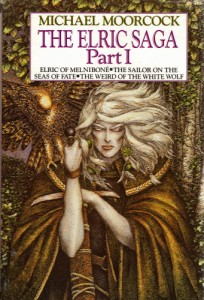 zumindest von gläubigen Christen als reichlich blasphemisch empfundene Zeitreiseroman Behold the Man (1969; die Erweiterung einer bereits 1966 erschienenen und mit dem Nebula ausgezeichneten gleichnamigen Erzählung), das Cornelius Quartet (1968-72) mit dem anarchistischen und amoralischen, wie eine popkulturelle Ikone des Swinging London der 60er Jahre inszenierten Antihelden Jerry Cornelius (der ein wenig wie eine Parodie des wandelnden Weltschmerz namens Elric wirkt), die Proto-Steampunk-Trilogie um Oswald Bastable (1971-81), die weit in der Zukunft in einem Dying-Earth-Szenario angesiedelte, als Dancers at the End of Time betitelte Sequenz um Jherek Carnelian (die aus einer Trilogie (1972-74) und zwei mit ihr zusammenhängenden Bänden (1976/77) besteht) oder auch der in einem elisabethanischen Fantasy-England (und dort größtenteils in einer Burg) spielende, von unterschwelliger Sexualität durchzogene Fantasyroman Gloriana, or, The Unfulfill’d Queen (1978).
zumindest von gläubigen Christen als reichlich blasphemisch empfundene Zeitreiseroman Behold the Man (1969; die Erweiterung einer bereits 1966 erschienenen und mit dem Nebula ausgezeichneten gleichnamigen Erzählung), das Cornelius Quartet (1968-72) mit dem anarchistischen und amoralischen, wie eine popkulturelle Ikone des Swinging London der 60er Jahre inszenierten Antihelden Jerry Cornelius (der ein wenig wie eine Parodie des wandelnden Weltschmerz namens Elric wirkt), die Proto-Steampunk-Trilogie um Oswald Bastable (1971-81), die weit in der Zukunft in einem Dying-Earth-Szenario angesiedelte, als Dancers at the End of Time betitelte Sequenz um Jherek Carnelian (die aus einer Trilogie (1972-74) und zwei mit ihr zusammenhängenden Bänden (1976/77) besteht) oder auch der in einem elisabethanischen Fantasy-England (und dort größtenteils in einer Burg) spielende, von unterschwelliger Sexualität durchzogene Fantasyroman Gloriana, or, The Unfulfill’d Queen (1978).
Alle bisher genannten Titel sind – teilweise mehrfach – auch auf Deutsch erschienen, und in den 70er und 80er Jahren war der Ewige Held in seinen Inkarnationen Elric von Melniboné, Corum Jhaelen Irsei, Dorian Hawkmoon und Erekosë alias John Daker auf dem deutschen Buchmarkt ebenso präsent wie Königin Gloriana, der Zeitreisende Karl Glogauer, Michael Kane, Jerry Cornelius, Oswald Bastable und Jherek Carnelian. Doch auch wenn sich hinter diesen Namen eine erkleckliche Anzahl von Büchern verbirgt, decken sie nur einen Teil von Michael Moorcocks Schaffen ab – und zwar bis auf wenige Ausnahmen den Teil, den man den trivialeren nennen könnte. Denn in gewisser Hinsicht hat sich Moorcock eigentlich immer in einem Spannungsfeld aus Anspruch und Trivialität bewegt, hat beispielsweise mit dem Ewigen Helden ein Konzept geschaffen, das deutlich über das hinausgeht, was bis dahin in der Sword & Sorcery üblich war. Die Umsetzung dieses Konzepts ist jedoch nur teilweise gelungen, denn die Geschichten um Elric und die anderen bereits genannten Inkarnationen des Ewigen Helden sind – ungeachtet ihres Unterhaltungswerts – ebenso trivial wie die Stories und Romane, deren Antithese sie eigentlich bilden sollten (nur sind sie manchmal cleverer inszeniert).
Allerdings hat Michael Moorcock sehr wohl Romane verfasst, in denen ein anspruchsvolleres Konzept auch angemessen umgesetzt wurde, die es aber längst nicht alle nach Deutschland geschafft haben. Gloriana, or, The Unfulfill’d Queen gehört dazu, genau wie das Cornelius Quartet, aber dann wird’s allmählich düster. Die interessantesten Inkarnationen des Ewigen Helden dürften die Mitglieder der Familie von Bek sein, doch von den Romanen, in denen sie auftreten, haben die deutschen Leser und Leserinnen nur The Warhound and the World’s Pain (1981) als Die Kriegsmeute (1985) und The Brothel in Rosenstrasse (1982) als Das Bordell in der Rosenstrasse (1988) sowie The Dreamthief’s Daughter (2001) als Tochter der Traumdiebe (2002) und Teil einer neuen Elric-Sequenz zu Gesicht bekommen. Von der vierbändigen Serie Between the Wars (1981, ’84, ’96 und 2006), in deren Mittelpunkt mit Colonel Pyat eine nicht unbedingt sympathische Figur steht, durch deren Augen wir einen Blick auf ein grotesk verzerrtes, aber angeblich wahres 20. Jahrhundert werfen können, ist nur der erste Band Byzantium Endures (1981) als Byzanz ist überall (1984) auf Deutsch erschienen, und Moorcocks vielleicht ambitioniertestes Werk Mother London (1988), mit dem er sich nicht zuletzt seine frühesten Kindheitserinnerungen an das brennende London zu Kriegszeiten von der Seele geschrieben haben dürfte, harrt ebenso noch einer Übersetzung wie so ziemlich alles, was er seit Mitte der 90er Jahre geschrieben hat. Dass Wizardry and Wild Romance: A Study of Epic Fantasy (1987), seine nicht unumstrittene “Abrechnung” mit der Fantasy hierzulande nie erschienen ist, ist einerseits zu verschmerzen, andererseits ein Beleg für die sekundärliterarische Diaspora, die Deutschland in Sachen SF und Fantasy immer noch darstellt.
Wer also nur Michael Moorcocks auf Deutsch erhältliche Zyklen, Romane und Geschichten kennt, kennt nur einen Teil seines Schaffens. Wer sie nicht kennt, kennt einen der wichtigsten und bedeutendsten englischen SF-und Fantasyautoren nicht, der etliche angloamerikanische Autoren und Autorinnen beeinflusst hat und in England und den USA auch heute noch hohes Ansehen genießt. Und das, obwohl einer seiner wichtigsten Helden ein blasser, schwächlicher Jammerlappen ist … 😉
Bibliotheka Phantastika gratuliert J.M. McDermott, der heute seinen 35. Geburtstag feiert. Als relativ junger und eher in der literarischen Ecke des Genres beheimateter Autor ist der am 17. Dezember 1979 geborene J.M. McDermott für die meisten deutschen Leser und Leserinnen wahrscheinlich keine bekannte Größe, zumal sein Werk nicht in Großverlagen erscheint und bisher auch nicht übersetzt wurde.
Schon sei Debütroman Last Dragon (2008) lässt erahnen, woran das vielleicht liegen könnte: Die als Rückblick erzählte Geschichte von Zhan, die einst auszog, um ihren Großvater aufzuspüren, der offensichtlich nach einem von ihm angerichteten Gemetzel an der Familie geflohen ist, besteht aus vielen ineinandergreifenden Fragmenten, in denen Zeiten, Personen und Geschehnisse verschwimmen.
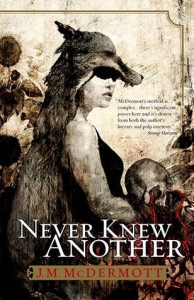 Vieles, was man über Last Dragon sagen könnte – etwa über die eindringlichen Einblicke ins Innenleben der Figuren, die düstere, hauptsächlich durch die unteren gesellschaftlichen Gruppen betrachtete Welt und den poetischen Stil, in dem das Ganze verfasst ist –, trifft auch auf McDermotts darauf folgende Dogsland Trilogy zu. Mit den Bänden Never Knew Another (2011), When We Were Executioners (2012) und We Leave Together (2014) – die Pause ist wohl den Problemen des Verlags Night Shade Books geschuldet – verfolgt sie das Schicksal zweier namensloser Dämonenjäger, ein Paar mit der Fähigkeit, die Gestalt von Wölfen anzunehmen und die Erinnerungen anderer nachzuerleben. Sie sehen es als ihre heilige Pflicht, die Welt von der Bedrohung durch mit Dämonenblut verseuchte Menschen zu befreien. Man erfährt gleichzeitig die Geschichte ihrer Jagd und die aufgenommenen Erinnerungen eines der Dämonen (der mit Beginn der Handlung bereits tot ist), und muss sich dabei unangenehmen Fragen stellen, etwa der, ob das angenommene absolute Böse des Dämons nicht doch ein Produkt der gnadenlosen (und argwöhnischen) städtischen Gesellschaft sein könnte, die ihm nichts anderes lässt als eine schiefe Laufbahn. Auch hier liegt ein sperriger, fragmentarischer Text vor, den man sich regelrecht erarbeiten muss, um die rückwärts aufgerollte, in Rahmen- und Binnengeschichte gegliederte Handlung nachzuvollziehen, die vor allem durch ihre Knappheit besticht und nur das Allernötigste vermittelt – und erstaunlicherweise trotzdem auf merkwürdige Weise zu faszinieren, anrühren und erschrecken weiß.
Vieles, was man über Last Dragon sagen könnte – etwa über die eindringlichen Einblicke ins Innenleben der Figuren, die düstere, hauptsächlich durch die unteren gesellschaftlichen Gruppen betrachtete Welt und den poetischen Stil, in dem das Ganze verfasst ist –, trifft auch auf McDermotts darauf folgende Dogsland Trilogy zu. Mit den Bänden Never Knew Another (2011), When We Were Executioners (2012) und We Leave Together (2014) – die Pause ist wohl den Problemen des Verlags Night Shade Books geschuldet – verfolgt sie das Schicksal zweier namensloser Dämonenjäger, ein Paar mit der Fähigkeit, die Gestalt von Wölfen anzunehmen und die Erinnerungen anderer nachzuerleben. Sie sehen es als ihre heilige Pflicht, die Welt von der Bedrohung durch mit Dämonenblut verseuchte Menschen zu befreien. Man erfährt gleichzeitig die Geschichte ihrer Jagd und die aufgenommenen Erinnerungen eines der Dämonen (der mit Beginn der Handlung bereits tot ist), und muss sich dabei unangenehmen Fragen stellen, etwa der, ob das angenommene absolute Böse des Dämons nicht doch ein Produkt der gnadenlosen (und argwöhnischen) städtischen Gesellschaft sein könnte, die ihm nichts anderes lässt als eine schiefe Laufbahn. Auch hier liegt ein sperriger, fragmentarischer Text vor, den man sich regelrecht erarbeiten muss, um die rückwärts aufgerollte, in Rahmen- und Binnengeschichte gegliederte Handlung nachzuvollziehen, die vor allem durch ihre Knappheit besticht und nur das Allernötigste vermittelt – und erstaunlicherweise trotzdem auf merkwürdige Weise zu faszinieren, anrühren und erschrecken weiß.
McDermotts nächster Roman Maze (2013), eine Geschichte über Leute, die in einem unerklärlichen Labyrinth verloren sind und deren Zeiten und Wege sich vielfach kreuzen, zehrt ebenfalls wieder von der ausgeprägten Vorliebe des Autors für verschachtelte Strukturen und nonlineare Abläufe, und es steht zu erwarten, dass das auch auf das just erschienene Straggletaggle (2014) zutrifft, in dem McDermott Steampunk-Sachsen und Bayern in den Krieg schickt.
J.M. McDermott bewegt sich mit seinen Romanen, in denen Magie und phantastische Elemente oft in erster Linie die Erzählparameter festlegen, aber in den Geschichten selbst nur zurückhaltend vorkommen, eher am Rande des Genres und ist sicher kein Autor für Abschalt-Unterhaltung, aber seine ungewöhnlichen Ansätze und die neuen Blickwinkel, die er aus klassischen Setups (wie der Dämonenjagd) herausholt, sind keine unspannende Lektüre.
Außerdem möchten wir die Gelegenheit nutzen, an Jack L. Chalker zu erinnern, der heute 70 Jahre alt geworden wäre. Im Gegensatz zu seinem gerade einmal halb so alten Kollegen hat sich der am 17. Dezember 1944 in Norfolk, Virginia (oder in Baltimore, Maryland, so ganz einig sind sich die diversen Quellen da nicht), geborene Jack Laurence Chalker immer mitten im Genre bewegt, und zwar da, wo es vor allem bunt und abenteuerlich ist. Das gilt für seine ganze Karriere, sei es als Fanzinemacher, als Verleger und Autor eines Kleinverlags, der sich auf Bibliographien phantastischer Literatur und Studien zu Pulp-Größen wie H.P. Lovecraft oder C.A. Smith spezialisiert hatte, und last but not least als professioneller Schriftsteller.
Chalkers letztgenannte Karriere begann mit der Space Opera A Jungle of Stars (1976; dt. Armee der Unsterblichen (1978)), in der Menschen und andere Lebewesen sozusagen als Stellvertreter den Konflikt zweier Aliens (die sich als ehemalige Götter entpuppen) auf einer als Arena dienenden Welt auszutragen haben.
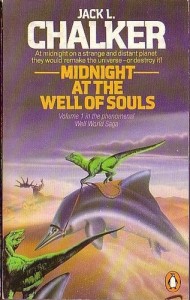 Sein nächster Roman Midnight at the Well of Souls (1977) wurde zum Überraschungserfolg, was mehrere Konsequenzen hatte: zunächst einmal wurde aus ihm im Nachhinein der Auftakt zur Saga of the Well of Souls, einer mit den Bänden Exiles at the Well of Souls, Quest for the Well of Souls (beide 1978), The Return of Nathan Brazil und Twilight at the Well of Souls (beide 1980) in kurzen Abständen fortgesetzten Serie, die Chalkers größter Erfolg bleiben sollte, und die er folgerichtig Jahre später zunächst mit der Trilogie The Watchers at the Well (Einzeltitel: Echoes of the Well of Souls (1993), Shadow of the Well of Souls und Gods of the Well of Souls (beide 1994)) und schließlich mit den beiden Bänden The Sea is Full of Stars (1999) und Ghost of the Well of Souls (2000) weiterführte. Da zudem auch seine zweite Serie – der von 1981 bis ’83 erschienene SF-Vierteiler The Four Lords of the Diamond – ebenfalls recht erfolgreich war, verlegte sich Chalker in den 80er und 90er Jahren hauptsächlich auf das Verfassen von mehrbändigen Werken (die er nach eigener Aussage auch leichter an die Verlage verkaufen konnte), so dass der Großteil seiner fast 60 Romane aus serienabhängigen Titeln besteht.
Sein nächster Roman Midnight at the Well of Souls (1977) wurde zum Überraschungserfolg, was mehrere Konsequenzen hatte: zunächst einmal wurde aus ihm im Nachhinein der Auftakt zur Saga of the Well of Souls, einer mit den Bänden Exiles at the Well of Souls, Quest for the Well of Souls (beide 1978), The Return of Nathan Brazil und Twilight at the Well of Souls (beide 1980) in kurzen Abständen fortgesetzten Serie, die Chalkers größter Erfolg bleiben sollte, und die er folgerichtig Jahre später zunächst mit der Trilogie The Watchers at the Well (Einzeltitel: Echoes of the Well of Souls (1993), Shadow of the Well of Souls und Gods of the Well of Souls (beide 1994)) und schließlich mit den beiden Bänden The Sea is Full of Stars (1999) und Ghost of the Well of Souls (2000) weiterführte. Da zudem auch seine zweite Serie – der von 1981 bis ’83 erschienene SF-Vierteiler The Four Lords of the Diamond – ebenfalls recht erfolgreich war, verlegte sich Chalker in den 80er und 90er Jahren hauptsächlich auf das Verfassen von mehrbändigen Werken (die er nach eigener Aussage auch leichter an die Verlage verkaufen konnte), so dass der Großteil seiner fast 60 Romane aus serienabhängigen Titeln besteht.
Während einige dieser Serien eindeutig der SF zuzurechnen sind, bewegen sich andere in einer Grauzone zwischen SF und Fantasy bzw. lesen sich wie Fantasy vor einem SF-Hintergrund, der mal deutlicher ausgeprägt ist – wie in der Saga of the Well of Souls oder The Rings of the Master (vier Bände, 1986-88) –, mal weniger deutlich oder fast gar nicht zum Tragen kommt, wie in Flux & Anchor (auch als Soul Rider, fünf Bände, 1984-86), The Dancing Gods (fünf Bände, 1984-95) oder Changewinds (drei Bände, 1987-88). Auffällig ist dabei, dass in so ziemlich allen diesen Serien (und auch fast allen anderen) immer wieder zwar leicht abgewandelte, aber sich doch sehr ähnliche Plotelemente und thematische Aspekte auftauchen, die sich bereits in Chalkers Erstling andeuteten und in Midnight at the Well of Souls erkennbarer wurden.
In besagtem Roman bzw. dem ganzen Zyklus, dessen erste fünf Bände als Sechseck-Welt-Zyklus auch auf Deutsch erschienen sind (Einzeltitel: Die Sechseck-Welt, Exil Sechseck-Welt, Entscheidung in der Sechseck-Welt (alle 1980), Rückkehr auf die Secheck-Welt und Dämmerung auf der Sechseck-Welt (beide 1981)), finden sich Menschen und andere Wesen plötzlich auf einer Welt wieder, deren Oberfläche aus unzähligen, scharf voneinander abgegrenzten Sechsecken besteht, in denen völlig unterschiedliche Bedingungen herrschen (physikalisch, technologisch und zivilisatorisch) und die unterschiedlichesten Lebensformen leben. Wobei alle Neuankömmlinge nackt und in einem fremden Körper auf der Sechseck-Welt landen und es keineswegs sicher ist, dass sie diesen Körper längere Zeit behalten. Die Sechseck-Welt ist nämlich eigentlich ein vom ausgestorbenen Volk der Markovier gebauter Supercomputer, dessen unterschiedliche Oberflächensegmente als eine Art Labor für ihre Forschungen gedient haben. Doch dann ist irgendetwas schiefgegangen …
Gewöhnliche Sterbliche, die ihrer normalen Umgebung entrissen werden und fast immer splitternackt (aber nicht immer im eigenen Körper) in einer exotischen und manchmal völlig unverständlichen Umwelt auftauchen, die körperlich oder geistig versklavt werden und zum Teil mehrfach groteske Metamorphosen durchlaufen, bis sie schließlich erkennen, dass sie nur Spielfiguren in einem Spiel sind, das unfassbar alte oder mächtige Wesen zum Zeitvertreib spielen oder gespielt haben, und die am Schluss häufig mit dem belohnt werden, was sie sich am meisten wünschen – das ist in etwa das Muster, nach dem Chalkers Science-Fantasy-Zyklen (mit gelegentlichen leichten Abweichungen) aufgebaut sind. Seine bunten, anschaulich beschriebenen exotischen Szenarien und seine immerhin äußerlich wirklich fremdartigen Aliens (die allerdings wie Menschen denken und handeln) machen seine frühen Zyklen zu typischen Beispielen für die Abenteuer-SF und -Fantasy der 80er Jahre (die man lesen kann, wenn man über die mal mehr, mal weniger deutlichen sexistischen Tendenzen hinwegsehen kann), während seine späteren (und auch die nachgeschobenen Bände der Saga of the Well) die ehemalige Erfolgsformel nur noch schematisch wiederholen.
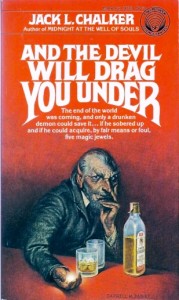 Neben all seinen Serien – von denen es beispielsweise der der Fantasy zuneigende Fünfteiler Flux & Anchor als Flux und Anker (fünf Bände, 1989-91) ebenfalls nach Deutschland geschafft hat – hat Chalker auch ein knappes Dutzend Einzelromane geschrieben; einer davon ist And the Devil Will Drag You Under (1979; dt. Fünf Zaubersteine zu binden fünf verschied’ne Welten (1981)), ein humoristischer Fantasyroman, in dem der Unterteufel Asmodeus Mogart eigentlich die Welt retten sollte – doch dafür müsste er aufhören, sich ständig zu besaufen. Da das für ihn nicht in Frage kommt, schickt er Menschen auf die Jagd nach den titelgebenden Zaubersteinen, die sich natürlich auf alternativen Welten befinden, auf denen es teilweise seltsam zugeht …
Neben all seinen Serien – von denen es beispielsweise der der Fantasy zuneigende Fünfteiler Flux & Anchor als Flux und Anker (fünf Bände, 1989-91) ebenfalls nach Deutschland geschafft hat – hat Chalker auch ein knappes Dutzend Einzelromane geschrieben; einer davon ist And the Devil Will Drag You Under (1979; dt. Fünf Zaubersteine zu binden fünf verschied’ne Welten (1981)), ein humoristischer Fantasyroman, in dem der Unterteufel Asmodeus Mogart eigentlich die Welt retten sollte – doch dafür müsste er aufhören, sich ständig zu besaufen. Da das für ihn nicht in Frage kommt, schickt er Menschen auf die Jagd nach den titelgebenden Zaubersteinen, die sich natürlich auf alternativen Welten befinden, auf denen es teilweise seltsam zugeht …
Neben diesem für Freunde humoristischer Fantasy durchaus lesbaren schrulligen Garn sei noch auf Dancers in the Afterglow (1978; dt. Der Touristenplanet (1982)) verwiesen, einen Einzelroman, den Chalker schon früh in seiner Karriere geschrieben hat, und der zeigt, dass er mehr gekonnt hätte als einen oberflächlich schillernden, aber ziemlich belanglosen Zyklus nach dem anderen zu verfassen.
Jack L. Chalker war immer ein – wenn auch zeitweise sehr erfolgreicher – Midlist-Autor, an dem allerdings die Entwicklung des bzw. der Genres ein bisschen vorbeigegangen ist. Die veränderten Marktbedingungen und gesundheitliche Probleme haben seinen zuvor zeitweise enormen Ausstoß in seinen letzten Lebensjahren verringert, und am 11. Februar 2005 ist er an den Folgen einer anderthalb Jahre zuvor diagnostizierten Herzinsuffizienz gestorben.
Bibliotheka Phantastika gratuliert R.A. MacAvoy, die heute 65 Jahre alt wird. Man kann wohl mit einer gewissen Berechtigung sagen, dass die am 13. Dezember 1949 in Cleveland, Ohio, geborene Roberta Ann MacAvoy eine der originellsten und interessantesten Autorinnen war, die im Laufe der 80er 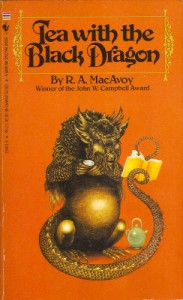 Jahre des vergangenen Jahrhunderts die Bühne der phantastischen Literatur betreten haben. Das deutete sich bereits bei der Veröffentlichung von Tea with the Black Dragon (1983) an, der nicht nur den Locus Award als bester Romanerstling gewonnen hat, sondern auch für alle anderen wichtigen Genrepreise – den Hugo, den Nebula und den World Fantasy Award – nominiert wurde und sich beim Philip K. Dick Award nur Tim Powers’ The Anubis Gates geschlagen geben musste. Wobei das wirklich Erstaunliche an der ganzen Sache ist, dass es sich bei Tea with the Black Dragon um einen in jeder Hinsicht unspektakulären Roman handelt, der mit leisen Zwischentönen, ungewöhnlichen Figuren und – ja, wirklich – einer nicht gerade alltäglichen Liebesgeschichte überzeugt.
Jahre des vergangenen Jahrhunderts die Bühne der phantastischen Literatur betreten haben. Das deutete sich bereits bei der Veröffentlichung von Tea with the Black Dragon (1983) an, der nicht nur den Locus Award als bester Romanerstling gewonnen hat, sondern auch für alle anderen wichtigen Genrepreise – den Hugo, den Nebula und den World Fantasy Award – nominiert wurde und sich beim Philip K. Dick Award nur Tim Powers’ The Anubis Gates geschlagen geben musste. Wobei das wirklich Erstaunliche an der ganzen Sache ist, dass es sich bei Tea with the Black Dragon um einen in jeder Hinsicht unspektakulären Roman handelt, der mit leisen Zwischentönen, ungewöhnlichen Figuren und – ja, wirklich – einer nicht gerade alltäglichen Liebesgeschichte überzeugt.
Der auf Deutsch als Stelldichein beim schwarzen Drachen (1986) erschienene Roman erzählt die Geschichte der fünfzigjährigen Martha Macnamara, die normalerweise in einer irisch-amerikanischen Céilíkapelle die Fiddle spielt und nach San Francisco gekommen ist, um ihre Tocher Elizabeth zu besuchen, die als Systemanalytikerin bei einer Firma im Silicon Valley arbeitet. An ihrem ersten Abend in der Stadt lernt sie einen anderen Hotelgast kennen: Mayland Long, einen ebenso geheimnisvollen wie faszinierenden chinesischen Gentleman, über den ihr der Barkeeper schnell noch ein Gerücht zuflüstert. Doch als sie wenig später feststellt, dass ihre Tochter spurlos verschwunden und vielleicht in ein Verbrechen verwickelt ist, bleibt ihr nur die Hoffnung, dass Mayland Long ihr hilft, sogar – oder erst recht – wenn er ein chinesischer Drache in Menschengestalt ist, wie der Barkeeper behauptet …
Die Suche nach Liz und die Frage, in was genau sie möglicherweise verwickelt ist, bildet nur den groben Rahmen, der Martha Macnamara, vor allem aber Mayland Long den Raum gibt, sich zu entfalten (was bei Letzterem zu der einen oder anderen Überraschung führt). Auch wenn man dem Roman in allem, was mit Computern zu tun hat, natürlich sein Alter anmerkt, dürfte er zumindest Lesern und Leserinnen, die Geschichten mögen, die von überzeugend gezeichneten Figuren getragen werden, auch heute noch Spaß machen – denn viel besser als Martha und Mayland kann man eine Geschichte nicht tragen.
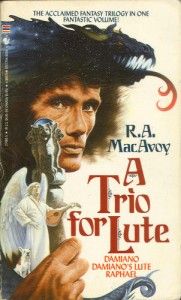 1984 wurde R.A. MacAvoy nicht nur mit dem John W. Campbell Award als Best New Writer ausgezeichnet, sondern wandte sich mit der aus den Bänden Damiano, Damiano’s Lute und Raphael (alle 1984) bestehenden Damiano Series (die auch als A Trio For Lute bekannt ist und unter diesem Titel 1985 bzw. 1988 als Sammelband veröffentlicht wurde) auch einem neuen Setting (und Subgenre) zu: statt im zeitgenössischen San Francisco spielt Die Parabel vom Lautenspieler (Einzeltitel: Damiano, Saara, Raphael (alle 1985)) in einem deutlich fantasyhafteren alternativen Renaissance-Italien. Hier lebt der junge Damiano Delstrego, ein überzeugter Christ, der – als Sohn eines Zauberers und Erbe dunkler Magie – außerdem ein Alchimist und Hexer ist, dem die Bürger seiner Heimatstadt Partestrada nach Möglichkeit aus dem Weg gehen. Damiano selbst würde am liebsten Musiker werden und lässt sich vom Erzengel Raphael im Lautespielen unterrichten. Als der Krieg nach Partestrada kommt, muss er sich – begleitet von seinem familiar Macchiata, einem sprechenden Hund – auf eine Wallfahrt begeben, die ihn weit über die Grenzen Italiens und seine eigenen hinausführen wird, denn die Magie in seinem Innern stammt nicht von Gott …
1984 wurde R.A. MacAvoy nicht nur mit dem John W. Campbell Award als Best New Writer ausgezeichnet, sondern wandte sich mit der aus den Bänden Damiano, Damiano’s Lute und Raphael (alle 1984) bestehenden Damiano Series (die auch als A Trio For Lute bekannt ist und unter diesem Titel 1985 bzw. 1988 als Sammelband veröffentlicht wurde) auch einem neuen Setting (und Subgenre) zu: statt im zeitgenössischen San Francisco spielt Die Parabel vom Lautenspieler (Einzeltitel: Damiano, Saara, Raphael (alle 1985)) in einem deutlich fantasyhafteren alternativen Renaissance-Italien. Hier lebt der junge Damiano Delstrego, ein überzeugter Christ, der – als Sohn eines Zauberers und Erbe dunkler Magie – außerdem ein Alchimist und Hexer ist, dem die Bürger seiner Heimatstadt Partestrada nach Möglichkeit aus dem Weg gehen. Damiano selbst würde am liebsten Musiker werden und lässt sich vom Erzengel Raphael im Lautespielen unterrichten. Als der Krieg nach Partestrada kommt, muss er sich – begleitet von seinem familiar Macchiata, einem sprechenden Hund – auf eine Wallfahrt begeben, die ihn weit über die Grenzen Italiens und seine eigenen hinausführen wird, denn die Magie in seinem Innern stammt nicht von Gott …
Das norditalienische Piemont einer Alternativwelt, in der Magie existiert, zu einer Zeit, in der Norditalien von miteinander rivalisierenden Stadtstaaten beherrscht wurde, der Papst sich im Exil in Avignon befand und Europa unter dem “Schwarzen Tod” litt – sprich: wir befinden uns im 14. Jahrhundert –, war zumindest Anfang der 80er Jahre kein typisches Fantasysetting. Zu diesem zwar andersweltlichen, aber eben auch untypischen Setting gesellen sich Figuren, die (damals) mindestens ebenso ungewöhnlich waren. Das gilt einerseits für Raphael und seinen Bruder Luzifer als Exponenten von Gut und Böse, vor allem aber für Damiano, einen in mehrfacher Hinsicht “unschuldigen” jungen Mann (er ist zu Beginn der Trilogie 23 Jahre alt und hat zu diesem Zeitpunkt noch nie mit einer Frau geschlafen), der Gutes tun will und dafür auf das Böse in sich zurückgreifen muss, was ihn vor ein schier unlösbares moralisches Dilemma stellt. Dass die Trilogie trotz dieser Zutaten nicht hundertprozentig funktioniert, liegt einerseits ein bisschen an Damiano selbst, den man heutzutage vermutlich verächtlich als “Gutmenschen” bezeichnen würde, und dessen Naivität gelegentlich enervierend sein kann, andererseits an strukturellen Problemen (die ersten beiden Bände sind ein Entwicklungsroman mit Damiano als Hauptfigur – der sich auch tatsächlich entwickelt und seine Unschuld verliert – doch mit dem dritten Band, in dem es um das Schicksal des zum Menschen gewordenen Raphael geht, ändert sich das völlig) und einer immer spürbaren, letztlich dem Setting geschuldeten Düsternis. Was R.A. MacAvoy aber auch in dieser Trilogie wieder gelingt, sind die kleinen Szenen, die Art und Weise, wie sie die Magie der Musik zum Leben erweckt oder den Umgang der Figuren miteinander (und mit den Problemen, mit denen sie zu kämpfen haben, an denen sie wachsen oder scheitern) schildert.
Möglicherweise waren besagte strukturelle Probleme mit dafür verantwortlich, dass MacAvoy sich danach zunächst wieder Einzelromanen zugewandt hat. In The Book of Kells (1985) geht es um eine Zeitreise, die aus dem Hier und Heute ins Irland des 10. Jahrhunderts und in die irische Mythologie führt, während The Grey Horse (1987) zwar ebenfalls in Irland spielt, aber dieses Mal gegen Ende des 19. Jahrhunderts in Connemara, wo sich ein púca in Gestalt eines grauen Hengstes dem Widerstand der Iren gegen die englischen Besatzer anschließt. Mit Twisting the Rope (1986; dt. Der schwarze Drache lädt zum Lunch (1987)) legte sie eine Fortsetzung zu Tea with the Black Dragon vor, in der Martha Macnamara und Mayland Long mit Marthas Céilíkapelle auf Tour sind und in einen Mordfall verwickelt werden, die aber – trotz der Tatsache, dass Martha und Mayland immer noch faszinierende Figuren sind – nicht an die Klasse des Vorgängerbandes heranreicht. Mit The Third Eagle (1989) folgte noch ein kurzer Abstecher in die SF, ehe sie sich mit Lens of the World (1990) ihrer zweiten, gleichnamigen Trilogie zuwandte (die gelegentlich auch als Nazhuret of Sordaling – nach ihrer Hauptfigur – betitelt wird).
Dass auch diese Trilogie wieder ungewöhnlichen Lesestoff bietet, wird schon beim Blick auf das Motto deutlich, das dem ersten Band vorangestellt ist (und sich auf Nazhuret bezieht): “You are the lens of the world: the lens through which the world may become aware of itself. The world, on the other hand, is the only lens in which you can see yourself. It is both lenses together that make vision.” Man sollte sich vom philosophischen oder spirituellen Gehalt dieser Sätze allerdings nicht abschrecken lassen, denn Lens of the World und die Folgebände King of the Dead (1991) und Winter of the Wolf (1993; auch als The Belly of the Wolf (1993)) bilden einen Entwicklungsroman, der – nicht zuletzt dank eines Zeitsprungs zwischen Band zwei und drei – 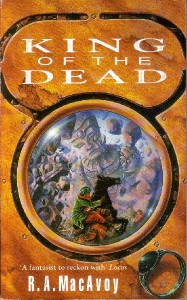 praktisch das ganze Leben Nazhurets umfasst. Und dieses Leben ist durchaus abenteuerlich, auch wenn es zunächst nicht so aussieht; der kleingewachsene, hässliche Nazhuret – eine Waise und ein Mischling – ist nämlich anfangs der Pflegling einer Elite-Militärakademie und muss dort einiges erdulden. Sein Schicksal scheint sich nur leicht zu bessern, als der geheimnisvolle Powl, der in einem merkwürdigen runden Gebäude mit noch merkwürdigeren Gerätschaften lebt, ihn zu seinem Lehrling macht und ihn nicht nur mehrere Sprachen, Natur- und Geisteswissenschaften lehrt, sondern auch stillzusitzen, zu denken, zu tanzen und (mit und ohne Waffen) zu kämpfen. Denn auf Nazhuret wartet ein besonderes Schicksal, von dem er selbst nichts ahnt …
praktisch das ganze Leben Nazhurets umfasst. Und dieses Leben ist durchaus abenteuerlich, auch wenn es zunächst nicht so aussieht; der kleingewachsene, hässliche Nazhuret – eine Waise und ein Mischling – ist nämlich anfangs der Pflegling einer Elite-Militärakademie und muss dort einiges erdulden. Sein Schicksal scheint sich nur leicht zu bessern, als der geheimnisvolle Powl, der in einem merkwürdigen runden Gebäude mit noch merkwürdigeren Gerätschaften lebt, ihn zu seinem Lehrling macht und ihn nicht nur mehrere Sprachen, Natur- und Geisteswissenschaften lehrt, sondern auch stillzusitzen, zu denken, zu tanzen und (mit und ohne Waffen) zu kämpfen. Denn auf Nazhuret wartet ein besonderes Schicksal, von dem er selbst nichts ahnt …
Dieses Schicksal macht aus ihm einen Landarbeiter, Hausmeister und Rausschmeißer, einen Abenteurer, Krieger und Philosophen, einen Berater des Königs und einen Ehemann und Vater, und er begegnet auf seiner langen Lebensreise feindlich und freundlich gesinnten Adligen, Soldaten, Dieben und Mördern, einem Werwolf und einem Drachen – und seiner großen Liebe. Das klingt wie schon tausendmal gelesen? Ja und nein. Die Abenteuer, die Nazhuret erlebt, sind nicht per se ungewöhnlich; was sie ungewöhnlich macht, ist die Art und Weise, wie er mit ihnen umgeht, ist überhaupt Nazhuret selbst, der einer der komplexesten Charaktere der modernen Fantasy sein dürfte, der im Laufe eines einzigen Buchs sichtbar und glaubhaft wächst, und dem noch nicht einmal seine Tochter im dritten Band – als er immerhin bereits über 50 ist – so ganz die Show stehlen kann, auch wenn sie sich alle Mühe gibt. Hinzu kommt ein vage renaissancehaftes (nicht direkt an irdische Vorbilder erinnerndes) Setting, in dem sich am Ende das Heraufdämmern einer moderneren Zeit abzeichnet. Strukturell geht R.A. MacAvoy in dieser Trilogie ebenfalls ungewöhnliche Wege, denn im ersten Band schreibt Nazhuret einen Teil seiner Lebensgeschichte (für seinen König) nieder (ja, auf diese Idee sind später auch andere, wesentlich bekanntere Autoren und Autorinnen gekommen), während der zweite ein Briefroman ist. Und das Ganze ist schlicht und ergreifend toll erzählt und stilistisch brillant geschrieben.
Mit der Trilogie um Nazhuret of Sordaling hat R.A. MacAvoy das Versprechen, das Tea with the Black Dragon darstellte, voll und ganz eingelöst – und ist anschließend sechzehn Jahre lang verstummt (denn erst 2009 ist mit der Erzählung In Between, die zwei Jahre später zum Roman Death and Resurrection erweitert wurde, wieder ein neues Werk von ihr erschienen, in dem es um den Künstler und Martial-Arts-Kämpfer Ewen Young geht, der zwischen der Welt der Lebenden und der der Toten hin und her reisen kann). Dies Rätsel wurde im Januar 2012 in einem Interview für das eBook-Magazin Lightspeed schließlich gelöst: “As for why nothing came between The Belly of the Wolf and the Ewen stories, well, Dystonia came between them. It’s a rare neuromuscular disease characterized by paralysis and pain. Or vice versa. … For about ten years they threw one set of pills after another into me, just to see what would happen. Of five of those years I have little or no memory. I finally decided to stop taking all those nasty things and just endure it. Meanwhile, some doctors who usually deal with Parkinson’s (not related, except for being a neuro-muscular disease and also progressive) developed a treatment for cervical and spinal muscles which had gone into permanent charley-horse by a Very Careful series of injections of Botox into the muscles right along the spinal column, to partially paralyze them. The idea is to find a mid-position between spasm and paralysis that approaches normality …”
Es wäre Roberta Ann MacAvoy so oder so zu wünschen, dass diese Behandlung dauerhaft die gewünschten Erfolge zeitigt. Und wenn sie dann vielleicht noch weitere Romane schreibt, die der Qualität von Tea with the Black Dragon oder der Lens of the World Trilogy zumindest nahekommen, würde das bestimmt die eine Leserin oder den anderen Leser freuen – ich kenne jedenfalls einen …