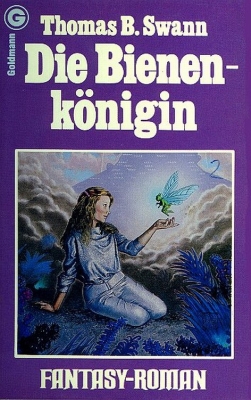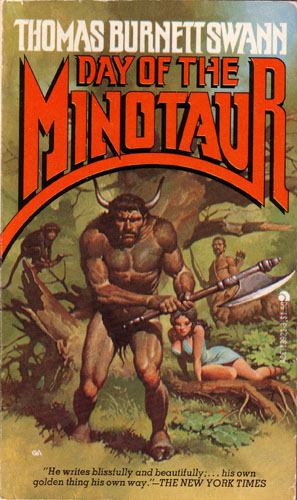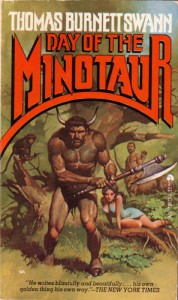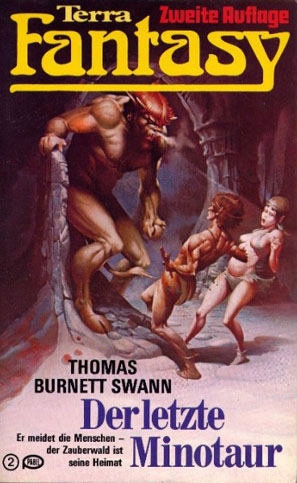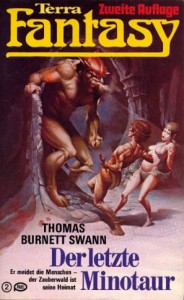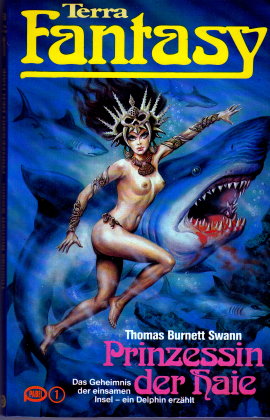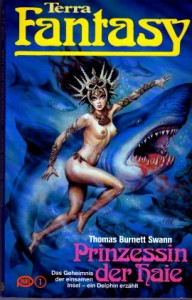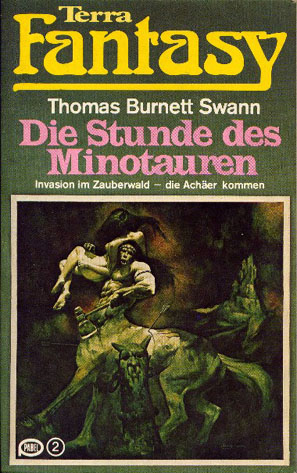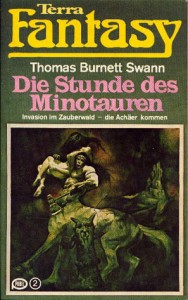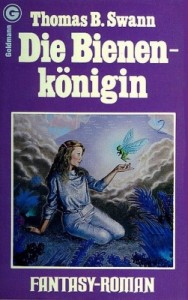 Die Vestalin Rhea, eine Tochter des ehemaligen Königs von Alba Longa, wird zum Tode verurteilt, nachdem sie Zwillinge geboren hat. Auch ihre Söhne sollen getötet werden, doch der damit beauftragte Hirte erbarmt sich ihrer und setzt sie aus. Sie werden von der Dryade Mellonia gerettet, die sie zusammen mit der Wölfin Luperca versorgt. Als Romulus und Remus junge Männer geworden sind, wollen sie den Tod ihrer Mutter rächen und den Thronräuber von Alba Longa vertreiben.
Die Vestalin Rhea, eine Tochter des ehemaligen Königs von Alba Longa, wird zum Tode verurteilt, nachdem sie Zwillinge geboren hat. Auch ihre Söhne sollen getötet werden, doch der damit beauftragte Hirte erbarmt sich ihrer und setzt sie aus. Sie werden von der Dryade Mellonia gerettet, die sie zusammen mit der Wölfin Luperca versorgt. Als Romulus und Remus junge Männer geworden sind, wollen sie den Tod ihrer Mutter rächen und den Thronräuber von Alba Longa vertreiben.
-Aber eine Schnecke taugt auch nicht viel, nicht wahr? Aber sie kriecht, sie schwenkt die Fühler und bringt uns zum Lachen, sie hinterlässt eine silberne Spur, und wenn sie stirbt, eine hübsche Muschel, wie Perlmutt. Ich würde eine Welt ohne Schnecken hassen.-
Thomas Burnett Swann ist der einzige Fantasy-Autor, der sich mit Leidenschaft und großer Kenntnis der Mythologie der Antike verschrieben hat. Leser, die sich wünschen, dass es schnell und eindeutig zur Sache geht, sollten den Autor abhaken, denn sie werden mit seinen lyrischen und verspielten Versionen der Sagen des klassischen Altertums, angesiedelt in pastoralen Landschaften voller Fabelwesen, die einem anderen Zeit- und Werteverständnis als die Menschen folgen, nicht gut bedient. Die mythologische Fantasy von Swann funktioniert am Besten für Freunde von Geschichten voller funkelnder Details, Szenen von großer Wärme und einer generellen Wertschätzung des Wie vor dem Was einer Geschichte.
Die Bienenkönigin (Lady of the Bees) ist eine Erweiterung der älteren Kurzgeschichte Der Feuervogel und bereichert diese um einige Aspekte, wie etwa Abschnitte, die aus der Sicht der Dryade Mellonia erzählt werden – abwechselnd mit Sylvan, einem jungen Faun. Der von Swann häufig gewählte Kunstgriff, Fabelwesen als Erzähler zu nutzen, ist durch diese Dualität, die sich auch in anderen Aspekten durch den Roman zieht, besonders gelungen: Sylvans Sorglosigkeit steht die Komplexität und Altersschwere der ewig jungen Dryade entgegen, mit der Weiterentwicklung der Geschichte und ihrer Figuren kehrt sich das Verhältnis jedoch um.
Swanns Antike ist ein goldenes Zeitalter im Herbst: Die Helden blicken selbst auf eine glänzendere Zeit zurück und sind sich bewusst, dass sie einer ausklingenden Ära angehören, dass die Magie im Niedergang begriffen ist, wodurch die Geschichte stets ein Hauch der Melancholie durchweht.
Der Stil, der damit einhergeht, ist üppig, schwelgerisch, selbst in der teilweise suboptimalen Übersetzung, die aus den fließenden, poetischen Sätzen manchmal etwas sperrige Konstrukte macht. Wie kaum ein anderer Autor schafft Swann diesen Balanceakt in einer Welt, in der sich Faune im Wald tummeln und Frauen Brüste wie Melonen haben können, ohne dass der Text überladen oder unpassend wirkt.
Hintergründiger Witz lockert die Erzählung ebenso auf wie eine teils subtile, teils direkte Frivolität, wie man sie auch bei Catull oder Ovid finden könnte. Die zivilisationsfernen Erzählstimmen von Sylvan und Mellonia, die zunächst keiner menschlichen Moral folgen, lassen trotzdem keine Zweifel daran, wo im Einzelnen Gut und Böse zu finden sind, wo die Grenze verläuft zwischen Objektivierung des Gegenüber und Respekt vor dem Anderen. Auf beinahe jeder Seite strahlt eine Wärme aus der Geschichte, die ihresgleichen sucht: Sei es in der unbescheiden-drolligen (Selbst-)Beschreibung des Fauns, bei den Details, mit denen die Waldtiere auftreten, oder der Verehrung von unbedeutend scheinenden Göttern.
Die Handlung von Die Bienenkönigin ist in drei Sätzen erzählt und weder komplex noch neu, doch sie entfaltet sich trotzdem wie eine griechische Tragödie vor dem Leser, die unaufhaltsam einem Punkt entgegenstrebt, der durch Figurenkonstellation und Umstände vorgegeben ist. Die Geschichte von Romulus und Remus ist bekannt, der Konflikt der Zwillingsbrüder spielt sich allerdings fast immer unterschwellig ab, steht stellvertretend für zwei Wege, die die Menschheit einschlagen kann: einen harmonischen Weg mit der Natur und einen Weg der Gewalt, der sich durch seinen aktionistischen Charakter immer durchsetzen kann. Ein richtiger Kampf wird daraus so gut wie nie, denn der sanfte Weg von Remus ist dafür zu nachgiebig und lässt die Eskalation umso gravierender ausfallen.
So alt und vertraut der Mythos auch ist, Swann ist weit davon entfernt, einen antiken Einheitsbrei vorzusetzen – in seiner Welt ist eine ganze Bandbreite von Einflüssen sichtbar, von den Etruskern über die Minoer bis hin zum fernen Osten, Verbindungen zu anderen Swann-Werken wie der Minotaurus-Trilogie werden deutlich und vermitteln zusammen mit der fiktiven Geschichtsschreibung, von der in der Palmenblatt-Bibliothek in Die Bienenkönigin die Rede ist, ein zusammenhängendes Bild einer fiktiven, mythischen Antike.
Die lyrische Ästhetik findet sich bei Die Bienenkönigin nicht nur im Stil, sondern auch in den Beschreibungen dieser Welt, in der Mythen Wahrheit sind. Der vielbeschworene Sense of Wonder stellt sich auf unspektakuläre, beinahe spielerische Art und Weise ein, durch das Pendeln zwischen Heiterkeit und Melancholie, durch das Fernweh in eine geträumte Vergangenheit, deren Schleier Swann in seinen Romanen ein wenig lüften kann.
Die Besonderheit von Die Bienenkönigin lässt sich leichter erfahren als beschreiben, denn wenn man behauptet, dass jede Seite Freude beim Lesen macht, wird man dem Roman zwar durchaus gerecht, hat aber doch viel zu wenig gesagt. Wer Silberglocken hören und seidige Faun-Schwanzquasten spüren will, sollte sich im Antiquariat auf die Suche machen und trotz des fragwürdigen Covers einen Blick wagen.